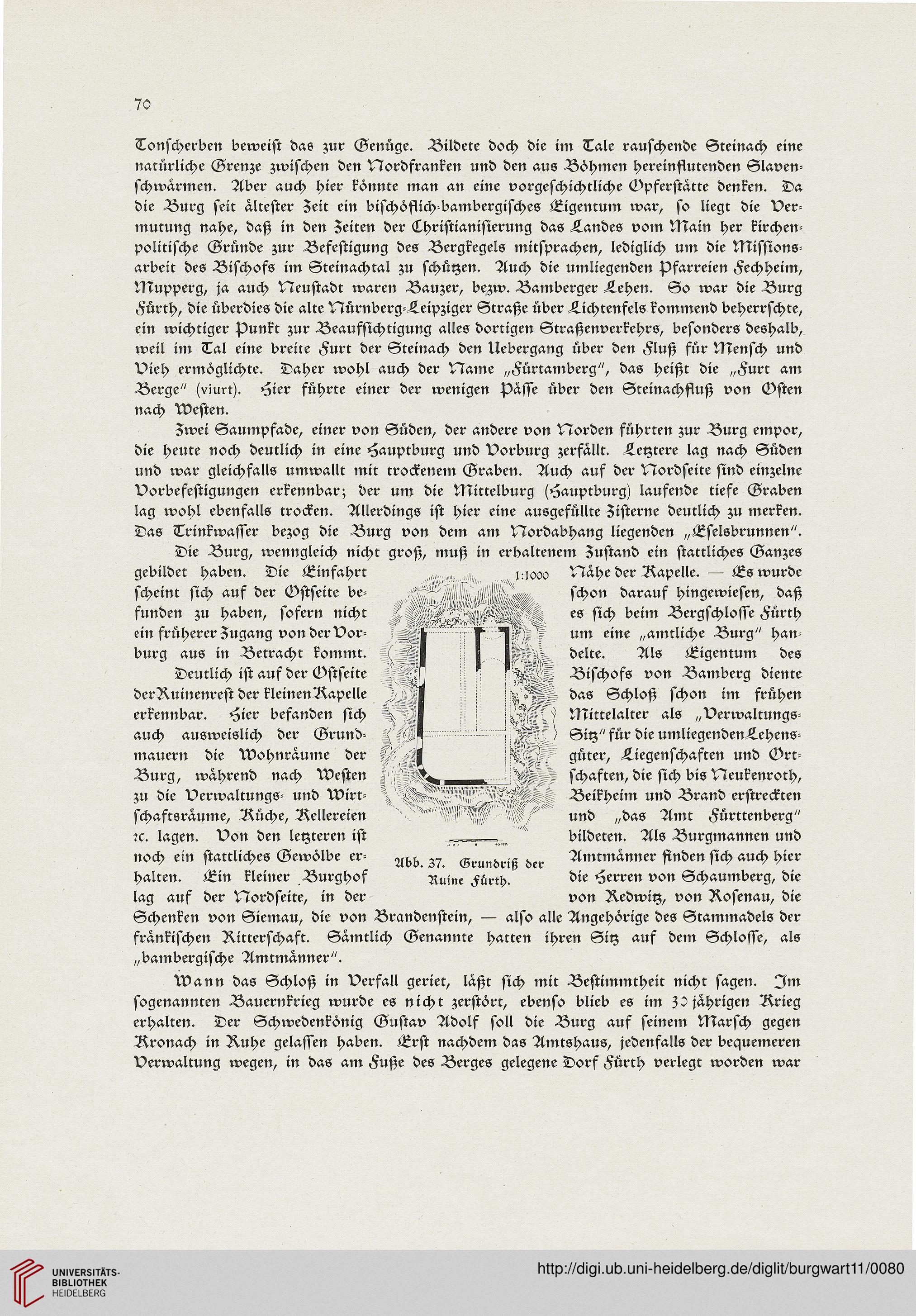70
Tonscherben berveist das ;ur (Aenügc. Bildctc doch dic iin Talc rauschcndc Steinach eine
natürliche Grenze zrvischen den Nordfranken und den aus Bökmen hereinflutenden Slaven-
schrvarmen. Aber auch hier könntc man an eine vorgeschichtliche Mpferstatte denken. Da
die Burg seit altester Zeit ein bischöflich-bainbcrgisches Eigencum rvar, so liegr die Ver-
inutung nahe, daß in den Zeiten der Lhriftianisierung das Landes voin Main her kirchen-
polirische Gründe zur Befestigung des Bergkegels inicsprachen, lediglich uin die Missions-
arbeic des Bischofs iin Steinachtal zu schützen. Auch die umliegenden Pfarreien ^echheim,
Mupperg, ja auch ^Zeustadc waren Bauzer, bezw. Bainberger Eehen. Go rvar die Vurg
Fürth, die übcrdies die alte Vlürnberg-Eeipziger Gcraße übcr Lichccnfels koininend beherrschte,
cin ivichtiger Punkt zur Beaufsichtigung a»es dorcigcn Scraßenvcrkehrs, besonders deshalb,
iveil iin Tal eine breite <^urt dcr Gteinach dcn Ucbergang über den Fluß für Mensch und
1?ieh erinöglichte. Daher rvohl auch der ^Zanre „Lürtanrbcrg", das heißc die „Lurt anr
Berge" (viurt). Hier führce einer der rvenigen Passe übcr den Gteinachfluß von Gsten
nach Wcsten.
Zrvei Gaunrpfade, einer von Güdcn, der andere von V7orden führtcn zur Burg enrpor,
die heute noch deuclich in eine ^auptburg und 1?orburg zcrfallr. Letztere lag nach Güden
und rvar gleichfalls uurrvallr nrit crockenenr Graben. Auch auf der ^ssordscire sind einzelnc
Vorbefeftigungen erkennbar; dcr unr die Miccelburg (Hauptburg) laufende tiefe Graben
lag wohl ebenfalls crocken. Allerdings ist hier eine ausgcfüllre Zisterne deutlich zu inerkcn.
Das Trinkrvasser bezog die Burg von denr ain ^ssordabhang liegenden „Eselsbrunnen".
Die Emrg, wennglcich nicht grofi, inuß in erhalrcnenr Zustand ein staccliches Ganzes
gebildec haben. Die Einfahrc
scheinr fich auf der Gstscite be-
funden ;u haben, sofern nichc
ein früherer Zugang von dcr1?or-
burg aus in Verrachc koinint.
Deurlich ist auf der Gstseitc
dcrRuinenrest dcr kleinenRapelle
crkennbar. >Zier befanden sich
auch ausrveislich der Grund-
nrauern die Wohnraunre der
Äurg, wahrend nach Vvesten
zu die Verrvaltungs- und IVirc-
schafcsrauine, Rüche, Rcllereien
rc. lagen. Von den letztercn ist
noch ein staccliches Gewdlbe er-
halcen. Ein kleiner Burghof
lag auf der ^ssordseire, in der
Schenken von Gieinau, dic von Brandenstein, — also alle Angehörige des Sraurinadels der
frankischen )^ittcrschaft. Sainclich Genannte hatten ihren Gitz auf dein Gchlosse, als
„banrbergische Amcnranner".
wann das Gchloß Ln Verfall geriec, laßc sich mit ^Zestimmtheit nichc sagen. Im
sogenannren Bauernkrieg rvurdc cs nicht zcrstörc, ebenso blicb es im Zdjahrigen 'Rrieg
erhalren. Der Gchwedenkönig Gustav Adolf soll die Burg auf seinem Marsch gegen
Rronach in Ruhe gelassen haben. Erft nachdem das Amrshaus, jedenfalls der bequemeren
Verwalcung rvegen, in das am Luße des Berges gelegene Dorf Fürth verlegt worden rvar
..niooo >Zahe der 'Rapclle. — Es rvurde
schon darauf hingerviesen, daß
es sich beim Bergschlosse Fürth
um eine „amtliche Burg" han-
delte. Als Eigentum des
Bischofs von Bamberg dicnte
das Gchloß schon in, frühen
Miccelalcer als „Verwalcungs
Gitz" für die unrliegcnden Lehens-
güter, Liegenschafcen und Grt
schafren, die sich bis Neukenroch,
Beikheinr und Ärand erstreckten
und „das Amt Fürttenberg"
bildecen. Als Burgmannen und
Amtinanner flnden sich auch hier
die Herren von Schaumberg, die
von Redwitz, von Xosenau, die
Abb. Z7. Grundriß der
Ruinc Fürth.
Tonscherben berveist das ;ur (Aenügc. Bildctc doch dic iin Talc rauschcndc Steinach eine
natürliche Grenze zrvischen den Nordfranken und den aus Bökmen hereinflutenden Slaven-
schrvarmen. Aber auch hier könntc man an eine vorgeschichtliche Mpferstatte denken. Da
die Burg seit altester Zeit ein bischöflich-bainbcrgisches Eigencum rvar, so liegr die Ver-
inutung nahe, daß in den Zeiten der Lhriftianisierung das Landes voin Main her kirchen-
polirische Gründe zur Befestigung des Bergkegels inicsprachen, lediglich uin die Missions-
arbeic des Bischofs iin Steinachtal zu schützen. Auch die umliegenden Pfarreien ^echheim,
Mupperg, ja auch ^Zeustadc waren Bauzer, bezw. Bainberger Eehen. Go rvar die Vurg
Fürth, die übcrdies die alte Vlürnberg-Eeipziger Gcraße übcr Lichccnfels koininend beherrschte,
cin ivichtiger Punkt zur Beaufsichtigung a»es dorcigcn Scraßenvcrkehrs, besonders deshalb,
iveil iin Tal eine breite <^urt dcr Gteinach dcn Ucbergang über den Fluß für Mensch und
1?ieh erinöglichte. Daher rvohl auch der ^Zanre „Lürtanrbcrg", das heißc die „Lurt anr
Berge" (viurt). Hier führce einer der rvenigen Passe übcr den Gteinachfluß von Gsten
nach Wcsten.
Zrvei Gaunrpfade, einer von Güdcn, der andere von V7orden führtcn zur Burg enrpor,
die heute noch deuclich in eine ^auptburg und 1?orburg zcrfallr. Letztere lag nach Güden
und rvar gleichfalls uurrvallr nrit crockenenr Graben. Auch auf der ^ssordscire sind einzelnc
Vorbefeftigungen erkennbar; dcr unr die Miccelburg (Hauptburg) laufende tiefe Graben
lag wohl ebenfalls crocken. Allerdings ist hier eine ausgcfüllre Zisterne deutlich zu inerkcn.
Das Trinkrvasser bezog die Burg von denr ain ^ssordabhang liegenden „Eselsbrunnen".
Die Emrg, wennglcich nicht grofi, inuß in erhalrcnenr Zustand ein staccliches Ganzes
gebildec haben. Die Einfahrc
scheinr fich auf der Gstscite be-
funden ;u haben, sofern nichc
ein früherer Zugang von dcr1?or-
burg aus in Verrachc koinint.
Deurlich ist auf der Gstseitc
dcrRuinenrest dcr kleinenRapelle
crkennbar. >Zier befanden sich
auch ausrveislich der Grund-
nrauern die Wohnraunre der
Äurg, wahrend nach Vvesten
zu die Verrvaltungs- und IVirc-
schafcsrauine, Rüche, Rcllereien
rc. lagen. Von den letztercn ist
noch ein staccliches Gewdlbe er-
halcen. Ein kleiner Burghof
lag auf der ^ssordseire, in der
Schenken von Gieinau, dic von Brandenstein, — also alle Angehörige des Sraurinadels der
frankischen )^ittcrschaft. Sainclich Genannte hatten ihren Gitz auf dein Gchlosse, als
„banrbergische Amcnranner".
wann das Gchloß Ln Verfall geriec, laßc sich mit ^Zestimmtheit nichc sagen. Im
sogenannren Bauernkrieg rvurdc cs nicht zcrstörc, ebenso blicb es im Zdjahrigen 'Rrieg
erhalren. Der Gchwedenkönig Gustav Adolf soll die Burg auf seinem Marsch gegen
Rronach in Ruhe gelassen haben. Erft nachdem das Amrshaus, jedenfalls der bequemeren
Verwalcung rvegen, in das am Luße des Berges gelegene Dorf Fürth verlegt worden rvar
..niooo >Zahe der 'Rapclle. — Es rvurde
schon darauf hingerviesen, daß
es sich beim Bergschlosse Fürth
um eine „amtliche Burg" han-
delte. Als Eigentum des
Bischofs von Bamberg dicnte
das Gchloß schon in, frühen
Miccelalcer als „Verwalcungs
Gitz" für die unrliegcnden Lehens-
güter, Liegenschafcen und Grt
schafren, die sich bis Neukenroch,
Beikheinr und Ärand erstreckten
und „das Amt Fürttenberg"
bildecen. Als Burgmannen und
Amtinanner flnden sich auch hier
die Herren von Schaumberg, die
von Redwitz, von Xosenau, die
Abb. Z7. Grundriß der
Ruinc Fürth.