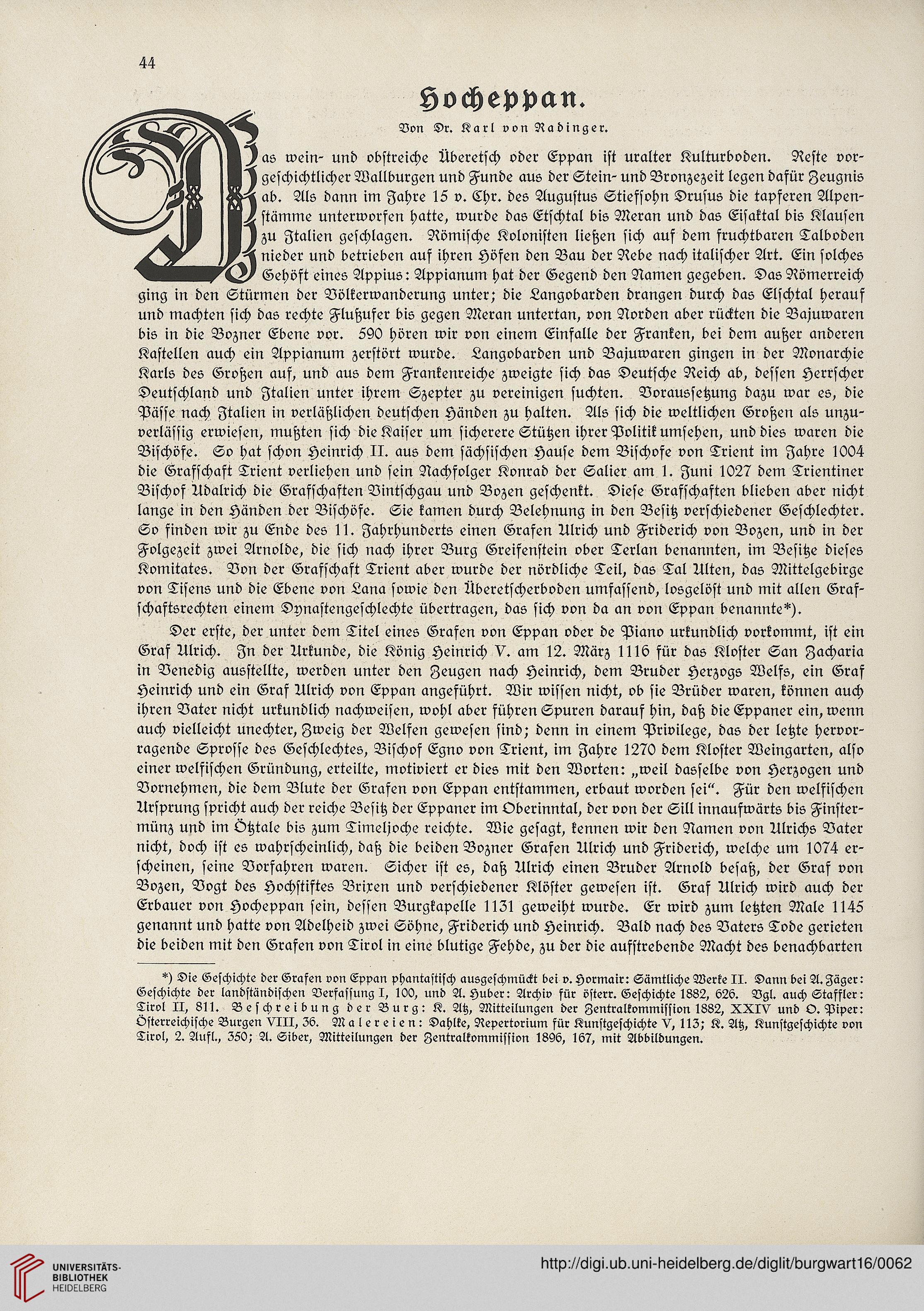44
Hocheppan.
Von Dr. Karl von Nadinger.
)as wein- und obstreiche Meretsch oder Eppan ist uralter Kulturboden. Reste vor-
I geschichtlicher Wallburgen und Funde aus der Stein- und Bronzezeit legen dafür Zeugnis
^ ab. Als dann im Iahre 15 v. Chr. des Augustus Stiessohn Drusus die tapferen Alpen-
stämme unterworfen hatte, wurde das Etschtal bis Meran und das Eisaktal bis Klausen
zu Italien geschlagen. Römische Kolonisten ließen sich auf dem fruchtbaren Talboden
^ nieder und betrieben auf ihren Höfen den Bau der Rebe nach italischer Art. Ein solches
Gehöft eines Appius: Appianum hat der Gegend den Namen gegeben. Das Römerreich
ging in den Stürmen der Völkerwanderung unter; die Langobarden drangen durch das Elschtal heraus
und machten sich das rechte Flutzufer bis gegen Meran untertan, von Norden aber rückten die Bajuwaren
bis in die Bozner Ebene vor. 59O hören wir von einem Einfalle der Aranken, bei dem autzer anderen
Kastellen auch ein Appianum zerstört wurde. Langobarden und Bajuwaren gingen in der Monarchie
Karls des Grotzen auf, und aus dem Frankenreiche zweigte sich das Deutsche Reich ab, dessen Herrscher
Deutschland und Italien unter ihrem Szepter zu vereinigen suchten. Voraussetzung dazu war es, die
Pässe nach Italien in verlätzlichen deutschen Händen zu halten. Als sich die weltlichen Grotzen als unzu-
verlässig erwiesen, mußten sich die Kaiser um sicherere Stützen ihrer Politik umsehen, und dies waren die
Bischöfe. So hat schon Heinrich II. aus dem sächsischen Hause dem Vischofe von Trient im Iahre 1004
die Grasschaft Trient verliehen und sein Nachfolger Konrad der Salier am 1. Iuni 1O27 dem Trientiner
Bischof Adalrich die Grafschasten Vintschgau und Bozen geschenkt. Diese Grafschaften blieben aber nicht
lange in den Händen der Bischöfe. Sie kamen durch Belehnung in den Besitz verschiedener Geschlechter.
So finden wir zu Ende des 11. Iahrhunderts einen Grafen Ulrich und Friderich von Bozen, und in der
Folgezeit zwei Arnolde, die sich nach ihrer Burg Greifenstein ober Terlan benannten, im Besitze dieses
Komitates. Von der Grafschaft Trient aber wurde der nördliche Teil, das Tal Alten, das Mittelgebirge
von Tisens und die Ebene von Lana sowie den Überetscherboden umfassend, losgelöst und mit allen Gras-
schaftsrechten einem Dynastengeschlechte übertragen, das sich von da an von Eppan benannte*).
Der erste, der unter dem Titel eines Grafen von Eppan oder de Piano urkundlich vorkommt, ist ein
Graf Ulrich. In der Urkunde, die König Heinrich V. am 12. März 1116 für das Kloster San Zacharia
in Venedig ausstellte, werden unter den Zeugen nach Heinrich, dem Bruder Herzogs Welfs, ein Graf
Heinrich und ein Gras Alrich von Eppan angeführt. Wir wissen nicht, ob sie Brüder waren, können auch
ihren Vater nicht urkundlich nachweisen, wohl aber führen Spuren darauf hin, datz die Eppaner ein, wenn
auch vielleicht unechter, Zweig der Welfen gewesen sind; denn in einem Privilege, das der letzte hervor-
ragende Sprosse des Geschlechtes, Bischof Egno von Trient, im Iahre 127O dem Kloster Weingarten, also
einer welsischen Gründung, erteilte, motiviert er dies mit den Worten: „weil dasselbe von Herzogen und
Vornehmen, die dem Blute der Grafen von Eppan entstammen, erbaut worden sei". Für den welfischen
Arsprung spricht auch der reiche Besitz der Eppaner im Oberinntal, der von der Sill innaufwärts bis Fmster-
münz und im Otztale bis zum Timeljoche reichte. Wie gesagt, kennen wir den Namen von Alrichs Vater
nicht, doch ist es wahrscheinlich, datz die beiden Bozner Grafen Alrich und Friderich, welche um 1O74 er-
scheinen, seine Vorfahren waren. Sicher ist es, datz Alrich einen Bruder Arnold besaß, der Graf von
Bozen, Vogt des Hochstiftes Brixen und verschiedener Klöster gewesen ist. Graf Alrich wird auch der
Erbauer von Hocheppan sein, dessen Burgkapelle 1131 geweiht wurde. Er wird zum letzten Male 1145
genannt und hatte von Adelheid zwei Söhne, Friderich und Heinrich. Bald nach des Vaters Tode gerieten
die beiden mit den Grafen von Tirol in eine blutige Fehde, zu der die aufstrebende Macht des benachbarten
*) Die Geschichte der Grafen von Eppan phantastisch ausgeschmückt bei v. Hormair: Sämtliche Werke II. Dann bei A. Zager:
Geschichte der landständischen Verfassung I, 100, und A. Huber: Archiv für österr. Geschichte 1882, 026. Vgl. auch Staffler:
Tirol II, 811. Beschreibung der Burg: K. Atz, Mitteilungen der Zentralkommission 1882, XXIV und O. Piper:
Österreichische Burgen VIII, Z6. Malereien: Dahlke, Repertorium für Kunstgeschichte V, 11Z; K. Atz, Kunstgeschichte von
Tirol, 2. Ausl., Z50; A. Siber, Mitteilungen der Zentralkommission 1896, 167, mit Abbildungen.
Hocheppan.
Von Dr. Karl von Nadinger.
)as wein- und obstreiche Meretsch oder Eppan ist uralter Kulturboden. Reste vor-
I geschichtlicher Wallburgen und Funde aus der Stein- und Bronzezeit legen dafür Zeugnis
^ ab. Als dann im Iahre 15 v. Chr. des Augustus Stiessohn Drusus die tapferen Alpen-
stämme unterworfen hatte, wurde das Etschtal bis Meran und das Eisaktal bis Klausen
zu Italien geschlagen. Römische Kolonisten ließen sich auf dem fruchtbaren Talboden
^ nieder und betrieben auf ihren Höfen den Bau der Rebe nach italischer Art. Ein solches
Gehöft eines Appius: Appianum hat der Gegend den Namen gegeben. Das Römerreich
ging in den Stürmen der Völkerwanderung unter; die Langobarden drangen durch das Elschtal heraus
und machten sich das rechte Flutzufer bis gegen Meran untertan, von Norden aber rückten die Bajuwaren
bis in die Bozner Ebene vor. 59O hören wir von einem Einfalle der Aranken, bei dem autzer anderen
Kastellen auch ein Appianum zerstört wurde. Langobarden und Bajuwaren gingen in der Monarchie
Karls des Grotzen auf, und aus dem Frankenreiche zweigte sich das Deutsche Reich ab, dessen Herrscher
Deutschland und Italien unter ihrem Szepter zu vereinigen suchten. Voraussetzung dazu war es, die
Pässe nach Italien in verlätzlichen deutschen Händen zu halten. Als sich die weltlichen Grotzen als unzu-
verlässig erwiesen, mußten sich die Kaiser um sicherere Stützen ihrer Politik umsehen, und dies waren die
Bischöfe. So hat schon Heinrich II. aus dem sächsischen Hause dem Vischofe von Trient im Iahre 1004
die Grasschaft Trient verliehen und sein Nachfolger Konrad der Salier am 1. Iuni 1O27 dem Trientiner
Bischof Adalrich die Grafschasten Vintschgau und Bozen geschenkt. Diese Grafschaften blieben aber nicht
lange in den Händen der Bischöfe. Sie kamen durch Belehnung in den Besitz verschiedener Geschlechter.
So finden wir zu Ende des 11. Iahrhunderts einen Grafen Ulrich und Friderich von Bozen, und in der
Folgezeit zwei Arnolde, die sich nach ihrer Burg Greifenstein ober Terlan benannten, im Besitze dieses
Komitates. Von der Grafschaft Trient aber wurde der nördliche Teil, das Tal Alten, das Mittelgebirge
von Tisens und die Ebene von Lana sowie den Überetscherboden umfassend, losgelöst und mit allen Gras-
schaftsrechten einem Dynastengeschlechte übertragen, das sich von da an von Eppan benannte*).
Der erste, der unter dem Titel eines Grafen von Eppan oder de Piano urkundlich vorkommt, ist ein
Graf Ulrich. In der Urkunde, die König Heinrich V. am 12. März 1116 für das Kloster San Zacharia
in Venedig ausstellte, werden unter den Zeugen nach Heinrich, dem Bruder Herzogs Welfs, ein Graf
Heinrich und ein Gras Alrich von Eppan angeführt. Wir wissen nicht, ob sie Brüder waren, können auch
ihren Vater nicht urkundlich nachweisen, wohl aber führen Spuren darauf hin, datz die Eppaner ein, wenn
auch vielleicht unechter, Zweig der Welfen gewesen sind; denn in einem Privilege, das der letzte hervor-
ragende Sprosse des Geschlechtes, Bischof Egno von Trient, im Iahre 127O dem Kloster Weingarten, also
einer welsischen Gründung, erteilte, motiviert er dies mit den Worten: „weil dasselbe von Herzogen und
Vornehmen, die dem Blute der Grafen von Eppan entstammen, erbaut worden sei". Für den welfischen
Arsprung spricht auch der reiche Besitz der Eppaner im Oberinntal, der von der Sill innaufwärts bis Fmster-
münz und im Otztale bis zum Timeljoche reichte. Wie gesagt, kennen wir den Namen von Alrichs Vater
nicht, doch ist es wahrscheinlich, datz die beiden Bozner Grafen Alrich und Friderich, welche um 1O74 er-
scheinen, seine Vorfahren waren. Sicher ist es, datz Alrich einen Bruder Arnold besaß, der Graf von
Bozen, Vogt des Hochstiftes Brixen und verschiedener Klöster gewesen ist. Graf Alrich wird auch der
Erbauer von Hocheppan sein, dessen Burgkapelle 1131 geweiht wurde. Er wird zum letzten Male 1145
genannt und hatte von Adelheid zwei Söhne, Friderich und Heinrich. Bald nach des Vaters Tode gerieten
die beiden mit den Grafen von Tirol in eine blutige Fehde, zu der die aufstrebende Macht des benachbarten
*) Die Geschichte der Grafen von Eppan phantastisch ausgeschmückt bei v. Hormair: Sämtliche Werke II. Dann bei A. Zager:
Geschichte der landständischen Verfassung I, 100, und A. Huber: Archiv für österr. Geschichte 1882, 026. Vgl. auch Staffler:
Tirol II, 811. Beschreibung der Burg: K. Atz, Mitteilungen der Zentralkommission 1882, XXIV und O. Piper:
Österreichische Burgen VIII, Z6. Malereien: Dahlke, Repertorium für Kunstgeschichte V, 11Z; K. Atz, Kunstgeschichte von
Tirol, 2. Ausl., Z50; A. Siber, Mitteilungen der Zentralkommission 1896, 167, mit Abbildungen.