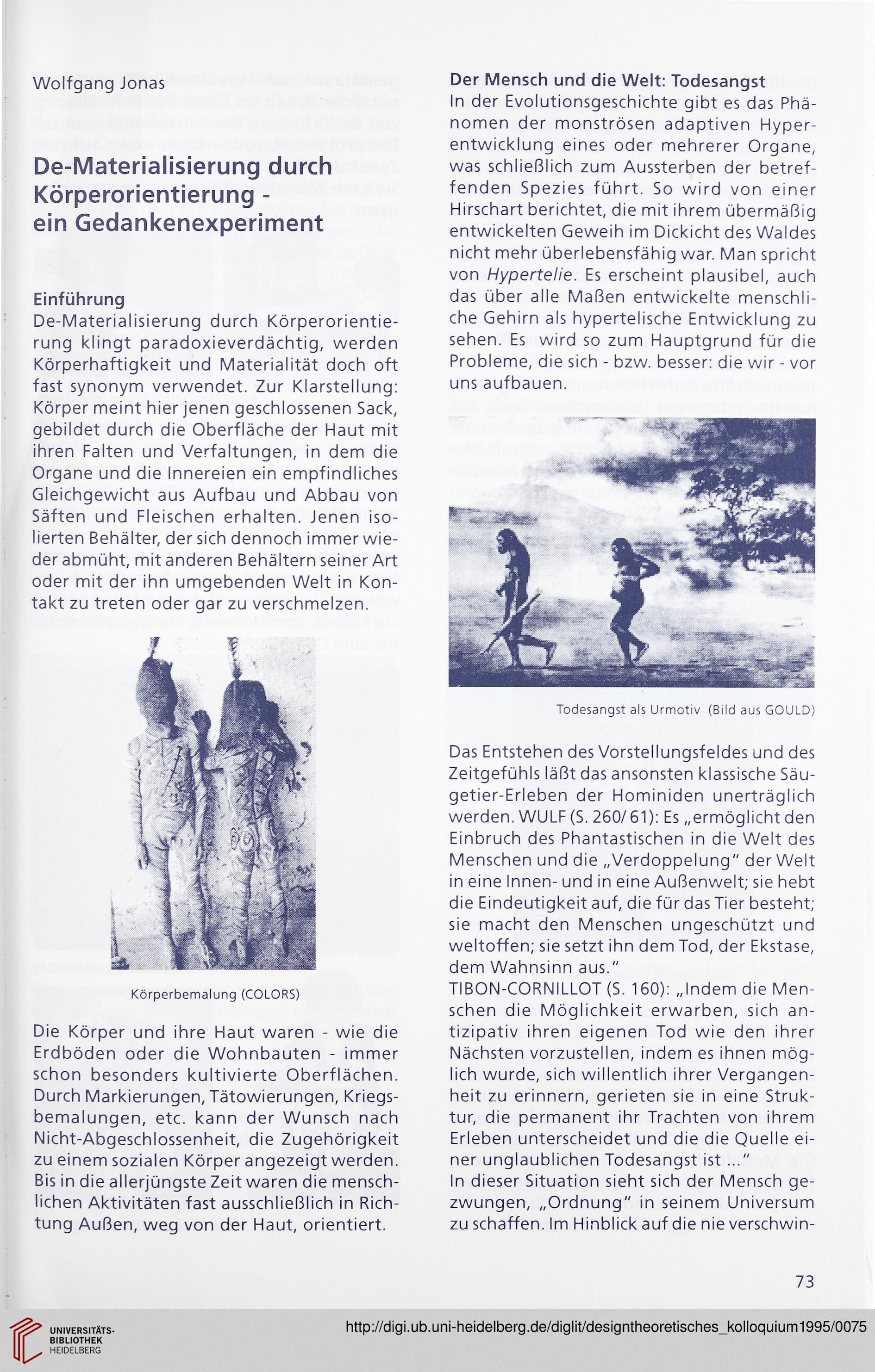Wolfgang Jonas
De-Materialisierung durch
Körperorientierung -
ein Gedankenexperiment
Einführung
De-Materialisierung durch Körperorientie-
rung klingt paradoxieverdächtig, werden
Körperhaftigkeit und Materialität doch oft
fast synonym verwendet. Zur Klarstellung:
Körper meint hier jenen geschlossenen Sack,
gebildet durch die Oberfläche der Haut mit
ihren Falten und Verfaltungen, in dem die
Organe und die Innereien ein empfindliches
Gleichgewicht aus Aufbau und Abbau von
Säften und Fleischen erhalten. Jenen iso-
lierten Behälter, der sich dennoch immer wie-
derabmüht, mitanderen Behälternseiner Art
oder mit der ihn umgebenden Welt in Kon-
takt zu treten oder gar zu verschmelzen.
Körperbemalung (COLORS)
Die Körper und ihre Haut waren - wie die
Erdböden oder die Wohnbauten - immer
schon besonders kultivierte Oberflächen.
Durch Markierungen, Tätowierungen, Kriegs-
bemalungen, etc. kann der Wunsch nach
Nicht-Abgeschlossenheit, die Zugehörigkeit
zu einem sozialen Körper angezeigt werden.
Bis in die allerjüngste Zeit waren die mensch-
lichen Aktivitäten fast ausschließlich in Rich-
tung Außen, weg von der Haut, orientiert.
Der Mensch und die Welt: Todesangst
In der Evolutionsgeschichte gibt es das Phä-
nomen der monströsen adaptiven Hyper-
entwicklung eines oder mehrerer Organe,
was schließlich zum Aussterben der betref-
fenden Spezies führt. So wird von einer
Hirschart berichtet, die mit ihrem übermäßig
entwickelten Geweih im Dickicht des Waldes
nicht mehr überlebensfähig war. Man spricht
von Hypertelie. Es erscheint plausibel, auch
das über alle Maßen entwickelte menschli-
che Gehirn als hypertelische Entwicklung zu
sehen. Es wird so zum Hauptgrund für die
Probleme, die sich - bzw. besser: die wir - vor
uns aufbauen.
Todesangst als Urmotiv (ßild aus GOULD)
Das Entstehen des Vorstellungsfeldes und des
Zeitgefühls läßt das ansonsten klassische Säu-
getier-Erleben der Hominiden unerträglich
werden. WULF (S. 260/61): Es „ermöglicht den
Einbruch des Phantastischen in die Welt des
Menschen und die „Verdoppelung" der Welt
in eine Innen- und in eine Außenwelt; sie hebt
die Eindeutigkeit auf, diefürdasTierbesteht;
sie macht den Menschen ungeschützt und
weltoffen; sie setzt ihn dem Tod, der Ekstase,
dem Wahnsinn aus."
TIBON-CORNILLOT (S. 160): „Indem die Men-
schen die Möglichkeit erwarben, sich an-
tizipativ ihren eigenen Tod wie den ihrer
Nächsten vorzustellen, indem es ihnen mög-
lich wurde, sich willentlich ihrer Vergangen-
heit zu erinnern, gerieten sie in eine Struk-
tur, die permanent ihr Trachten von ihrem
Erleben unterscheidet und die die Quelle ei-
ner unglaublichen Todesangst ist ..."
In dieser Situation sieht sich der Mensch ge-
zwungen, „Ordnung" in seinem Universum
zu schaffen. Im Hinblick auf die nie verschwin-
73
De-Materialisierung durch
Körperorientierung -
ein Gedankenexperiment
Einführung
De-Materialisierung durch Körperorientie-
rung klingt paradoxieverdächtig, werden
Körperhaftigkeit und Materialität doch oft
fast synonym verwendet. Zur Klarstellung:
Körper meint hier jenen geschlossenen Sack,
gebildet durch die Oberfläche der Haut mit
ihren Falten und Verfaltungen, in dem die
Organe und die Innereien ein empfindliches
Gleichgewicht aus Aufbau und Abbau von
Säften und Fleischen erhalten. Jenen iso-
lierten Behälter, der sich dennoch immer wie-
derabmüht, mitanderen Behälternseiner Art
oder mit der ihn umgebenden Welt in Kon-
takt zu treten oder gar zu verschmelzen.
Körperbemalung (COLORS)
Die Körper und ihre Haut waren - wie die
Erdböden oder die Wohnbauten - immer
schon besonders kultivierte Oberflächen.
Durch Markierungen, Tätowierungen, Kriegs-
bemalungen, etc. kann der Wunsch nach
Nicht-Abgeschlossenheit, die Zugehörigkeit
zu einem sozialen Körper angezeigt werden.
Bis in die allerjüngste Zeit waren die mensch-
lichen Aktivitäten fast ausschließlich in Rich-
tung Außen, weg von der Haut, orientiert.
Der Mensch und die Welt: Todesangst
In der Evolutionsgeschichte gibt es das Phä-
nomen der monströsen adaptiven Hyper-
entwicklung eines oder mehrerer Organe,
was schließlich zum Aussterben der betref-
fenden Spezies führt. So wird von einer
Hirschart berichtet, die mit ihrem übermäßig
entwickelten Geweih im Dickicht des Waldes
nicht mehr überlebensfähig war. Man spricht
von Hypertelie. Es erscheint plausibel, auch
das über alle Maßen entwickelte menschli-
che Gehirn als hypertelische Entwicklung zu
sehen. Es wird so zum Hauptgrund für die
Probleme, die sich - bzw. besser: die wir - vor
uns aufbauen.
Todesangst als Urmotiv (ßild aus GOULD)
Das Entstehen des Vorstellungsfeldes und des
Zeitgefühls läßt das ansonsten klassische Säu-
getier-Erleben der Hominiden unerträglich
werden. WULF (S. 260/61): Es „ermöglicht den
Einbruch des Phantastischen in die Welt des
Menschen und die „Verdoppelung" der Welt
in eine Innen- und in eine Außenwelt; sie hebt
die Eindeutigkeit auf, diefürdasTierbesteht;
sie macht den Menschen ungeschützt und
weltoffen; sie setzt ihn dem Tod, der Ekstase,
dem Wahnsinn aus."
TIBON-CORNILLOT (S. 160): „Indem die Men-
schen die Möglichkeit erwarben, sich an-
tizipativ ihren eigenen Tod wie den ihrer
Nächsten vorzustellen, indem es ihnen mög-
lich wurde, sich willentlich ihrer Vergangen-
heit zu erinnern, gerieten sie in eine Struk-
tur, die permanent ihr Trachten von ihrem
Erleben unterscheidet und die die Quelle ei-
ner unglaublichen Todesangst ist ..."
In dieser Situation sieht sich der Mensch ge-
zwungen, „Ordnung" in seinem Universum
zu schaffen. Im Hinblick auf die nie verschwin-
73