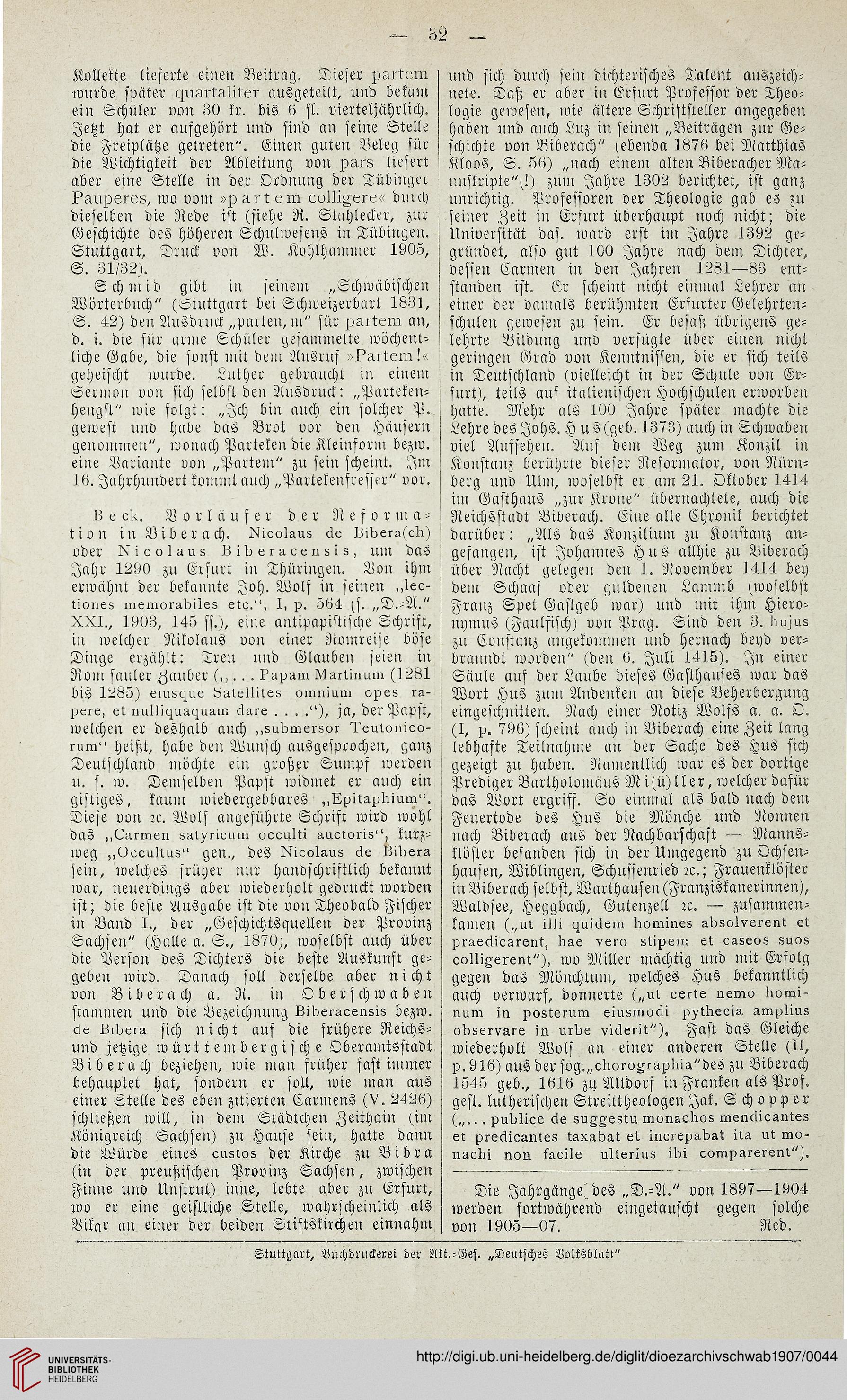Kollekte lieferte einen Beitrag. Dieser pÄi'wm
wurde später ^Ucirtclliter ausgeteilt, und bekam
ein Schüler von 30 kr. bis 6 fl. vierteljährlich.
Jetzt hat er ausgehört und sind an seine Stelle
die Freiplätze getreten". Einen guten Beleg sür
die Wichtigkeit der Ableitung von liefert
aber eine Stelle in der Ordnung der Tübinger
wo vom »pÄrterri colli^ere« durch
dieselben die Rede ist (siehe R. Stahlecker, zur
Geschichte des höheren Schulwesens in Tübingen.
Stuttgart, Druck von W. Kohlhammer 1903,
S. 31/32).
Schmid gibt in seinem „Schwäbischen
Wörterbuch" (Stuttgart bei Schweizerbart 1831,
S. 42) den Ausdruck „parten, m" für p-irtem an,
d. i. die für arme Schüler gesammelte wöchent-
liche Gabe, die sonst mit dem Ausruf »l^rtem!«
geheischt wurde. Luther gebraucht in einem
Sermon von sich selbst den Ausdruck: „Parteken-
hengst" wie folgt: „Ich bin auch ein solcher P.
gewest und habe das Brot vor den Häusern
genommen", wonach Parteken die Kleinform bezw.
eine Variante von „Partem" zu sein scheint. Im
16. Jahrhundert kommt auch „Partekenfresser" vor.
L e cli. Vorläufer der Reforma-
tion in Biber ach. l^ieolaus cie Lidera(clr)
oder i c o I a u 8 Likzeracensis, um das
Jahr 1290 zu Erfurt in Thüringen. Bon ihm
erwähnt der bekannte Joh. Wolf in seinen ,,kec-
tiones rnemoradikes etc.", I, p. 564 >s. „D.-A."
XXI., 1903, 145 ff.), eine antipapiftische Schrift,
in welcher Nikolaus von einer Atomreise böse
Dinge erzählt: Treu und Glauben seien in
Nom fauler Zauber (,,... 1'upam klartinum (1281
bis 1^85) eius^ue Latellites omnium opes rs-
psre, st nulli^ua^uam clare . . . ."), ja, der Papst,
welchen er deshalb auch „sudmsrsor 4'sutonico-
rum" heißt, habe den Wunsch ausgesprochen, ganz
Deutschland möchte ein großer Sumpf werden
u. f. w. Demfelben Papst widmet er auch ein
giftiges, kaum wiedergebbares „Lpitapkium".
Diese von :c. Wolf angeführte Schrift wird wohl
das „Lärmen sat^ricurn occulti auctoris", kurz-
weg ,,<^)ccultus" gen., des ^licolaus äs Widers
sein, welches früher nur handschriftlich bekannt
war, neuerdings aber wiederholt gedruckt worden
ist; die beste 'Ausgabe ist die von Theobald Fischer
in Band 1., der „Geschichtsquelleu der Provinz
Sachsen" (Halle a. S., 1870), woselbst auch über
die Person des Dichters die beste Auskunft ge-
geben wird. Danach soll derselbe aber nicht
von Biber ach a. R. in Oberschwaben
stammen und die Bezeichnung Libsracensis bezw.
cle liidera sich uicht aus die frühere Reichs-
und jetzige württembergi f ch e Oberamtsstadt
Biberach beziehen, wie man früher fast immer
behauptet hat, sondern er soll, wie man aus
einer Ltelle des eben zitierten Carmens (V. 2426)
schließen will, in dem Städtchen Zeithain (im
Königreich Sachsen) zu Hanse sein, hatte dann
die Würde eines custos der Kirche zu Bibra
(in der preußischen Provinz Sachsen, zwischen
Finne und Unstrut) inne, lebte aber zu Erfurt,
wo er eine geistliche Stelle, wahrscheinlich als
Vikar an einer der beiden Stiftskirchen einnahm
und sich dnrch sein dichterisches Talent auszeich-
nete. Daß er aber in Erfurt Professor der Theo-
logie gewesen, wie ältere Schriststeller angegeben
haben und auch Luz in seinen „Beiträgen zur Ge-
schichte vou Biberach" (ebenda 1876 bei Matthias
Kloos, S. 56) „nach einem alten Biberacher Ma-
nuskripte"^) zum Jahre >302 berichtet, ist ganz
uinichtig. Professoren der Theologie gab es zu
seiner Zeit in Erfurt überhaupt noch nicht; die
Universität das. ward erst im Jahre 1392 ge-
gründet, also gut 100 Jahre nach dem Dichter,
dessen Carmen in den Jahren 1281—83 ent-
standen ist. Er scheint nicht einmal Lehrer an
einer der damals berühmten Erfurter Gelehrten-
schulen gewesen zu sein. Er besaß übrigens ge-
lehrte Bildung und verfügte über einen nicht
geringen Grad von Kenntnissen, die er sich teils
in Deutschlaud (vielleicht in der Schule von Er-
furt), teils auf italienischen Hochschuleu erworben
hatte. Mehr als 100 Jahre später machte die
Lehre des Johs. H u s(geb. 1373) auch in Schwaben
viel Aussehen. Ans dem Weg zum Konzil in
Konstanz berührte dieser Reformator, von Nürn-
berg uiid Ulm, woselbst er am 21. Oktober 1414
im Gasthaus „zur Krone" übernachtete, auch die
Reichsstadt Biberach. Eine alte Chronik berichtet
darüber: „Als das Konzilium zu Konstanz an-
gefangen, ist Johannes Hus allhie zu Biberach
über Nacht gelegen den 1. November 1414 bey
dem Schaaf oder güldenen Lammb (woselbst
Franz Spet Gastgeb war) und mit ihm Hiero-
nymus (Faulfisch) von Prag. Sind den 3. Iiujus
zn Conftanz angekommen und hernach beyd ver-
branndt worden" (den 6. Juli 1415). In einer
Säule auf der Laube dieses Gasthauses war das
Wort Hus zum Andenken an diese Beherbergung
eingeschnitten. Nach einer Notiz Wolfs a. a. O.
(I, p. 796) scheint auch in Biberach eine Zeit lang
lebhafte Teilnahme an der Sache des Hus sich
gezeigt zu haben. Namentlich war es der dortige
Prediger Bartholomäus M i(ü)ller, welcher dafUr
das Wort ergriff. So einmal als bald nach dem
Feuertode des Hus die Mönche und Nonnen
nach Biberach aus der Nachbarschaft — Manns-
klöster befanden sich in der Umgegend zu Ochsen-
Hausen, Wiblingen, Schnffenried?c.; Frauenklöster
in Biberach selbst, Warthausen (Franziskanerinnen),
Waldsee, Heggbach, Gutenzell :c. — zusammen-
kameil („ut Uli quickem komines adsolverent et
piÄeclicgrent, Irse verc> stipein et caseos suos
colliAerent"), wo Miller mächtig und mit Erfolg
gegen das Mönchtnm, welches Hus bekanntlich
auch verwarf, donnerte („ut certe nemo liowi-
num in posterum eiusinocli p^tlrecia amplius
okservare in urds viäerit"). Fast das Gleiche
wiederholt Wolf au einer anderen Stelle (1l,
p. 916) aus der sog.„c^orc>Arap1iia"des zu Biberach
1545 geb., 1616 zu Altdorf in Franken als Prof.
gest. lutherischen Streittheologen Jak. Schopper
(„.. . pudlice cle suAgestu inonsckos inenclicantes
et preclicantes taxadat et increpadat ila ut mc>-
nacln non kacile ulterius idi cornparerent").
Die Jahrgänge des „D.-A." von 1897—1904
werden fortwährend eingetauscht gegen solche
von 1905—07. Red.
Stuttgart, Buchdruckerei der Akt.-Ges. „Deutsches VolksbüUt"
wurde später ^Ucirtclliter ausgeteilt, und bekam
ein Schüler von 30 kr. bis 6 fl. vierteljährlich.
Jetzt hat er ausgehört und sind an seine Stelle
die Freiplätze getreten". Einen guten Beleg sür
die Wichtigkeit der Ableitung von liefert
aber eine Stelle in der Ordnung der Tübinger
wo vom »pÄrterri colli^ere« durch
dieselben die Rede ist (siehe R. Stahlecker, zur
Geschichte des höheren Schulwesens in Tübingen.
Stuttgart, Druck von W. Kohlhammer 1903,
S. 31/32).
Schmid gibt in seinem „Schwäbischen
Wörterbuch" (Stuttgart bei Schweizerbart 1831,
S. 42) den Ausdruck „parten, m" für p-irtem an,
d. i. die für arme Schüler gesammelte wöchent-
liche Gabe, die sonst mit dem Ausruf »l^rtem!«
geheischt wurde. Luther gebraucht in einem
Sermon von sich selbst den Ausdruck: „Parteken-
hengst" wie folgt: „Ich bin auch ein solcher P.
gewest und habe das Brot vor den Häusern
genommen", wonach Parteken die Kleinform bezw.
eine Variante von „Partem" zu sein scheint. Im
16. Jahrhundert kommt auch „Partekenfresser" vor.
L e cli. Vorläufer der Reforma-
tion in Biber ach. l^ieolaus cie Lidera(clr)
oder i c o I a u 8 Likzeracensis, um das
Jahr 1290 zu Erfurt in Thüringen. Bon ihm
erwähnt der bekannte Joh. Wolf in seinen ,,kec-
tiones rnemoradikes etc.", I, p. 564 >s. „D.-A."
XXI., 1903, 145 ff.), eine antipapiftische Schrift,
in welcher Nikolaus von einer Atomreise böse
Dinge erzählt: Treu und Glauben seien in
Nom fauler Zauber (,,... 1'upam klartinum (1281
bis 1^85) eius^ue Latellites omnium opes rs-
psre, st nulli^ua^uam clare . . . ."), ja, der Papst,
welchen er deshalb auch „sudmsrsor 4'sutonico-
rum" heißt, habe den Wunsch ausgesprochen, ganz
Deutschland möchte ein großer Sumpf werden
u. f. w. Demfelben Papst widmet er auch ein
giftiges, kaum wiedergebbares „Lpitapkium".
Diese von :c. Wolf angeführte Schrift wird wohl
das „Lärmen sat^ricurn occulti auctoris", kurz-
weg ,,<^)ccultus" gen., des ^licolaus äs Widers
sein, welches früher nur handschriftlich bekannt
war, neuerdings aber wiederholt gedruckt worden
ist; die beste 'Ausgabe ist die von Theobald Fischer
in Band 1., der „Geschichtsquelleu der Provinz
Sachsen" (Halle a. S., 1870), woselbst auch über
die Person des Dichters die beste Auskunft ge-
geben wird. Danach soll derselbe aber nicht
von Biber ach a. R. in Oberschwaben
stammen und die Bezeichnung Libsracensis bezw.
cle liidera sich uicht aus die frühere Reichs-
und jetzige württembergi f ch e Oberamtsstadt
Biberach beziehen, wie man früher fast immer
behauptet hat, sondern er soll, wie man aus
einer Ltelle des eben zitierten Carmens (V. 2426)
schließen will, in dem Städtchen Zeithain (im
Königreich Sachsen) zu Hanse sein, hatte dann
die Würde eines custos der Kirche zu Bibra
(in der preußischen Provinz Sachsen, zwischen
Finne und Unstrut) inne, lebte aber zu Erfurt,
wo er eine geistliche Stelle, wahrscheinlich als
Vikar an einer der beiden Stiftskirchen einnahm
und sich dnrch sein dichterisches Talent auszeich-
nete. Daß er aber in Erfurt Professor der Theo-
logie gewesen, wie ältere Schriststeller angegeben
haben und auch Luz in seinen „Beiträgen zur Ge-
schichte vou Biberach" (ebenda 1876 bei Matthias
Kloos, S. 56) „nach einem alten Biberacher Ma-
nuskripte"^) zum Jahre >302 berichtet, ist ganz
uinichtig. Professoren der Theologie gab es zu
seiner Zeit in Erfurt überhaupt noch nicht; die
Universität das. ward erst im Jahre 1392 ge-
gründet, also gut 100 Jahre nach dem Dichter,
dessen Carmen in den Jahren 1281—83 ent-
standen ist. Er scheint nicht einmal Lehrer an
einer der damals berühmten Erfurter Gelehrten-
schulen gewesen zu sein. Er besaß übrigens ge-
lehrte Bildung und verfügte über einen nicht
geringen Grad von Kenntnissen, die er sich teils
in Deutschlaud (vielleicht in der Schule von Er-
furt), teils auf italienischen Hochschuleu erworben
hatte. Mehr als 100 Jahre später machte die
Lehre des Johs. H u s(geb. 1373) auch in Schwaben
viel Aussehen. Ans dem Weg zum Konzil in
Konstanz berührte dieser Reformator, von Nürn-
berg uiid Ulm, woselbst er am 21. Oktober 1414
im Gasthaus „zur Krone" übernachtete, auch die
Reichsstadt Biberach. Eine alte Chronik berichtet
darüber: „Als das Konzilium zu Konstanz an-
gefangen, ist Johannes Hus allhie zu Biberach
über Nacht gelegen den 1. November 1414 bey
dem Schaaf oder güldenen Lammb (woselbst
Franz Spet Gastgeb war) und mit ihm Hiero-
nymus (Faulfisch) von Prag. Sind den 3. Iiujus
zn Conftanz angekommen und hernach beyd ver-
branndt worden" (den 6. Juli 1415). In einer
Säule auf der Laube dieses Gasthauses war das
Wort Hus zum Andenken an diese Beherbergung
eingeschnitten. Nach einer Notiz Wolfs a. a. O.
(I, p. 796) scheint auch in Biberach eine Zeit lang
lebhafte Teilnahme an der Sache des Hus sich
gezeigt zu haben. Namentlich war es der dortige
Prediger Bartholomäus M i(ü)ller, welcher dafUr
das Wort ergriff. So einmal als bald nach dem
Feuertode des Hus die Mönche und Nonnen
nach Biberach aus der Nachbarschaft — Manns-
klöster befanden sich in der Umgegend zu Ochsen-
Hausen, Wiblingen, Schnffenried?c.; Frauenklöster
in Biberach selbst, Warthausen (Franziskanerinnen),
Waldsee, Heggbach, Gutenzell :c. — zusammen-
kameil („ut Uli quickem komines adsolverent et
piÄeclicgrent, Irse verc> stipein et caseos suos
colliAerent"), wo Miller mächtig und mit Erfolg
gegen das Mönchtnm, welches Hus bekanntlich
auch verwarf, donnerte („ut certe nemo liowi-
num in posterum eiusinocli p^tlrecia amplius
okservare in urds viäerit"). Fast das Gleiche
wiederholt Wolf au einer anderen Stelle (1l,
p. 916) aus der sog.„c^orc>Arap1iia"des zu Biberach
1545 geb., 1616 zu Altdorf in Franken als Prof.
gest. lutherischen Streittheologen Jak. Schopper
(„.. . pudlice cle suAgestu inonsckos inenclicantes
et preclicantes taxadat et increpadat ila ut mc>-
nacln non kacile ulterius idi cornparerent").
Die Jahrgänge des „D.-A." von 1897—1904
werden fortwährend eingetauscht gegen solche
von 1905—07. Red.
Stuttgart, Buchdruckerei der Akt.-Ges. „Deutsches VolksbüUt"