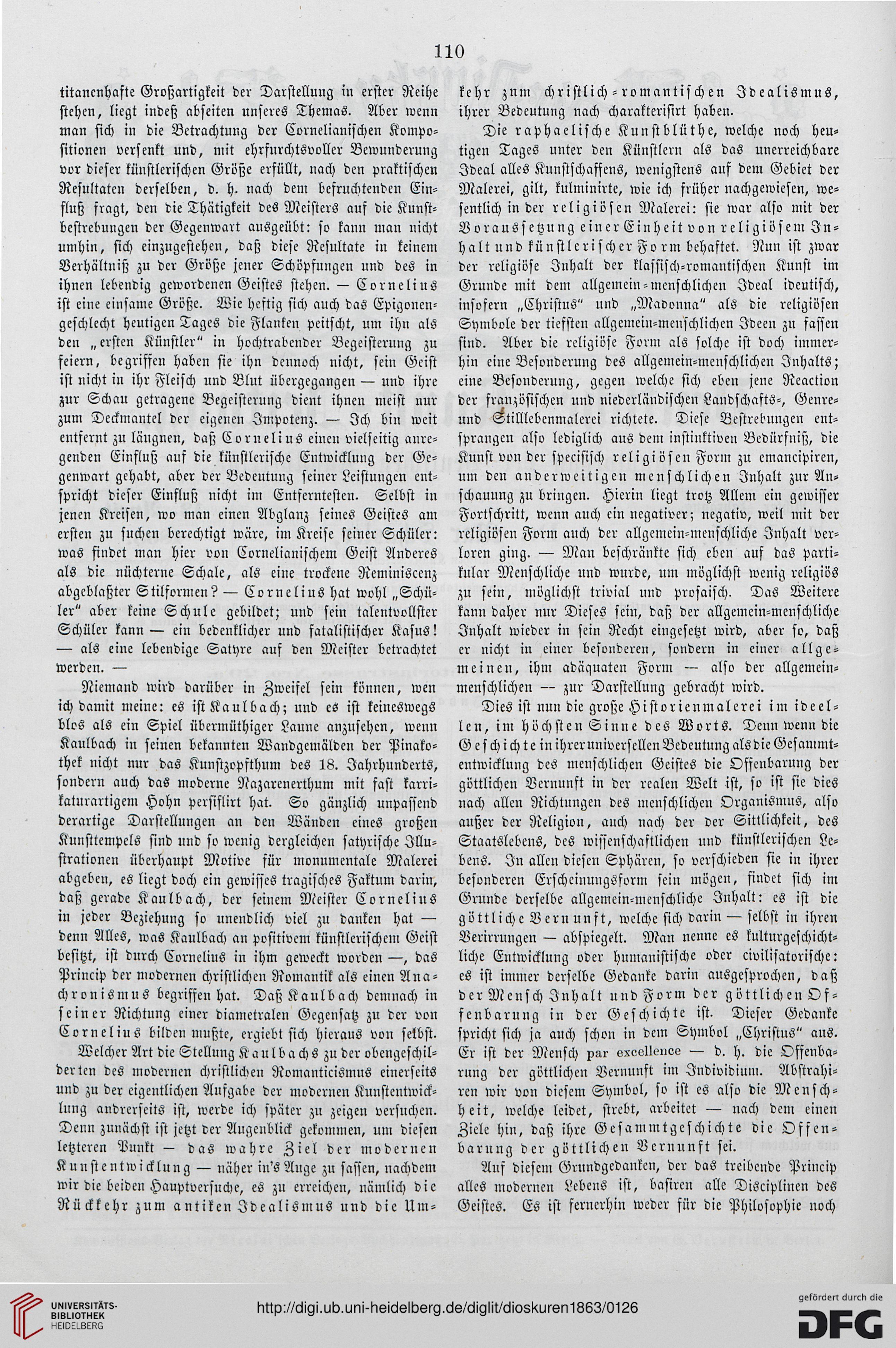110
titanenhafte Großartigkeit der Darstellung in erster Reihe
stehen, liegt indeß abfeiten unseres Themas. Aber wenn
man sich in die Betrachtung der Cornelianischen Kompo-
sitionen versenkt und, mit ehrfurchtsvoller Bewunderung
vor dieser künstlerischen Größe erfüllt, nach den praktischen
Resultaten derselben, d. h. nach dem befruchtenden Ein-
fluß fragt, den die Thätigkeit des Meisters auf die Kunst-
bestrebungen der Gegenwart ausgeübt: so kann man nicht
umhin, sich cinzugestehen, daß diese Resultate in keinem
Verhältniß zu der Größe jener Schöpfungen und des in
ihnen lebendig gewordenen Geistes stehen. — Cornelius
ist eine einsame Größe. Wie heftig sich auch das Epigouen-
geschlecht heutigen Tages die Flanken peitscht, um ihn als
den „ersten Künstler" in hochtrabender Begeisterung zu
feiern, begriffen haben sie ihn dennoch nicht, sein Geist
ist nicht in ihr Fleisch und Blut übergegangen — und ihre
zur Schau getragene Begeisterung dient ihnen meist nur
zum Deckmantel der eigenen Impotenz. — Ich bin weit
entfernt zu längnen, daß Cornelius eine» vielseitig anre-
genden Einfluß auf die künstlerische Entwicklung der Ge-
genwart gehabt, aber der Bedeutung seiner Leistungen ent-
spricht dieser Einfluß nicht im Entferntesten. Selbst in
jenen Kreisen, wo man einen Abglanz seines Geistes am
ersten zu suchen berechtigt wäre, im Kreise seiner Schüler:
was findet man hier von Cornelianischem Geist Anderes
als die nüchterne Schale, als eine trockene Reminiscenz
abgeblaßter Stilformcn? — Corneliushat wohl „Schü-
ler" aber keine Schule gebildet; und sein talentvollster
Schüler kann— ein bedenklicher und fatalistischer Kasus!
— als eine lebendige Satyre auf den Meister betrachtet
werden. —
Niemand wird darüber in Zweifel sein können, wen
ich damit meine: es ist Kaulbach; und cs ist keineswegs
blos als ein Spiel übermüthiger Laune anzusehcn, wenn
Kaulbach in seinen bekannten Wandgemälden der Pinako-
thek nicht nur das Kunstzopfthum des 18. Jahrhunderts,
sondern auch das moderne Nazarenerthum mit fast karri-
katurartigem Hohn persiflirt hat. So gänzlich unpassend
derartige Darstellungen an den Wänden eines großen
Kunsttempels sind und so wenig dergleichen satyrische Illu-
strationen überhaupt Motive für monumentale Malerei
abgeben, es liegt doch ein gewisses tragisches Faktum darin,
daß gerade Kaulbach, der seinem Meister Cornelius
in jeder Beziehung so unendlich viel zu danken hat —
denn Alles, was Kaulbach an positivem künstlerischem Geist
besitzt, ist durch Cornelius in ihm geweckt worden —, das
Princip der modernen christlichen Romantik als einen Ana-
chronismus begriffen hat. Daß Kaulbach demnach in
seiner Richtung einer diametralen Gegensatz zu der von
Cornelius bilden niußte, ergiebt sich hieraus von selbst.
Welcher Art die Stellung K a u l b a ch s zu der obcngeschil-
derten des modernen christlichen Romanticismus einerseits
und zu der eigentlichen Aufgabe der modernen Kunstentwick-
lung andrerseits ist, werde ich später zu zeigen versuchen.
Denn zunächst ist jetzt der Augenblick gekommen, um diesen
letzteren Punkt — das wahre Ziel der modernen
Kuustentwicklung — näher in'sAuge zu fassen, nachdem
wir die beiden Hauptversuche, es zu erreichen, nämlich die
Rückkehr zum antiken Idealismus und die Um-
kehr znm christlich-romantischen Idealismus,
ihrer Bedeutung nach charakterisirt haben.
Die raphaelische Kunstblüthe, welche noch heu-
tigen Tages unter den Künstlern als das unerreichbare
Ideal alles Kunstschaffens, wenigstens ans dem Gebiet der
Malerei, gilt, kulminirte, wie ich früher nachgewiesen, we-
sentlich in der religiösen Malerei: sie war also mit der
Voraussetzung einerEinheitvon religiösem In-
halt und künstlerischer Fo rm behaftet. Nun ist zwar
der religiöse Inhalt der klassisch-romantischen Kunst im
Grunde mit dem allgeinein-menschlichen Ideal ideutisch,
insofern „Christus" und „Madonna" als die religiösen
Symbole der tiefsten allgemein-menschlichen Ideen zu fassen
sind. Aber die religiöse Form als solche ist doch immer-
hin eine Besonderung des allgemein-menschlichen Inhalts;
eine Besonderung, gegen welche sich eben jene Reaction
der französischen und niederländischen Landschafts-, Genre-
und ^tilllebenmalcrci richtete. Diese Bestrebungen ent-
sprangen also lediglich aus dem instinktiven Bedürfniß, die
Kunst von der specisisch religiösen Form zu emancipiren,
um den anderweitigen menschlichen Inhalt zur An-
schauung zu bringen. Hierin liegt trotz Allem ein gewisser
Fortschritt, wenn auch ein negativer; negativ, weil mit der
religiösen Form auch der allgemein-menschliche Inhalt ver-
loren ging. — Man beschränkte sich eben auf das parti-
kular Menschliche und wurde, um möglichst wenig religiös
zu sein, möglichst trivial und prosaisch. Das Weitere
kann daher nur Dieses sein, daß der allgemein-menschliche
Inhalt wieder in sein Recht eingesetzt wird, aber so, daß
er nicht in einer besonderen, sondern in einer allge-
meinen, ihm adäquaten Form — also der allgemein-
menschlichen — zur Darstellung gebracht wird.
Dies ist nun die große Historienmalerei im ideel-
len, im höchsten Sinne des Worts. Denn wenn die
G e s ch i ch t e in ihrer universellen Bedeutung als die Gesammt-
entwicklung des menschlichen Geistes die Offenbarung der
göttlichen Vernunft in der realen Welt ist, so ist sie dies
nach allen Richtungen des menschlichen Organismus, also
außer der Religion, auch nach der der Sittlichkeit, des
Staatslebens, des wissenschaftlichen und künstlerischen Le-
bens. In allen diesen Sphären, so verschieden sie in ihrer
besonderen Erscheinungsform sein mögen, findet sich im
Grunde derselbe allgemein-menschliche Inhalt: es ist die
göttliche Vernunft, welche sich darin — selbst in ihren
Verirrungen — abspiegelt. Man nenne es kulturgeschicht-
liche Entwicklung oder humanistische oder civilisatorische:
es ist immer derselbe Gedanke darin ausgesprochen, daß
der Mensch Inhalt und Form der göttlichen Of-
fenbarung in der Geschichte ist. Dieser Gedanke
spricht sich ja auch schon in dem Symbol „Christus" aus.
Er ist der Mensch pur excellence — d. h. die Offenba-
rung der göttlichen Vernunft im Jndividium. Abstrahi-
ren wir von diesem Symbol, so ist es also die Mensch-
heit, welche leidet, strebt, arbeitet — nach dem einen
Ziele hin, daß ihre Gesammtgeschichte die Offen-
barung der göttlichen Vernunft sei.
Ans diesem Grundgedanken, der das treibende Princip
alles modernen Lebens ist, basircn alle Disciplinen des
Geistes. Es ist fernerhin weder für die Philosophie noch
titanenhafte Großartigkeit der Darstellung in erster Reihe
stehen, liegt indeß abfeiten unseres Themas. Aber wenn
man sich in die Betrachtung der Cornelianischen Kompo-
sitionen versenkt und, mit ehrfurchtsvoller Bewunderung
vor dieser künstlerischen Größe erfüllt, nach den praktischen
Resultaten derselben, d. h. nach dem befruchtenden Ein-
fluß fragt, den die Thätigkeit des Meisters auf die Kunst-
bestrebungen der Gegenwart ausgeübt: so kann man nicht
umhin, sich cinzugestehen, daß diese Resultate in keinem
Verhältniß zu der Größe jener Schöpfungen und des in
ihnen lebendig gewordenen Geistes stehen. — Cornelius
ist eine einsame Größe. Wie heftig sich auch das Epigouen-
geschlecht heutigen Tages die Flanken peitscht, um ihn als
den „ersten Künstler" in hochtrabender Begeisterung zu
feiern, begriffen haben sie ihn dennoch nicht, sein Geist
ist nicht in ihr Fleisch und Blut übergegangen — und ihre
zur Schau getragene Begeisterung dient ihnen meist nur
zum Deckmantel der eigenen Impotenz. — Ich bin weit
entfernt zu längnen, daß Cornelius eine» vielseitig anre-
genden Einfluß auf die künstlerische Entwicklung der Ge-
genwart gehabt, aber der Bedeutung seiner Leistungen ent-
spricht dieser Einfluß nicht im Entferntesten. Selbst in
jenen Kreisen, wo man einen Abglanz seines Geistes am
ersten zu suchen berechtigt wäre, im Kreise seiner Schüler:
was findet man hier von Cornelianischem Geist Anderes
als die nüchterne Schale, als eine trockene Reminiscenz
abgeblaßter Stilformcn? — Corneliushat wohl „Schü-
ler" aber keine Schule gebildet; und sein talentvollster
Schüler kann— ein bedenklicher und fatalistischer Kasus!
— als eine lebendige Satyre auf den Meister betrachtet
werden. —
Niemand wird darüber in Zweifel sein können, wen
ich damit meine: es ist Kaulbach; und cs ist keineswegs
blos als ein Spiel übermüthiger Laune anzusehcn, wenn
Kaulbach in seinen bekannten Wandgemälden der Pinako-
thek nicht nur das Kunstzopfthum des 18. Jahrhunderts,
sondern auch das moderne Nazarenerthum mit fast karri-
katurartigem Hohn persiflirt hat. So gänzlich unpassend
derartige Darstellungen an den Wänden eines großen
Kunsttempels sind und so wenig dergleichen satyrische Illu-
strationen überhaupt Motive für monumentale Malerei
abgeben, es liegt doch ein gewisses tragisches Faktum darin,
daß gerade Kaulbach, der seinem Meister Cornelius
in jeder Beziehung so unendlich viel zu danken hat —
denn Alles, was Kaulbach an positivem künstlerischem Geist
besitzt, ist durch Cornelius in ihm geweckt worden —, das
Princip der modernen christlichen Romantik als einen Ana-
chronismus begriffen hat. Daß Kaulbach demnach in
seiner Richtung einer diametralen Gegensatz zu der von
Cornelius bilden niußte, ergiebt sich hieraus von selbst.
Welcher Art die Stellung K a u l b a ch s zu der obcngeschil-
derten des modernen christlichen Romanticismus einerseits
und zu der eigentlichen Aufgabe der modernen Kunstentwick-
lung andrerseits ist, werde ich später zu zeigen versuchen.
Denn zunächst ist jetzt der Augenblick gekommen, um diesen
letzteren Punkt — das wahre Ziel der modernen
Kuustentwicklung — näher in'sAuge zu fassen, nachdem
wir die beiden Hauptversuche, es zu erreichen, nämlich die
Rückkehr zum antiken Idealismus und die Um-
kehr znm christlich-romantischen Idealismus,
ihrer Bedeutung nach charakterisirt haben.
Die raphaelische Kunstblüthe, welche noch heu-
tigen Tages unter den Künstlern als das unerreichbare
Ideal alles Kunstschaffens, wenigstens ans dem Gebiet der
Malerei, gilt, kulminirte, wie ich früher nachgewiesen, we-
sentlich in der religiösen Malerei: sie war also mit der
Voraussetzung einerEinheitvon religiösem In-
halt und künstlerischer Fo rm behaftet. Nun ist zwar
der religiöse Inhalt der klassisch-romantischen Kunst im
Grunde mit dem allgeinein-menschlichen Ideal ideutisch,
insofern „Christus" und „Madonna" als die religiösen
Symbole der tiefsten allgemein-menschlichen Ideen zu fassen
sind. Aber die religiöse Form als solche ist doch immer-
hin eine Besonderung des allgemein-menschlichen Inhalts;
eine Besonderung, gegen welche sich eben jene Reaction
der französischen und niederländischen Landschafts-, Genre-
und ^tilllebenmalcrci richtete. Diese Bestrebungen ent-
sprangen also lediglich aus dem instinktiven Bedürfniß, die
Kunst von der specisisch religiösen Form zu emancipiren,
um den anderweitigen menschlichen Inhalt zur An-
schauung zu bringen. Hierin liegt trotz Allem ein gewisser
Fortschritt, wenn auch ein negativer; negativ, weil mit der
religiösen Form auch der allgemein-menschliche Inhalt ver-
loren ging. — Man beschränkte sich eben auf das parti-
kular Menschliche und wurde, um möglichst wenig religiös
zu sein, möglichst trivial und prosaisch. Das Weitere
kann daher nur Dieses sein, daß der allgemein-menschliche
Inhalt wieder in sein Recht eingesetzt wird, aber so, daß
er nicht in einer besonderen, sondern in einer allge-
meinen, ihm adäquaten Form — also der allgemein-
menschlichen — zur Darstellung gebracht wird.
Dies ist nun die große Historienmalerei im ideel-
len, im höchsten Sinne des Worts. Denn wenn die
G e s ch i ch t e in ihrer universellen Bedeutung als die Gesammt-
entwicklung des menschlichen Geistes die Offenbarung der
göttlichen Vernunft in der realen Welt ist, so ist sie dies
nach allen Richtungen des menschlichen Organismus, also
außer der Religion, auch nach der der Sittlichkeit, des
Staatslebens, des wissenschaftlichen und künstlerischen Le-
bens. In allen diesen Sphären, so verschieden sie in ihrer
besonderen Erscheinungsform sein mögen, findet sich im
Grunde derselbe allgemein-menschliche Inhalt: es ist die
göttliche Vernunft, welche sich darin — selbst in ihren
Verirrungen — abspiegelt. Man nenne es kulturgeschicht-
liche Entwicklung oder humanistische oder civilisatorische:
es ist immer derselbe Gedanke darin ausgesprochen, daß
der Mensch Inhalt und Form der göttlichen Of-
fenbarung in der Geschichte ist. Dieser Gedanke
spricht sich ja auch schon in dem Symbol „Christus" aus.
Er ist der Mensch pur excellence — d. h. die Offenba-
rung der göttlichen Vernunft im Jndividium. Abstrahi-
ren wir von diesem Symbol, so ist es also die Mensch-
heit, welche leidet, strebt, arbeitet — nach dem einen
Ziele hin, daß ihre Gesammtgeschichte die Offen-
barung der göttlichen Vernunft sei.
Ans diesem Grundgedanken, der das treibende Princip
alles modernen Lebens ist, basircn alle Disciplinen des
Geistes. Es ist fernerhin weder für die Philosophie noch