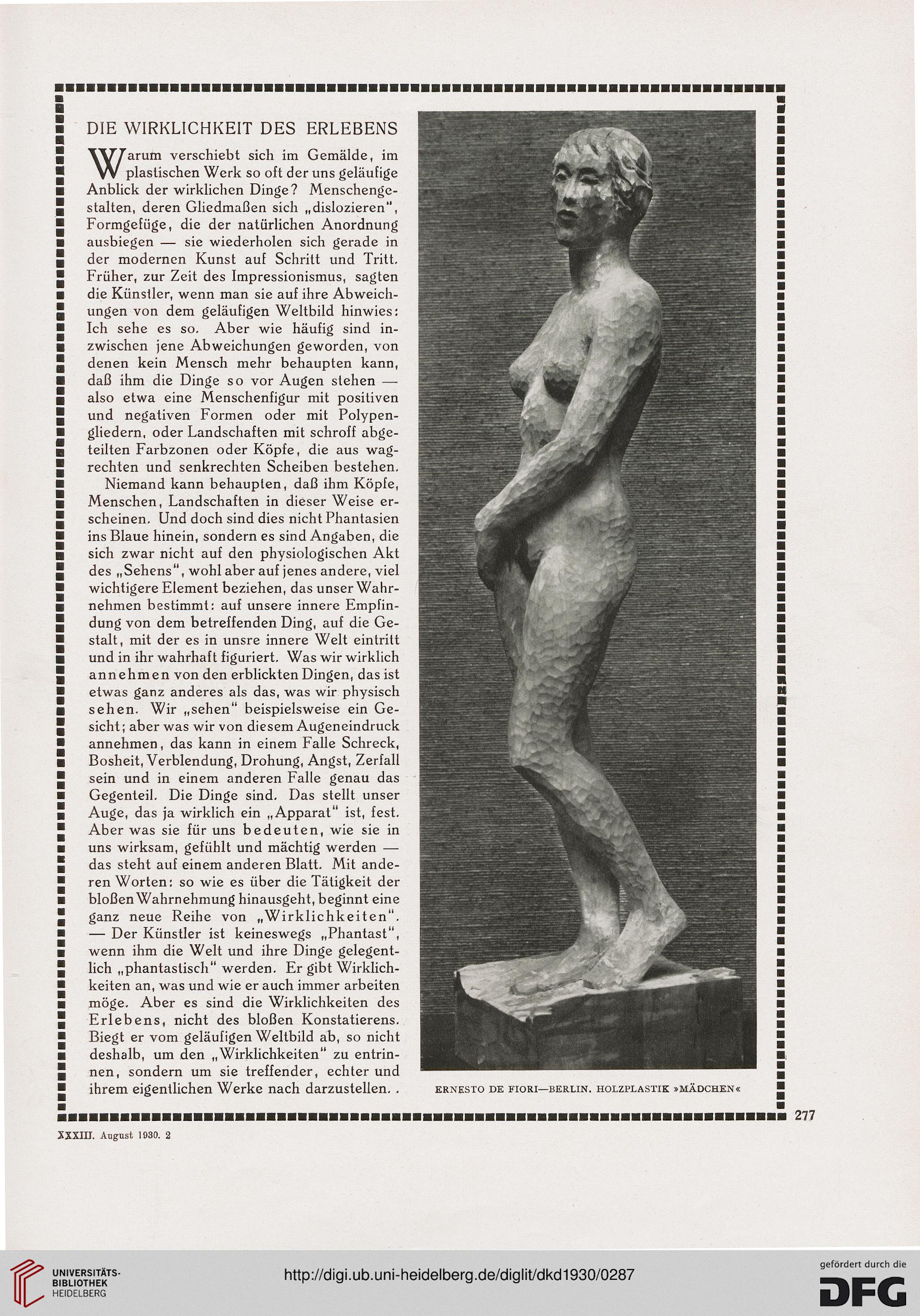DIE WIRKLICHKEIT DES ERLEBENS
Warum verschiebt sich im Gemälde, im
plastischen Werk so oft der uns geläufige
Anblick der wirklichen Dinge? Menschenge-
stalten, deren Gliedmaßen sich „dislozieren",
Formgefüge, die der natürlichen Anordnung
ausbiegen — sie wiederholen sich gerade in
der modernen Kunst auf Schritt und Tritt.
Früher, zur Zeit des Impressionismus, sagten
die Künstler, wenn man sie auf ihre Abweich-
ungen von dem geläufigen Weltbild hinwies:
Ich sehe es so. Aber wie häufig sind in-
zwischen jene Abweichungen geworden, von
denen kein Mensch mehr behaupten kann,
daß ihm die Dinge so vor Augen stehen —
also etwa eine Menschenfigur mit positiven
und negativen Formen oder mit Polypen-
gliedern, oder Landschaften mit schroff abge-
teilten Farbzonen oder Köpfe, die aus wag-
rechten und senkrechten Scheiben bestehen.
Niemand kann behaupten, daß ihm Köpfe,
Menschen, Landschaften in dieser Weise er-
scheinen. Und doch sind dies nicht Phantasien
ins Blaue hinein, sondern es sind Angaben, die
sich zwar nicht auf den physiologischen Akt
des „Sehens", wohl aber auf jenes andere, viel
wichtigere Element beziehen, das unser Wahr-
nehmen bestimmt: auf unsere innere Empfin-
dung von dem betreffenden Ding, auf die Ge-
stalt, mit der es in unsre innere Welt eintritt
und in ihr wahrhaft figuriert. Was wir wirklich
annehmen von den erblickten Dingen, das ist
etwas ganz anderes als das, was wir physisch
sehen. Wir „sehen" beispielsweise ein Ge-
sicht; aber was wir von diesem Augeneindruck
annehmen, das kann in einem Falle Schreck,
Bosheit, Verblendung, Drohung, Angst, Zerfall
sein und in einem anderen Falle genau das
Gegenteil. Die Dinge sind. Das stellt unser
Auge, das ja wirklich ein „Apparat" ist, fest.
Aber was sie für uns bedeuten, wie sie in
uns wirksam, gefühlt und mächtig werden —
das steht auf einem anderen Blatt. Mit ande-
ren Worten: so wie es über die Tätigkeit der
bloßen Wahrnehmung hinausgeht, beginnt eine
ganz neue Reihe von „Wirklichkeiten".
— Der Künstler ist keineswegs „Phantast",
wenn ihm die Welt und ihre Dinge gelegent-
lich „phantastisch" werden. Er gibt Wirklich-
keiten an, was und wie er auch immer arbeiten
möge. Aber es sind die Wirklichkeiten des
Erlebens, nicht des bloßen Konstatierens.
Biegt er vom geläufigen Weltbild ab, so nicht
deshalb, um den „Wirklichkeiten" zu entrin-
nen, sondern um sie treffender, echter und
ihrem eigentlichen Werke nach darzustellen. .
ERNESTO DE FIORI—BERLIN. HOLZPLASTIK »MÄDCHEN«
XXXIÜ. August 1930. 2
Warum verschiebt sich im Gemälde, im
plastischen Werk so oft der uns geläufige
Anblick der wirklichen Dinge? Menschenge-
stalten, deren Gliedmaßen sich „dislozieren",
Formgefüge, die der natürlichen Anordnung
ausbiegen — sie wiederholen sich gerade in
der modernen Kunst auf Schritt und Tritt.
Früher, zur Zeit des Impressionismus, sagten
die Künstler, wenn man sie auf ihre Abweich-
ungen von dem geläufigen Weltbild hinwies:
Ich sehe es so. Aber wie häufig sind in-
zwischen jene Abweichungen geworden, von
denen kein Mensch mehr behaupten kann,
daß ihm die Dinge so vor Augen stehen —
also etwa eine Menschenfigur mit positiven
und negativen Formen oder mit Polypen-
gliedern, oder Landschaften mit schroff abge-
teilten Farbzonen oder Köpfe, die aus wag-
rechten und senkrechten Scheiben bestehen.
Niemand kann behaupten, daß ihm Köpfe,
Menschen, Landschaften in dieser Weise er-
scheinen. Und doch sind dies nicht Phantasien
ins Blaue hinein, sondern es sind Angaben, die
sich zwar nicht auf den physiologischen Akt
des „Sehens", wohl aber auf jenes andere, viel
wichtigere Element beziehen, das unser Wahr-
nehmen bestimmt: auf unsere innere Empfin-
dung von dem betreffenden Ding, auf die Ge-
stalt, mit der es in unsre innere Welt eintritt
und in ihr wahrhaft figuriert. Was wir wirklich
annehmen von den erblickten Dingen, das ist
etwas ganz anderes als das, was wir physisch
sehen. Wir „sehen" beispielsweise ein Ge-
sicht; aber was wir von diesem Augeneindruck
annehmen, das kann in einem Falle Schreck,
Bosheit, Verblendung, Drohung, Angst, Zerfall
sein und in einem anderen Falle genau das
Gegenteil. Die Dinge sind. Das stellt unser
Auge, das ja wirklich ein „Apparat" ist, fest.
Aber was sie für uns bedeuten, wie sie in
uns wirksam, gefühlt und mächtig werden —
das steht auf einem anderen Blatt. Mit ande-
ren Worten: so wie es über die Tätigkeit der
bloßen Wahrnehmung hinausgeht, beginnt eine
ganz neue Reihe von „Wirklichkeiten".
— Der Künstler ist keineswegs „Phantast",
wenn ihm die Welt und ihre Dinge gelegent-
lich „phantastisch" werden. Er gibt Wirklich-
keiten an, was und wie er auch immer arbeiten
möge. Aber es sind die Wirklichkeiten des
Erlebens, nicht des bloßen Konstatierens.
Biegt er vom geläufigen Weltbild ab, so nicht
deshalb, um den „Wirklichkeiten" zu entrin-
nen, sondern um sie treffender, echter und
ihrem eigentlichen Werke nach darzustellen. .
ERNESTO DE FIORI—BERLIN. HOLZPLASTIK »MÄDCHEN«
XXXIÜ. August 1930. 2