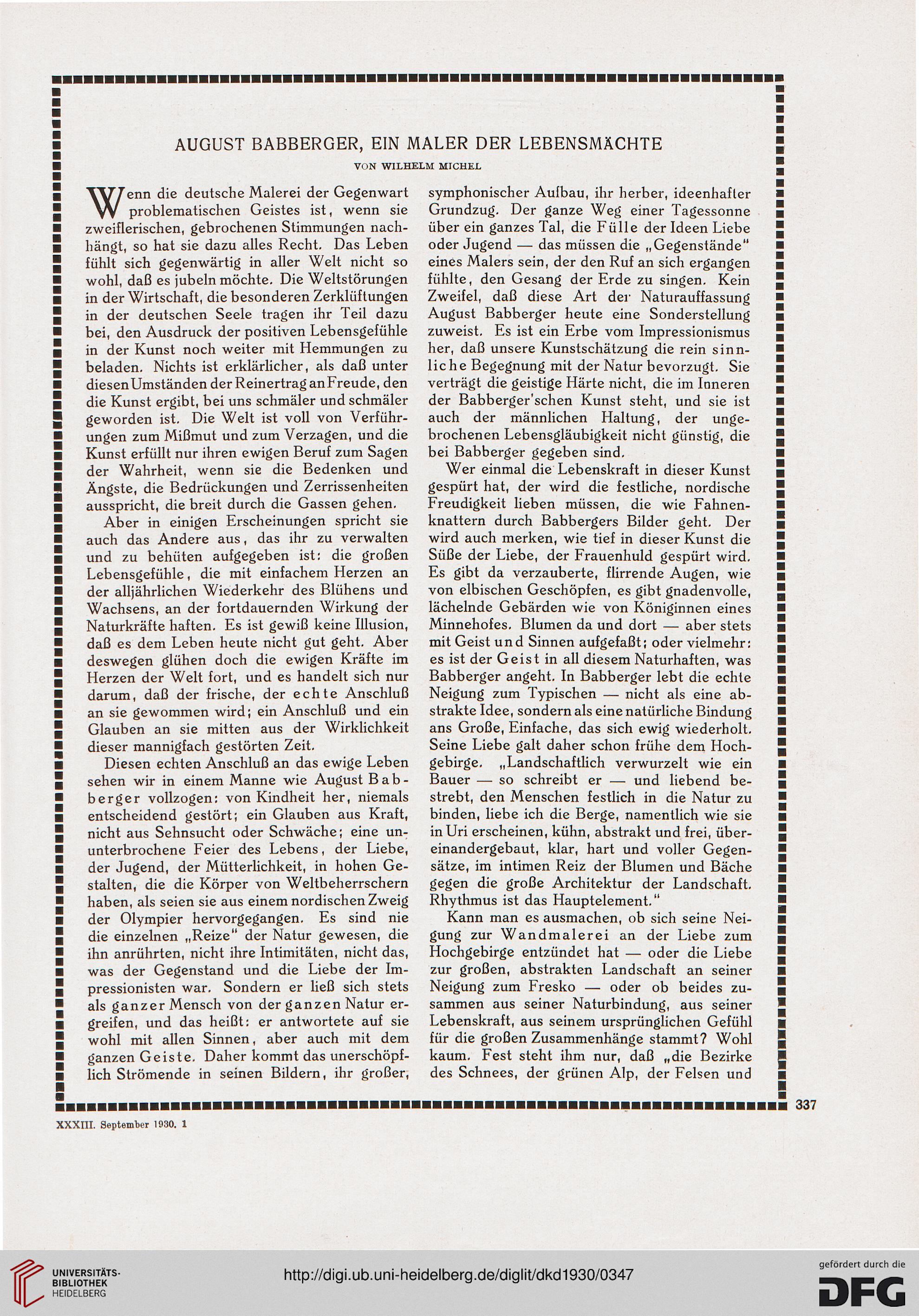AUGUST BABBERGER, EIN MALER DER LEBENSMÄCHTE
VON WILHELM MICHEL
Wenn die deutsche Malerei der Gegenwart
problematischen Geistes ist, wenn sie
zweiflerischen, gebrochenen Stimmungen nach-
hängt, so hat sie dazu alles Recht. Das Leben
fühlt sich gegenwärtig in aller Welt nicht so
wohl, daß es jubeln möchte. Die Weltstörungen
in der Wirtschaft, die besonderen Zerklüftungen
in der deutschen Seele tragen ihr Teil dazu
bei, den Ausdruck der positiven Lebensgefühle
in der Kunst noch weiter mit Hemmungen zu
beladen. Nichts ist erklärlicher, als daß unter
diesen Umständen der Reinertrag an Freude, den
die Kunst ergibt, bei uns schmäler und schmäler
geworden ist. Die Welt ist voll von Verführ-
ungen zum Mißmut und zum Verzagen, und die
Kunst erfüllt nur ihren ewigen Beruf zum Sagen
der Wahrheit, wenn sie die Bedenken und
Ängste, die Bedrückungen und Zerrissenheiten
ausspricht, die breit durch die Gassen gehen.
Aber in einigen Erscheinungen spricht sie
auch das Andere aus, das ihr zu verwalten
und zu behüten aufgegeben ist: die großen
Lebensgefühle, die mit einfachem Herzen an
der alljährlichen Wiederkehr des Blühens und
Wachsens, an der fortdauernden Wirkung der
Naturkräfte haften. Es ist gewiß keine Illusion,
daß es dem Leben heute nicht gut geht. Aber
deswegen glühen doch die ewigen Kräfte im
Herzen der Welt fort, und es handelt sich nur
darum, daß der frische, der echte Anschluß
an sie gewommen wird; ein Anschluß und ein
Glauben an sie mitten aus der Wirklichkeit
dieser mannigfach gestörten Zeit.
Diesen echten Anschluß an das ewige Leben
sehen wir in einem Manne wie August B ab-
berger vollzogen: von Kindheit her, niemals
entscheidend gestört; ein Glauben aus Kraft,
nicht aus Sehnsucht oder Schwäche; eine un-
unterbrochene Feier des Lebens, der Liebe,
der Jugend, der Mütterlichkeit, in hohen Ge-
stalten, die die Körper von Weltbeherrschern
haben, als seien sie aus einem nordischen Zweig
der Olympier hervorgegangen. Es sind nie
die einzelnen „Reize" der Natur gewesen, die
ihn anrührten, nicht ihre Intimitäten, nicht das,
was der Gegenstand und die Liebe der Im-
pressionisten war. Sondern er ließ sich stets
als ganzer Mensch von der ganzen Natur er-
greifen, und das heißt: er antwortete auf sie
wohl mit allen Sinnen, aber auch mit dem
ganzen Geiste. Daher kommt das unerschöpf-
lich Strömende in seinen Bildern, ihr großer,
symphonischer Aufbau, ihr herber, ideenhafter
Grundzug. Der ganze Weg einer Tagessonne
über ein ganzes Tal, die Fülle der Ideen Liebe
oder Jugend — das müssen die „Gegenstände"
eines Malers sein, der den Ruf an sich ergangen
fühlte, den Gesang der Erde zu singen. Kein
Zweifel, daß diese Art der Naturauffassung
August Babberger heute eine Sonderstellung
zuweist. Es ist ein Erbe vom Impressionismus
her, daß unsere Kunstschätzung die rein sinn-
liche Begegnung mit der Natur bevorzugt. Sie
verträgt die geistige Härte nicht, die im Inneren
der Babberger'schen Kunst steht, und sie ist
auch der männlichen Haltung, der unge-
brochenen Lebensgläubigkeit nicht günstig, die
bei Babberger gegeben sind.
Wer einmal die Lebenskraft in dieser Kunst
gespürt hat, der wird die festliche, nordische
Freudigkeit lieben müssen, die wie Fahnen-
knattern durch Babbergers Bilder geht. Der
wird auch merken, wie tief in dieser Kunst die
Süße der Liebe, der Frauenhuld gespürt wird.
Es gibt da verzauberte, flirrende Augen, wie
von elbischen Geschöpfen, es gibt gnadenvolle,
lächelnde Gebärden wie von Königinnen eines
Minnehofes. Blumen da und dort — aber stets
mit Geist und Sinnen aufgefaßt; oder vielmehr:
es ist der Geist in all diesem Naturhaften, was
Babberger angeht. In Babberger lebt die echte
Neigung zum Typischen — nicht als eine ab-
strakte Idee, sondern als eine natürliche Bindung
ans Große, Einfache, das sich ewig wiederholt.
Seine Liebe galt daher schon frühe dem Hoch-
gebirge. „Landschaftlich verwurzelt wie ein
Bauer — so schreibt er — und liebend be-
strebt, den Menschen festlich in die Natur zu
binden, liebe ich die Berge, namentlich wie sie
inUri erscheinen, kühn, abstrakt und frei, über-
einandergebaut, klar, hart und voller Gegen-
sätze, im intimen Reiz der Blumen und Bäche
gegen die große Architektur der Landschaft.
Rhythmus ist das Hauptelement."
Kann man es ausmachen, ob sich seine Nei-
gung zur Wandmalerei an der Liebe zum
Hochgebirge entzündet hat — oder die Liebe
zur großen, abstrakten Landschaft an seiner
Neigung zum Fresko — oder ob beides zu-
sammen aus seiner Naturbindung, aus seiner
Lebenskraft, aus seinem ursprünglichen Gefühl
für die großen Zusammenhänge stammt? Wohl
kaum. Fest steht ihm nur, daß „die Bezirke
des Schnees, der grünen Alp, der Felsen und
XXXIII. September 1930. 1
VON WILHELM MICHEL
Wenn die deutsche Malerei der Gegenwart
problematischen Geistes ist, wenn sie
zweiflerischen, gebrochenen Stimmungen nach-
hängt, so hat sie dazu alles Recht. Das Leben
fühlt sich gegenwärtig in aller Welt nicht so
wohl, daß es jubeln möchte. Die Weltstörungen
in der Wirtschaft, die besonderen Zerklüftungen
in der deutschen Seele tragen ihr Teil dazu
bei, den Ausdruck der positiven Lebensgefühle
in der Kunst noch weiter mit Hemmungen zu
beladen. Nichts ist erklärlicher, als daß unter
diesen Umständen der Reinertrag an Freude, den
die Kunst ergibt, bei uns schmäler und schmäler
geworden ist. Die Welt ist voll von Verführ-
ungen zum Mißmut und zum Verzagen, und die
Kunst erfüllt nur ihren ewigen Beruf zum Sagen
der Wahrheit, wenn sie die Bedenken und
Ängste, die Bedrückungen und Zerrissenheiten
ausspricht, die breit durch die Gassen gehen.
Aber in einigen Erscheinungen spricht sie
auch das Andere aus, das ihr zu verwalten
und zu behüten aufgegeben ist: die großen
Lebensgefühle, die mit einfachem Herzen an
der alljährlichen Wiederkehr des Blühens und
Wachsens, an der fortdauernden Wirkung der
Naturkräfte haften. Es ist gewiß keine Illusion,
daß es dem Leben heute nicht gut geht. Aber
deswegen glühen doch die ewigen Kräfte im
Herzen der Welt fort, und es handelt sich nur
darum, daß der frische, der echte Anschluß
an sie gewommen wird; ein Anschluß und ein
Glauben an sie mitten aus der Wirklichkeit
dieser mannigfach gestörten Zeit.
Diesen echten Anschluß an das ewige Leben
sehen wir in einem Manne wie August B ab-
berger vollzogen: von Kindheit her, niemals
entscheidend gestört; ein Glauben aus Kraft,
nicht aus Sehnsucht oder Schwäche; eine un-
unterbrochene Feier des Lebens, der Liebe,
der Jugend, der Mütterlichkeit, in hohen Ge-
stalten, die die Körper von Weltbeherrschern
haben, als seien sie aus einem nordischen Zweig
der Olympier hervorgegangen. Es sind nie
die einzelnen „Reize" der Natur gewesen, die
ihn anrührten, nicht ihre Intimitäten, nicht das,
was der Gegenstand und die Liebe der Im-
pressionisten war. Sondern er ließ sich stets
als ganzer Mensch von der ganzen Natur er-
greifen, und das heißt: er antwortete auf sie
wohl mit allen Sinnen, aber auch mit dem
ganzen Geiste. Daher kommt das unerschöpf-
lich Strömende in seinen Bildern, ihr großer,
symphonischer Aufbau, ihr herber, ideenhafter
Grundzug. Der ganze Weg einer Tagessonne
über ein ganzes Tal, die Fülle der Ideen Liebe
oder Jugend — das müssen die „Gegenstände"
eines Malers sein, der den Ruf an sich ergangen
fühlte, den Gesang der Erde zu singen. Kein
Zweifel, daß diese Art der Naturauffassung
August Babberger heute eine Sonderstellung
zuweist. Es ist ein Erbe vom Impressionismus
her, daß unsere Kunstschätzung die rein sinn-
liche Begegnung mit der Natur bevorzugt. Sie
verträgt die geistige Härte nicht, die im Inneren
der Babberger'schen Kunst steht, und sie ist
auch der männlichen Haltung, der unge-
brochenen Lebensgläubigkeit nicht günstig, die
bei Babberger gegeben sind.
Wer einmal die Lebenskraft in dieser Kunst
gespürt hat, der wird die festliche, nordische
Freudigkeit lieben müssen, die wie Fahnen-
knattern durch Babbergers Bilder geht. Der
wird auch merken, wie tief in dieser Kunst die
Süße der Liebe, der Frauenhuld gespürt wird.
Es gibt da verzauberte, flirrende Augen, wie
von elbischen Geschöpfen, es gibt gnadenvolle,
lächelnde Gebärden wie von Königinnen eines
Minnehofes. Blumen da und dort — aber stets
mit Geist und Sinnen aufgefaßt; oder vielmehr:
es ist der Geist in all diesem Naturhaften, was
Babberger angeht. In Babberger lebt die echte
Neigung zum Typischen — nicht als eine ab-
strakte Idee, sondern als eine natürliche Bindung
ans Große, Einfache, das sich ewig wiederholt.
Seine Liebe galt daher schon frühe dem Hoch-
gebirge. „Landschaftlich verwurzelt wie ein
Bauer — so schreibt er — und liebend be-
strebt, den Menschen festlich in die Natur zu
binden, liebe ich die Berge, namentlich wie sie
inUri erscheinen, kühn, abstrakt und frei, über-
einandergebaut, klar, hart und voller Gegen-
sätze, im intimen Reiz der Blumen und Bäche
gegen die große Architektur der Landschaft.
Rhythmus ist das Hauptelement."
Kann man es ausmachen, ob sich seine Nei-
gung zur Wandmalerei an der Liebe zum
Hochgebirge entzündet hat — oder die Liebe
zur großen, abstrakten Landschaft an seiner
Neigung zum Fresko — oder ob beides zu-
sammen aus seiner Naturbindung, aus seiner
Lebenskraft, aus seinem ursprünglichen Gefühl
für die großen Zusammenhänge stammt? Wohl
kaum. Fest steht ihm nur, daß „die Bezirke
des Schnees, der grünen Alp, der Felsen und
XXXIII. September 1930. 1