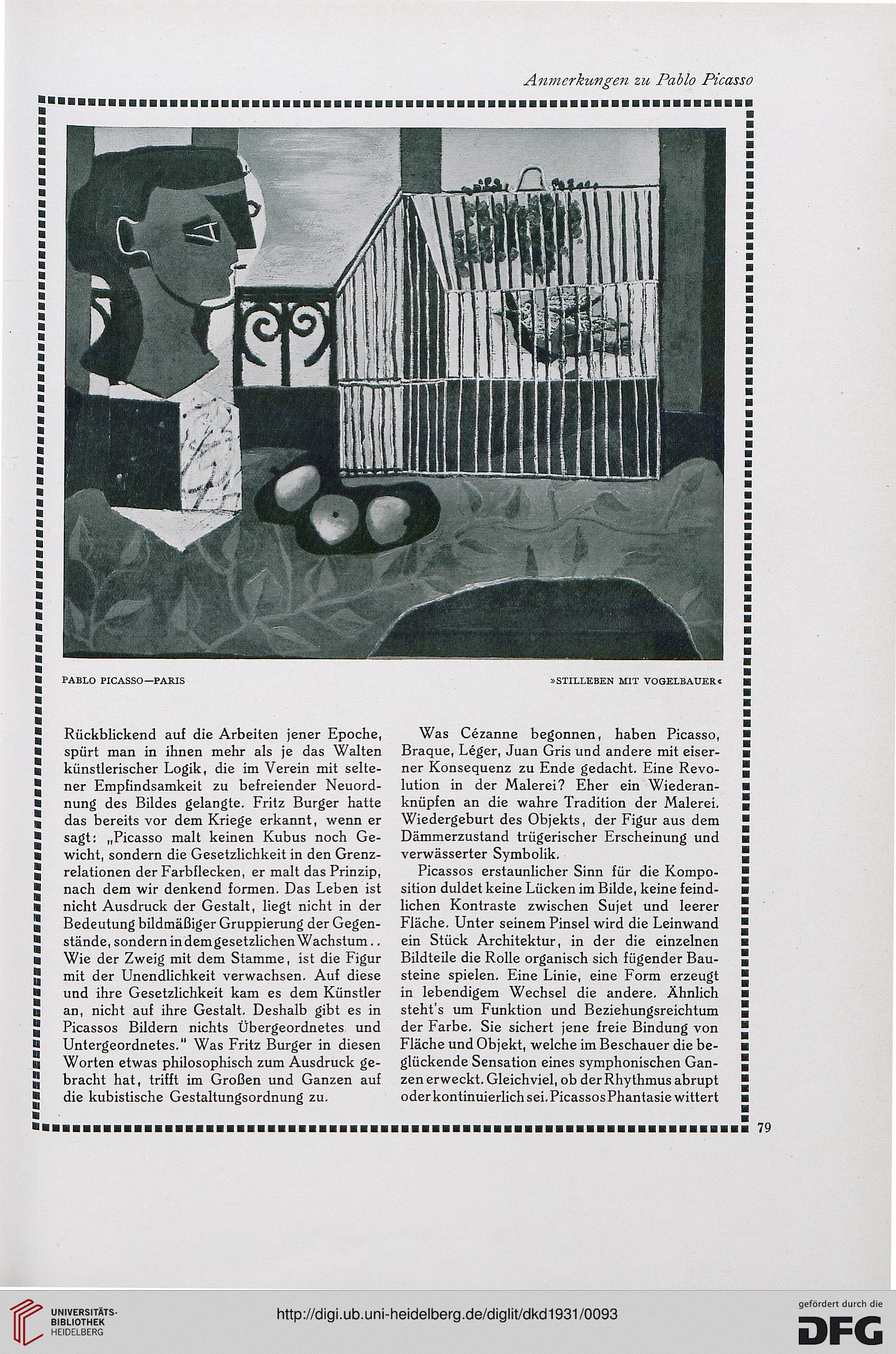Anmerkungen zu Pablo Picasso
Rückblickend auf die Arbeiten jener Epoche,
spürt man in ihnen mehr als je das Walten
künstlerischer Logik, die im Verein mit selte-
ner Empfindsamkeit zu befreiender Neuord-
nung des Bildes gelangte. Fritz Burger hatte
das bereits vor dem Kriege erkannt, wenn er
sagt: „Picasso malt keinen Kubus noch Ge-
wicht, sondern die Gesetzlichkeit in den Grenz-
relationen der Farbflecken, er malt das Prinzip,
nach dem wir denkend formen. Das Leben ist
nicht Ausdruck der Gestalt, liegt nicht in der
Bedeutung bildmäßiger Gruppierung der Gegen-
stände, sondern indemgesetzlichen Wachstum ..
Wie der Zweig mit dem Stamme, ist die Figur
mit der Unendlichkeit verwachsen. Auf diese
und ihre Gesetzlichkeit kam es dem Künstler
an, nicht auf ihre Gestalt. Deshalb gibt es in
Picassos Bildern nichts Übergeordnetes und
Untergeordnetes." Was Fritz Burger in diesen
Worten etwas philosophisch zum Ausdruck ge-
bracht hat, trifft im Großen und Ganzen auf
die kubistische Gestaltungsordnung zu.
Was Cezanne begonnen, haben Picasso,
Braque, Leger, Juan Gris und andere mit eiser-
ner Konsequenz zu Ende gedacht. Eine Revo-
lution in der Malerei? Eher ein Wiederan-
knüpfen an die wahre Tradition der Malerei.
Wiedergeburt des Objekts, der Figur aus dem
Dämmerzustand trügerischer Erscheinung und
verwässerter Symbolik.
Picassos erstaunlicher Sinn für die Kompo-
sition duldet keine Lücken im Bilde, keine feind-
lichen Kontraste zwischen Sujet und leerer
Fläche. Unter seinem Pinsel wird die Leinwand
ein Stück Architektur, in der die einzelnen
Bildteile die Rolle organisch sich fügender Bau-
steine spielen. Eine Linie, eine Form erzeugt
in lebendigem Wechsel die andere. Ähnlich
steht's um Funktion und Beziehungsreichtum
der Farbe. Sie sichert jene freie Bindung von
Fläche und Objekt, welche im Beschauer die be-
glückende Sensation eines symphonischen Gan-
zen erweckt. Gleichviel, ob der Rhythmus abrupt
oder kontinuierlich sei. Picassos Phantasie wittert
Rückblickend auf die Arbeiten jener Epoche,
spürt man in ihnen mehr als je das Walten
künstlerischer Logik, die im Verein mit selte-
ner Empfindsamkeit zu befreiender Neuord-
nung des Bildes gelangte. Fritz Burger hatte
das bereits vor dem Kriege erkannt, wenn er
sagt: „Picasso malt keinen Kubus noch Ge-
wicht, sondern die Gesetzlichkeit in den Grenz-
relationen der Farbflecken, er malt das Prinzip,
nach dem wir denkend formen. Das Leben ist
nicht Ausdruck der Gestalt, liegt nicht in der
Bedeutung bildmäßiger Gruppierung der Gegen-
stände, sondern indemgesetzlichen Wachstum ..
Wie der Zweig mit dem Stamme, ist die Figur
mit der Unendlichkeit verwachsen. Auf diese
und ihre Gesetzlichkeit kam es dem Künstler
an, nicht auf ihre Gestalt. Deshalb gibt es in
Picassos Bildern nichts Übergeordnetes und
Untergeordnetes." Was Fritz Burger in diesen
Worten etwas philosophisch zum Ausdruck ge-
bracht hat, trifft im Großen und Ganzen auf
die kubistische Gestaltungsordnung zu.
Was Cezanne begonnen, haben Picasso,
Braque, Leger, Juan Gris und andere mit eiser-
ner Konsequenz zu Ende gedacht. Eine Revo-
lution in der Malerei? Eher ein Wiederan-
knüpfen an die wahre Tradition der Malerei.
Wiedergeburt des Objekts, der Figur aus dem
Dämmerzustand trügerischer Erscheinung und
verwässerter Symbolik.
Picassos erstaunlicher Sinn für die Kompo-
sition duldet keine Lücken im Bilde, keine feind-
lichen Kontraste zwischen Sujet und leerer
Fläche. Unter seinem Pinsel wird die Leinwand
ein Stück Architektur, in der die einzelnen
Bildteile die Rolle organisch sich fügender Bau-
steine spielen. Eine Linie, eine Form erzeugt
in lebendigem Wechsel die andere. Ähnlich
steht's um Funktion und Beziehungsreichtum
der Farbe. Sie sichert jene freie Bindung von
Fläche und Objekt, welche im Beschauer die be-
glückende Sensation eines symphonischen Gan-
zen erweckt. Gleichviel, ob der Rhythmus abrupt
oder kontinuierlich sei. Picassos Phantasie wittert