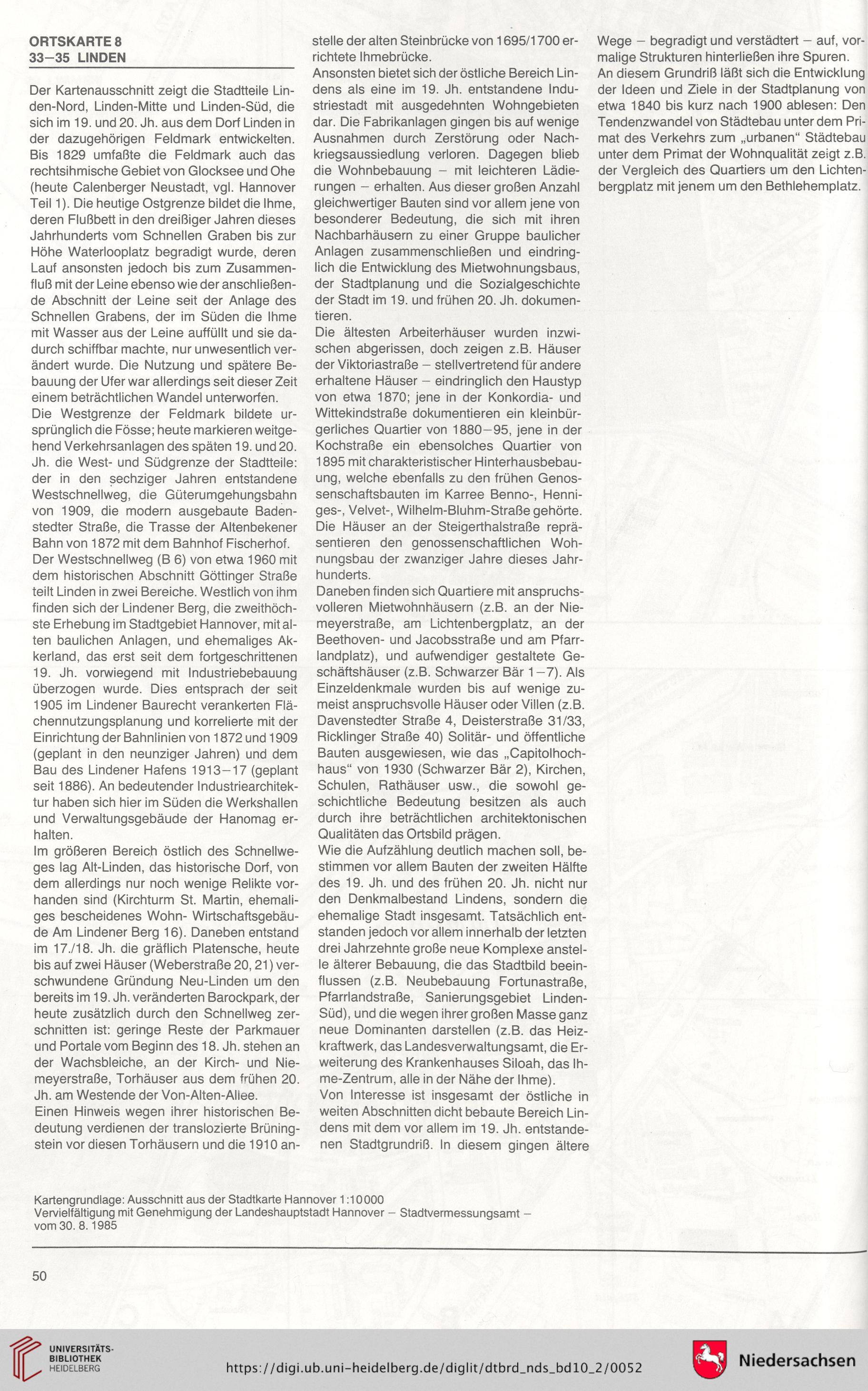ORTSKARTE 8
33-35 LINDEN
Der Kartenausschnitt zeigt die Stadtteile Lin-
den-Nord, Linden-Mitte und Linden-Süd, die
sich im 19. und 20. Jh. aus dem Dorf Linden in
der dazugehörigen Feldmark entwickelten.
Bis 1829 umfaßte die Feldmark auch das
rechtsihrnische Gebiet von Glocksee und Ohe
(heute Calenberger Neustadt, vgl. Hannover
Teil 1). Die heutige Ostgrenze bildet die Ihme,
deren Flußbett in den dreißiger Jahren dieses
Jahrhunderts vom Schnellen Graben bis zur
Höhe Waterlooplatz begradigt wurde, deren
Lauf ansonsten jedoch bis zum Zusammen-
fluß mit der Leine ebenso wie der anschließen-
de Abschnitt der Leine seit der Anlage des
Schnellen Grabens, der im Süden die Ihme
mit Wasser aus der Leine auffüllt und sie da-
durch schiffbar machte, nur unwesentlich ver-
ändert wurde. Die Nutzung und spätere Be-
bauung der Ufer war allerdings seit dieser Zeit
einem beträchtlichen Wandel unterworfen.
Die Westgrenze der Feldmark bildete ur-
sprünglich die Fösse; heute markieren weitge-
hend Verkehrsanlagen des späten 19. und 20.
Jh. die West- und Südgrenze der Stadtteile:
der in den sechziger Jahren entstandene
Westschnellweg, die Güterumgehungsbahn
von 1909, die modern ausgebaute Baden-
stedter Straße, die Trasse der Altenbekener
Bahn von 1872 mit dem Bahnhof Fischerhof.
Der Westschnellweg (B 6) von etwa 1960 mit
dem historischen Abschnitt Göttinger Straße
teilt Linden in zwei Bereiche. Westlich von ihm
finden sich der Lindener Berg, die zweithöch-
ste Erhebung im Stadtgebiet Hannover, mit al-
ten baulichen Anlagen, und ehemaliges Ak-
kerland, das erst seit dem fortgeschrittenen
19. Jh. vorwiegend mit Industriebebauung
überzogen wurde. Dies entsprach der seit
1905 im Lindener Baurecht verankerten Flä-
chennutzungsplanung und korrelierte mit der
Einrichtung der Bahnlinien von 1872 und 1909
(geplant in den neunziger Jahren) und dem
Bau des Lindener Hafens 1913-17 (geplant
seit 1886). An bedeutender Industriearchitek-
tur haben sich hier im Süden die Werkshallen
und Verwaltungsgebäude der Hanomag er-
halten.
Im größeren Bereich östlich des Schnellwe-
ges lag Alt-Linden, das historische Dorf, von
dem allerdings nur noch wenige Relikte vor-
handen sind (Kirchturm St. Martin, ehemali-
ges bescheidenes Wohn- Wirtschaftsgebäu-
de Am Lindener Berg 16). Daneben entstand
im 17./18. Jh. die gräflich Platensche, heute
bis auf zwei Häuser (Weberstraße 20,21) ver-
schwundene Gründung Neu-Linden um den
bereits im 19. Jh. veränderten Barockpark, der
heute zusätzlich durch den Schnellweg zer-
schnitten ist: geringe Reste der Parkmauer
und Portale vom Beginn des 18. Jh. stehen an
der Wachsbleiche, an der Kirch- und Nie-
meyerstraße, Torhäuser aus dem frühen 20.
Jh. am Westende der Von-Alten-Aliee.
Einen Hinweis wegen ihrer historischen Be-
deutung verdienen der translozierte Brüning-
stein vor diesen Torhäusern und die 1910 an-
stelle der alten Steinbrücke von 1695/1700 er-
richtete Ihmebrücke.
Ansonsten bietet sich der östliche Bereich Lin-
dens als eine im 19. Jh. entstandene Indu-
striestadt mit ausgedehnten Wohngebieten
dar. Die Fabrikanlagen gingen bis auf wenige
Ausnahmen durch Zerstörung oder Nach-
kriegsaussiedlung verloren. Dagegen blieb
die Wohnbebauung - mit leichteren Lädie-
rungen - erhalten. Aus dieser großen Anzahl
gleichwertiger Bauten sind vor allem jene von
besonderer Bedeutung, die sich mit ihren
Nachbarhäusern zu einer Gruppe baulicher
Anlagen zusammenschließen und eindring-
lich die Entwicklung des Mietwohnungsbaus,
der Stadtplanung und die Sozialgeschichte
der Stadt im 19. und frühen 20. Jh. dokumen-
tieren.
Die ältesten Arbeiterhäuser wurden inzwi-
schen abgerissen, doch zeigen z.B. Häuser
der Viktoriastraße - stellvertretend für andere
erhaltene Häuser - eindringlich den Haustyp
von etwa 1870; jene in der Konkordia- und
Wittekindstraße dokumentieren ein kleinbür-
gerliches Quartier von 1880-95, jene in der
Kochstraße ein ebensolches Quartier von
1895 mit charakteristischer Hinterhausbebau-
ung, welche ebenfalls zu den frühen Genos-
senschaftsbauten im Karree Benno-, Henni-
ges-, Velvet-, Wilhelm-Bluhm-Straße gehörte.
Die Häuser an der Steigerthalstraße reprä-
sentieren den genossenschaftlichen Woh-
nungsbau der zwanziger Jahre dieses Jahr-
hunderts.
Daneben finden sich Quartiere mit anspruchs-
volleren Mietwohnhäusern (z.B. an der Nie-
meyerstraße, am Lichtenbergplatz, an der
Beethoven- und Jacobsstraße und am Pfarr-
landplatz), und aufwendiger gestaltete Ge-
schäftshäuser (z.B. Schwarzer Bär 1 -7). Als
Einzeldenkmale wurden bis auf wenige zu-
meist anspruchsvolle Häuser oder Villen (z.B.
Davenstedter Straße 4, Deisterstraße 31/33,
Ricklinger Straße 40) Solitär- und öffentliche
Bauten ausgewiesen, wie das „Capitolhoch-
haus“ von 1930 (Schwarzer Bär 2), Kirchen,
Schulen, Rathäuser usw., die sowohl ge-
schichtliche Bedeutung besitzen als auch
durch ihre beträchtlichen architektonischen
Qualitäten das Ortsbild prägen.
Wie die Aufzählung deutlich machen soll, be-
stimmen vor allem Bauten der zweiten Hälfte
des 19. Jh. und des frühen 20. Jh. nicht nur
den Denkmalbestand Lindens, sondern die
ehemalige Stadt insgesamt. Tatsächlich ent-
standen jedoch vor allem innerhalb der letzten
drei Jahrzehnte große neue Komplexe anstel-
le älterer Bebauung, die das Stadtbild beein-
flussen (z.B. Neubebauung Fortunastraße,
Pfarrlandstraße, Sanierungsgebiet Linden-
Süd), und die wegen ihrer großen Masse ganz
neue Dominanten darstellen (z.B. das Heiz-
kraftwerk, das Landesverwaltungsamt, die Er-
weiterung des Krankenhauses Siloah, das Ih-
me-Zentrum, alle in der Nähe der Ihme).
Von Interesse ist insgesamt der östliche in
weiten Abschnitten dicht bebaute Bereich Lin-
dens mit dem vor allem im 19. Jh. entstande-
nen Stadtgrundriß. In diesem gingen ältere
Kartengrundlage: Ausschnitt aus der Stadtkarte Hannover 1:10000
Vervielfältigung mit Genehmigung der Landeshauptstadt Hannover - Stadtvermessungsamt -
vom 30. 8.1985
Wege - begradigt und verstädtert - auf, vor-
malige Strukturen hinterließen ihre Spuren.
An diesem Grundriß läßt sich die Entwicklung
der Ideen und Ziele in der Stadtplanung von
etwa 1840 bis kurz nach 1900 ablesen: Den
Tendenzwandel von Städtebau unter dem Pri-
mat des Verkehrs zum „urbanen“ Städtebau
unter dem Primat der Wohnqualität zeigt z.B.
der Vergleich des Quartiers um den Lichten-
bergplatz mit jenem um den Bethlehemplatz.
50
33-35 LINDEN
Der Kartenausschnitt zeigt die Stadtteile Lin-
den-Nord, Linden-Mitte und Linden-Süd, die
sich im 19. und 20. Jh. aus dem Dorf Linden in
der dazugehörigen Feldmark entwickelten.
Bis 1829 umfaßte die Feldmark auch das
rechtsihrnische Gebiet von Glocksee und Ohe
(heute Calenberger Neustadt, vgl. Hannover
Teil 1). Die heutige Ostgrenze bildet die Ihme,
deren Flußbett in den dreißiger Jahren dieses
Jahrhunderts vom Schnellen Graben bis zur
Höhe Waterlooplatz begradigt wurde, deren
Lauf ansonsten jedoch bis zum Zusammen-
fluß mit der Leine ebenso wie der anschließen-
de Abschnitt der Leine seit der Anlage des
Schnellen Grabens, der im Süden die Ihme
mit Wasser aus der Leine auffüllt und sie da-
durch schiffbar machte, nur unwesentlich ver-
ändert wurde. Die Nutzung und spätere Be-
bauung der Ufer war allerdings seit dieser Zeit
einem beträchtlichen Wandel unterworfen.
Die Westgrenze der Feldmark bildete ur-
sprünglich die Fösse; heute markieren weitge-
hend Verkehrsanlagen des späten 19. und 20.
Jh. die West- und Südgrenze der Stadtteile:
der in den sechziger Jahren entstandene
Westschnellweg, die Güterumgehungsbahn
von 1909, die modern ausgebaute Baden-
stedter Straße, die Trasse der Altenbekener
Bahn von 1872 mit dem Bahnhof Fischerhof.
Der Westschnellweg (B 6) von etwa 1960 mit
dem historischen Abschnitt Göttinger Straße
teilt Linden in zwei Bereiche. Westlich von ihm
finden sich der Lindener Berg, die zweithöch-
ste Erhebung im Stadtgebiet Hannover, mit al-
ten baulichen Anlagen, und ehemaliges Ak-
kerland, das erst seit dem fortgeschrittenen
19. Jh. vorwiegend mit Industriebebauung
überzogen wurde. Dies entsprach der seit
1905 im Lindener Baurecht verankerten Flä-
chennutzungsplanung und korrelierte mit der
Einrichtung der Bahnlinien von 1872 und 1909
(geplant in den neunziger Jahren) und dem
Bau des Lindener Hafens 1913-17 (geplant
seit 1886). An bedeutender Industriearchitek-
tur haben sich hier im Süden die Werkshallen
und Verwaltungsgebäude der Hanomag er-
halten.
Im größeren Bereich östlich des Schnellwe-
ges lag Alt-Linden, das historische Dorf, von
dem allerdings nur noch wenige Relikte vor-
handen sind (Kirchturm St. Martin, ehemali-
ges bescheidenes Wohn- Wirtschaftsgebäu-
de Am Lindener Berg 16). Daneben entstand
im 17./18. Jh. die gräflich Platensche, heute
bis auf zwei Häuser (Weberstraße 20,21) ver-
schwundene Gründung Neu-Linden um den
bereits im 19. Jh. veränderten Barockpark, der
heute zusätzlich durch den Schnellweg zer-
schnitten ist: geringe Reste der Parkmauer
und Portale vom Beginn des 18. Jh. stehen an
der Wachsbleiche, an der Kirch- und Nie-
meyerstraße, Torhäuser aus dem frühen 20.
Jh. am Westende der Von-Alten-Aliee.
Einen Hinweis wegen ihrer historischen Be-
deutung verdienen der translozierte Brüning-
stein vor diesen Torhäusern und die 1910 an-
stelle der alten Steinbrücke von 1695/1700 er-
richtete Ihmebrücke.
Ansonsten bietet sich der östliche Bereich Lin-
dens als eine im 19. Jh. entstandene Indu-
striestadt mit ausgedehnten Wohngebieten
dar. Die Fabrikanlagen gingen bis auf wenige
Ausnahmen durch Zerstörung oder Nach-
kriegsaussiedlung verloren. Dagegen blieb
die Wohnbebauung - mit leichteren Lädie-
rungen - erhalten. Aus dieser großen Anzahl
gleichwertiger Bauten sind vor allem jene von
besonderer Bedeutung, die sich mit ihren
Nachbarhäusern zu einer Gruppe baulicher
Anlagen zusammenschließen und eindring-
lich die Entwicklung des Mietwohnungsbaus,
der Stadtplanung und die Sozialgeschichte
der Stadt im 19. und frühen 20. Jh. dokumen-
tieren.
Die ältesten Arbeiterhäuser wurden inzwi-
schen abgerissen, doch zeigen z.B. Häuser
der Viktoriastraße - stellvertretend für andere
erhaltene Häuser - eindringlich den Haustyp
von etwa 1870; jene in der Konkordia- und
Wittekindstraße dokumentieren ein kleinbür-
gerliches Quartier von 1880-95, jene in der
Kochstraße ein ebensolches Quartier von
1895 mit charakteristischer Hinterhausbebau-
ung, welche ebenfalls zu den frühen Genos-
senschaftsbauten im Karree Benno-, Henni-
ges-, Velvet-, Wilhelm-Bluhm-Straße gehörte.
Die Häuser an der Steigerthalstraße reprä-
sentieren den genossenschaftlichen Woh-
nungsbau der zwanziger Jahre dieses Jahr-
hunderts.
Daneben finden sich Quartiere mit anspruchs-
volleren Mietwohnhäusern (z.B. an der Nie-
meyerstraße, am Lichtenbergplatz, an der
Beethoven- und Jacobsstraße und am Pfarr-
landplatz), und aufwendiger gestaltete Ge-
schäftshäuser (z.B. Schwarzer Bär 1 -7). Als
Einzeldenkmale wurden bis auf wenige zu-
meist anspruchsvolle Häuser oder Villen (z.B.
Davenstedter Straße 4, Deisterstraße 31/33,
Ricklinger Straße 40) Solitär- und öffentliche
Bauten ausgewiesen, wie das „Capitolhoch-
haus“ von 1930 (Schwarzer Bär 2), Kirchen,
Schulen, Rathäuser usw., die sowohl ge-
schichtliche Bedeutung besitzen als auch
durch ihre beträchtlichen architektonischen
Qualitäten das Ortsbild prägen.
Wie die Aufzählung deutlich machen soll, be-
stimmen vor allem Bauten der zweiten Hälfte
des 19. Jh. und des frühen 20. Jh. nicht nur
den Denkmalbestand Lindens, sondern die
ehemalige Stadt insgesamt. Tatsächlich ent-
standen jedoch vor allem innerhalb der letzten
drei Jahrzehnte große neue Komplexe anstel-
le älterer Bebauung, die das Stadtbild beein-
flussen (z.B. Neubebauung Fortunastraße,
Pfarrlandstraße, Sanierungsgebiet Linden-
Süd), und die wegen ihrer großen Masse ganz
neue Dominanten darstellen (z.B. das Heiz-
kraftwerk, das Landesverwaltungsamt, die Er-
weiterung des Krankenhauses Siloah, das Ih-
me-Zentrum, alle in der Nähe der Ihme).
Von Interesse ist insgesamt der östliche in
weiten Abschnitten dicht bebaute Bereich Lin-
dens mit dem vor allem im 19. Jh. entstande-
nen Stadtgrundriß. In diesem gingen ältere
Kartengrundlage: Ausschnitt aus der Stadtkarte Hannover 1:10000
Vervielfältigung mit Genehmigung der Landeshauptstadt Hannover - Stadtvermessungsamt -
vom 30. 8.1985
Wege - begradigt und verstädtert - auf, vor-
malige Strukturen hinterließen ihre Spuren.
An diesem Grundriß läßt sich die Entwicklung
der Ideen und Ziele in der Stadtplanung von
etwa 1840 bis kurz nach 1900 ablesen: Den
Tendenzwandel von Städtebau unter dem Pri-
mat des Verkehrs zum „urbanen“ Städtebau
unter dem Primat der Wohnqualität zeigt z.B.
der Vergleich des Quartiers um den Lichten-
bergplatz mit jenem um den Bethlehemplatz.
50