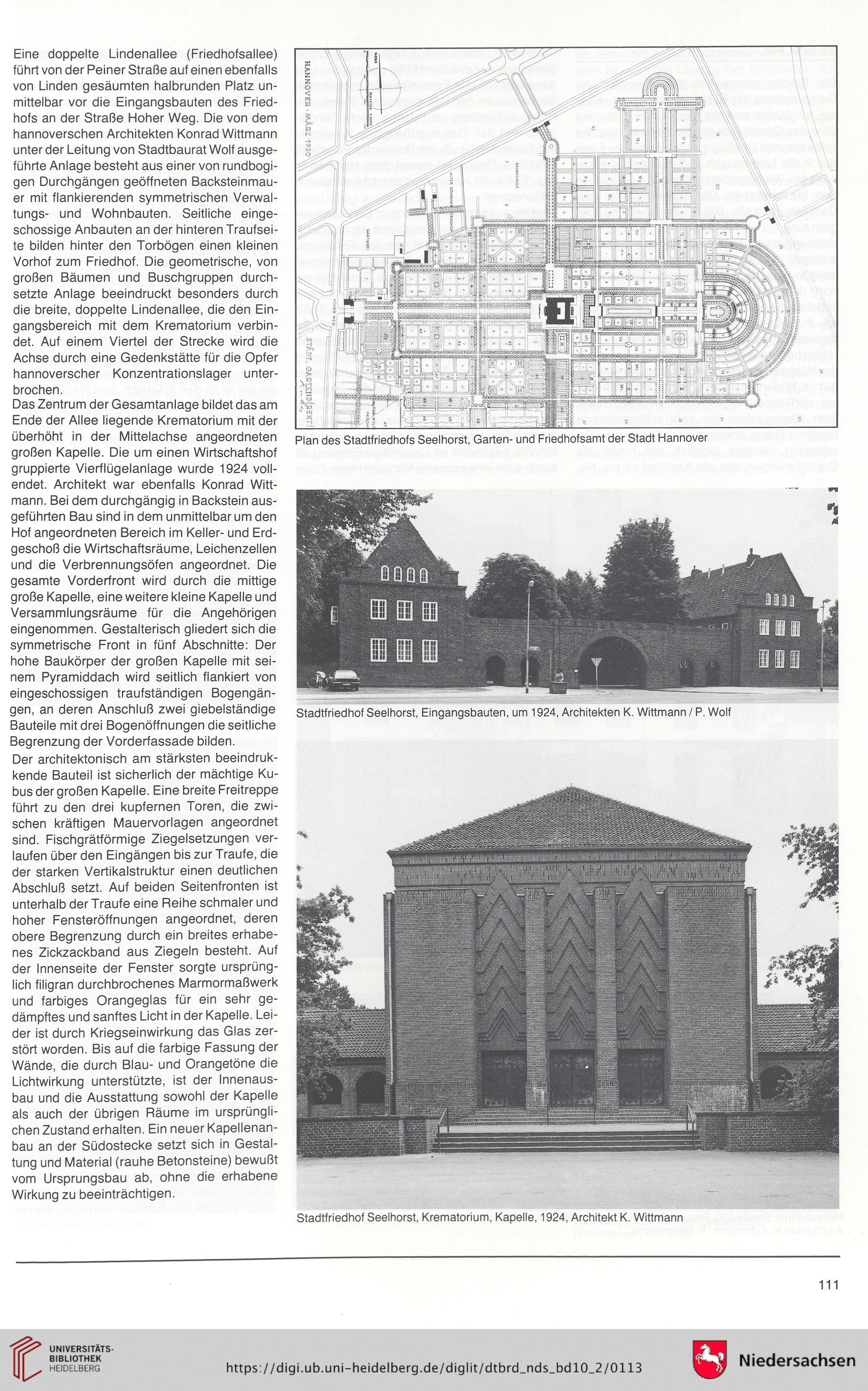Eine doppelte Lindenallee (Friedhofsallee)
führt von der Peiner Straße auf einen ebenfalls
von Linden gesäumten halbrunden Platz un-
mittelbar vor die Eingangsbauten des Fried-
hofs an der Straße Hoher Weg. Die von dem
hannoverschen Architekten Konrad Wittmann
unter der Leitung von Stadtbaurat Wolf ausge-
führte Anlage besteht aus einer von rundbogi-
gen Durchgängen geöffneten Backsteinmau-
er mit flankierenden symmetrischen Verwal-
tungs- und Wohnbauten. Seitliche einge-
schossige Anbauten an der hinteren Traufsei-
te bilden hinter den Torbögen einen kleinen
Vorhof zum Friedhof. Die geometrische, von
großen Bäumen und Buschgruppen durch-
setzte Anlage beeindruckt besonders durch
die breite, doppelte Lindenallee, die den Ein-
gangsbereich mit dem Krematorium verbin-
det. Auf einem Viertel der Strecke wird die
Achse durch eine Gedenkstätte für die Opfer
hannoverscher Konzentrationslager unter-
brochen.
Das Zentrum der Gesamtanlage bildet das am
Ende der Allee liegende Krematorium mit der
überhöht in der Mittelachse angeordneten
großen Kapelle. Die um einen Wirtschaftshof
gruppierte Vierflügelanlage wurde 1924 voll-
endet. Architekt war ebenfalls Konrad Witt-
mann. Bei dem durchgängig in Backstein aus-
geführten Bau sind in dem unmittelbar um den
Hof angeordneten Bereich im Keller- und Erd-
geschoß die Wirtschaftsräume, Leichenzellen
und die Verbrennungsöfen angeordnet. Die
gesamte Vorderfront wird durch die mittige
große Kapelle, eine weitere kleine Kapelle und
Versammlungsräume für die Angehörigen
eingenommen. Gestalterisch gliedert sich die
symmetrische Front in fünf Abschnitte: Der
hohe Baukörper der großen Kapelle mit sei-
nem Pyramiddach wird seitlich flankiert von
eingeschossigen traufständigen Bogengän-
gen, an deren Anschluß zwei giebelständige
Bauteile mit drei Bogenöffnungen die seitliche
Begrenzung der Vorderfassade bilden.
Der architektonisch am stärksten beeindruk-
kende Bauteil ist sicherlich der mächtige Ku-
bus der großen Kapelle. Eine breite Freitreppe
führt zu den drei kupfernen Toren, die zwi-
schen kräftigen Mauervorlagen angeordnet
sind. Fischgrätförmige Ziegelsetzungen ver-
laufen über den Eingängen bis zur Traufe, die
der starken Vertikalstruktur einen deutlichen
Abschluß setzt. Auf beiden Seitenfronten ist
unterhalb der Traufe eine Reihe schmaler und
hoher Fensteröffnungen angeordnet, deren
obere Begrenzung durch ein breites erhabe-
nes Zickzackband aus Ziegeln besteht. Auf
der Innenseite der Fenster sorgte ursprüng-
lich filigran durchbrochenes Marmormaßwerk
und farbiges Orangeglas für ein sehr ge-
dämpftes und sanftes Licht in der Kapelle. Lei-
der ist durch Kriegseinwirkung das Glas zer-
stört worden. Bis auf die farbige Fassung der
Wände, die durch Blau- und Orangetöne die
Lichtwirkung unterstützte, ist der Innenaus-
bau und die Ausstattung sowohl der Kapelle
als auch der übrigen Räume im ursprüngli-
chen Zustand erhalten. Ein neuer Kapellenan-
bau an der Südostecke setzt sich in Gestal-
tung und Material (rauhe Betonsteine) bewußt
vom Ursprungsbau ab, ohne die erhabene
Wirkung zu beeinträchtigen.
Plan des Stadtfriedhofs Seelhorst, Garten- und Friedhofsamt der Stadt Hannover
Stadtfriedhof Seelhorst, Eingangsbauten, um 1924, Architekten K. Wittmann / P. Wolf
Stadtfriedhof Seelhorst, Krematorium, Kapelle, 1924, Architekt K. Wittmann
111
führt von der Peiner Straße auf einen ebenfalls
von Linden gesäumten halbrunden Platz un-
mittelbar vor die Eingangsbauten des Fried-
hofs an der Straße Hoher Weg. Die von dem
hannoverschen Architekten Konrad Wittmann
unter der Leitung von Stadtbaurat Wolf ausge-
führte Anlage besteht aus einer von rundbogi-
gen Durchgängen geöffneten Backsteinmau-
er mit flankierenden symmetrischen Verwal-
tungs- und Wohnbauten. Seitliche einge-
schossige Anbauten an der hinteren Traufsei-
te bilden hinter den Torbögen einen kleinen
Vorhof zum Friedhof. Die geometrische, von
großen Bäumen und Buschgruppen durch-
setzte Anlage beeindruckt besonders durch
die breite, doppelte Lindenallee, die den Ein-
gangsbereich mit dem Krematorium verbin-
det. Auf einem Viertel der Strecke wird die
Achse durch eine Gedenkstätte für die Opfer
hannoverscher Konzentrationslager unter-
brochen.
Das Zentrum der Gesamtanlage bildet das am
Ende der Allee liegende Krematorium mit der
überhöht in der Mittelachse angeordneten
großen Kapelle. Die um einen Wirtschaftshof
gruppierte Vierflügelanlage wurde 1924 voll-
endet. Architekt war ebenfalls Konrad Witt-
mann. Bei dem durchgängig in Backstein aus-
geführten Bau sind in dem unmittelbar um den
Hof angeordneten Bereich im Keller- und Erd-
geschoß die Wirtschaftsräume, Leichenzellen
und die Verbrennungsöfen angeordnet. Die
gesamte Vorderfront wird durch die mittige
große Kapelle, eine weitere kleine Kapelle und
Versammlungsräume für die Angehörigen
eingenommen. Gestalterisch gliedert sich die
symmetrische Front in fünf Abschnitte: Der
hohe Baukörper der großen Kapelle mit sei-
nem Pyramiddach wird seitlich flankiert von
eingeschossigen traufständigen Bogengän-
gen, an deren Anschluß zwei giebelständige
Bauteile mit drei Bogenöffnungen die seitliche
Begrenzung der Vorderfassade bilden.
Der architektonisch am stärksten beeindruk-
kende Bauteil ist sicherlich der mächtige Ku-
bus der großen Kapelle. Eine breite Freitreppe
führt zu den drei kupfernen Toren, die zwi-
schen kräftigen Mauervorlagen angeordnet
sind. Fischgrätförmige Ziegelsetzungen ver-
laufen über den Eingängen bis zur Traufe, die
der starken Vertikalstruktur einen deutlichen
Abschluß setzt. Auf beiden Seitenfronten ist
unterhalb der Traufe eine Reihe schmaler und
hoher Fensteröffnungen angeordnet, deren
obere Begrenzung durch ein breites erhabe-
nes Zickzackband aus Ziegeln besteht. Auf
der Innenseite der Fenster sorgte ursprüng-
lich filigran durchbrochenes Marmormaßwerk
und farbiges Orangeglas für ein sehr ge-
dämpftes und sanftes Licht in der Kapelle. Lei-
der ist durch Kriegseinwirkung das Glas zer-
stört worden. Bis auf die farbige Fassung der
Wände, die durch Blau- und Orangetöne die
Lichtwirkung unterstützte, ist der Innenaus-
bau und die Ausstattung sowohl der Kapelle
als auch der übrigen Räume im ursprüngli-
chen Zustand erhalten. Ein neuer Kapellenan-
bau an der Südostecke setzt sich in Gestal-
tung und Material (rauhe Betonsteine) bewußt
vom Ursprungsbau ab, ohne die erhabene
Wirkung zu beeinträchtigen.
Plan des Stadtfriedhofs Seelhorst, Garten- und Friedhofsamt der Stadt Hannover
Stadtfriedhof Seelhorst, Eingangsbauten, um 1924, Architekten K. Wittmann / P. Wolf
Stadtfriedhof Seelhorst, Krematorium, Kapelle, 1924, Architekt K. Wittmann
111