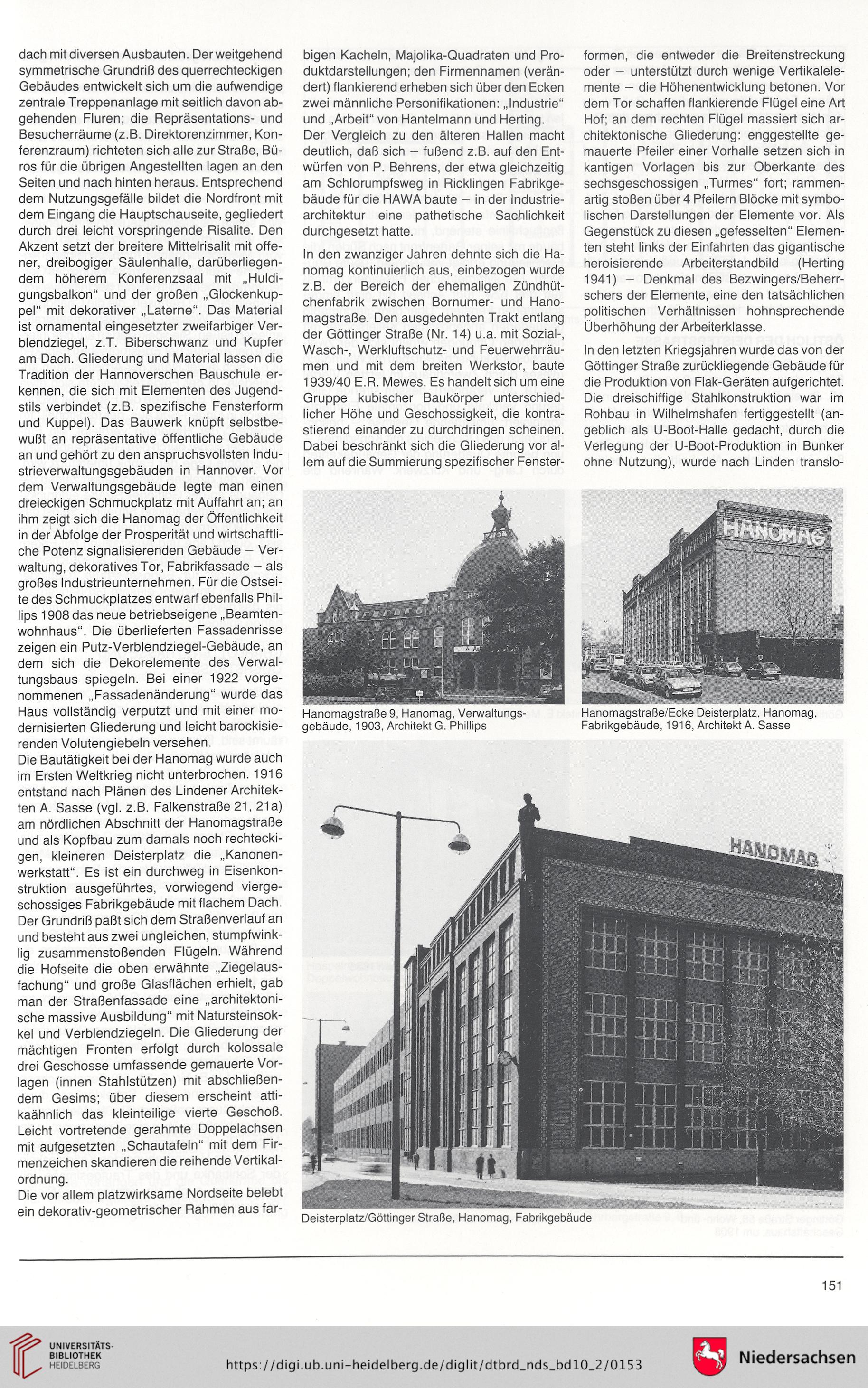dach mit diversen Ausbauten. Der weitgehend
symmetrische Grundriß des querrechteckigen
Gebäudes entwickelt sich um die aufwendige
zentrale Treppenanlage mit seitlich davon ab-
gehenden Fluren; die Repräsentations- und
Besucherräume (z.B. Direktorenzimmer, Kon-
ferenzraum) richteten sich alle zur Straße, Bü-
ros für die übrigen Angestellten lagen an den
Seiten und nach hinten heraus. Entsprechend
dem Nutzungsgefälle bildet die Nordfront mit
dem Eingang die Hauptschauseite, gegliedert
durch drei leicht vorspringende Risalite. Den
Akzent setzt der breitere Mittelrisalit mit offe-
ner, dreibogiger Säulenhalle, darüberliegen-
dem höherem Konferenzsaal mit „Huldi-
gungsbalkon“ und der großen „Glockenkup-
pel“ mit dekorativer „Laterne“. Das Material
ist ornamental eingesetzter zweifarbiger Ver-
blendziegel, z.T. Biberschwanz und Kupfer
am Dach. Gliederung und Material lassen die
Tradition der Hannoverschen Bauschule er-
kennen, die sich mit Elementen des Jugend-
stils verbindet (z.B. spezifische Fensterform
und Kuppel). Das Bauwerk knüpft selbstbe-
wußt an repräsentative öffentliche Gebäude
an und gehört zu den anspruchsvollsten Indu-
strieverwaltungsgebäuden in Hannover. Vor
dem Verwaltungsgebäude legte man einen
dreieckigen Schmuckplatz mit Auffahrt an; an
ihm zeigt sich die Hanomag der Öffentlichkeit
in der Abfolge der Prosperität und wirtschaftli-
che Potenz signalisierenden Gebäude - Ver-
waltung, dekoratives Tor, Fabrikfassade - als
großes Industrieunternehmen. Für die Ostsei-
te des Schmuckplatzes entwarf ebenfalls Phil-
lips 1908 das neue betriebseigene „Beamten-
wohnhaus“. Die überlieferten Fassadenrisse
zeigen ein Putz-Verblendziegel-Gebäude, an
dem sich die Dekorelemente des Verwal-
tungsbaus spiegeln. Bei einer 1922 vorge-
nommenen „Fassadenänderung“ wurde das
Haus vollständig verputzt und mit einer mo-
dernisierten Gliederung und leicht barockisie-
renden Volutengiebeln versehen.
Die Bautätigkeit bei der Hanomag wurde auch
im Ersten Weltkrieg nicht unterbrochen. 1916
entstand nach Plänen des Lindener Architek-
ten A. Sasse (vgl. z.B. Falkenstraße 21,21a)
am nördlichen Abschnitt der Hanomagstraße
und als Kopfbau zum damals noch rechtecki-
gen, kleineren Deisterplatz die „Kanonen-
werkstatt“. Es ist ein durchweg in Eisenkon-
struktion ausgeführtes, vorwiegend vierge-
schossiges Fabrikgebäude mit flachem Dach.
Der Grundriß paßt sich dem Straßenverlauf an
und besteht aus zwei ungleichen, stumpfwink-
lig zusammenstoßenden Flügeln. Während
die Hofseite die oben erwähnte „Ziegelaus-
fachung“ und große Glasflächen erhielt, gab
man der Straßenfassade eine „architektoni-
sche massive Ausbildung“ mit Natursteinsok-
kel und Verblendziegeln. Die Gliederung der
mächtigen Fronten erfolgt durch kolossale
drei Geschosse umfassende gemauerte Vor-
lagen (innen Stahlstützen) mit abschließen-
dem Gesims; über diesem erscheint atti-
kaähnlich das kleinteilige vierte Geschoß.
Leicht vortretende gerahmte Doppelachsen
mit aufgesetzten „Schautafeln“ mit dem Fir-
menzeichen skandieren die reihende Vertikal-
ordnung.
Die vor allem platzwirksame Nordseite belebt
ein dekorativ-geometrischer Rahmen aus far-
bigen Kacheln, Majolika-Quadraten und Pro-
duktdarstellungen; den Firmennamen (verän-
dert) flankierend erheben sich über den Ecken
zwei männliche Personifikationen: „Industrie“
und „Arbeit“ von Hantelmann und Herting.
Der Vergleich zu den älteren Hallen macht
deutlich, daß sich - fußend z.B. auf den Ent-
würfen von P. Behrens, der etwa gleichzeitig
am Schlorumpfsweg in Ricklingen Fabrikge-
bäude für die HAWA baute - in der Industrie-
architektur eine pathetische Sachlichkeit
durchgesetzt hatte.
In den zwanziger Jahren dehnte sich die Ha-
nomag kontinuierlich aus, einbezogen wurde
z.B. der Bereich der ehemaligen Zündhüt-
chenfabrik zwischen Bornumer- und Hano-
magstraße. Den ausgedehnten Trakt entlang
der Göttinger Straße (Nr. 14) u.a. mit Sozial-,
Wasch-, Werkluftschutz- und Feuerwehrräu-
men und mit dem breiten Werkstor, baute
1939/40 E.R. Mewes. Es handelt sich um eine
Gruppe kubischer Baukörper unterschied-
licher Höhe und Geschossigkeit, die kontra-
stierend einander zu durchdringen scheinen.
Dabei beschränkt sich die Gliederung vor al-
lem auf die Summierung spezifischer Fenster¬
formen, die entweder die Breitenstreckung
oder - unterstützt durch wenige Vertikalele-
mente - die Höhenentwicklung betonen. Vor
dem Tor schaffen flankierende Flügel eine Art
Hof; an dem rechten Flügel massiert sich ar-
chitektonische Gliederung: enggestellte ge-
mauerte Pfeiler einer Vorhalle setzen sich in
kantigen Vorlagen bis zur Oberkante des
sechsgeschossigen „Turmes“ fort; rammen-
artig stoßen über 4 Pfeilern Blöcke mit symbo-
lischen Darstellungen der Elemente vor. Als
Gegenstück zu diesen „gefesselten“ Elemen-
ten steht links der Einfahrten das gigantische
heroisierende Arbeiterstandbild (Herting
1941) - Denkmal des Bezwingers/Beherr-
schers der Elemente, eine den tatsächlichen
politischen Verhältnissen hohnsprechende
Überhöhung der Arbeiterklasse.
In den letzten Kriegsjahren wurde das von der
Göttinger Straße zurückliegende Gebäude für
die Produktion von Flak-Geräten aufgerichtet.
Die dreischiffige Stahlkonstruktion war im
Rohbau in Wilhelmshafen fertiggestellt (an-
geblich als U-Boot-Halle gedacht, durch die
Verlegung der U-Boot-Produktion in Bunker
ohne Nutzung), wurde nach Linden translo-
Hanomagstraße 9, Hanomag, Verwaltungs-
gebäude, 1903, Architekt G. Phillips
Hanomagstraße/Ecke Deisterplatz, Hanomag,
Fabrikgebäude, 1916, Architekt A. Sasse
Deisterplatz/Göttinger Straße, Hanomag, Fabrikgebäude
151
symmetrische Grundriß des querrechteckigen
Gebäudes entwickelt sich um die aufwendige
zentrale Treppenanlage mit seitlich davon ab-
gehenden Fluren; die Repräsentations- und
Besucherräume (z.B. Direktorenzimmer, Kon-
ferenzraum) richteten sich alle zur Straße, Bü-
ros für die übrigen Angestellten lagen an den
Seiten und nach hinten heraus. Entsprechend
dem Nutzungsgefälle bildet die Nordfront mit
dem Eingang die Hauptschauseite, gegliedert
durch drei leicht vorspringende Risalite. Den
Akzent setzt der breitere Mittelrisalit mit offe-
ner, dreibogiger Säulenhalle, darüberliegen-
dem höherem Konferenzsaal mit „Huldi-
gungsbalkon“ und der großen „Glockenkup-
pel“ mit dekorativer „Laterne“. Das Material
ist ornamental eingesetzter zweifarbiger Ver-
blendziegel, z.T. Biberschwanz und Kupfer
am Dach. Gliederung und Material lassen die
Tradition der Hannoverschen Bauschule er-
kennen, die sich mit Elementen des Jugend-
stils verbindet (z.B. spezifische Fensterform
und Kuppel). Das Bauwerk knüpft selbstbe-
wußt an repräsentative öffentliche Gebäude
an und gehört zu den anspruchsvollsten Indu-
strieverwaltungsgebäuden in Hannover. Vor
dem Verwaltungsgebäude legte man einen
dreieckigen Schmuckplatz mit Auffahrt an; an
ihm zeigt sich die Hanomag der Öffentlichkeit
in der Abfolge der Prosperität und wirtschaftli-
che Potenz signalisierenden Gebäude - Ver-
waltung, dekoratives Tor, Fabrikfassade - als
großes Industrieunternehmen. Für die Ostsei-
te des Schmuckplatzes entwarf ebenfalls Phil-
lips 1908 das neue betriebseigene „Beamten-
wohnhaus“. Die überlieferten Fassadenrisse
zeigen ein Putz-Verblendziegel-Gebäude, an
dem sich die Dekorelemente des Verwal-
tungsbaus spiegeln. Bei einer 1922 vorge-
nommenen „Fassadenänderung“ wurde das
Haus vollständig verputzt und mit einer mo-
dernisierten Gliederung und leicht barockisie-
renden Volutengiebeln versehen.
Die Bautätigkeit bei der Hanomag wurde auch
im Ersten Weltkrieg nicht unterbrochen. 1916
entstand nach Plänen des Lindener Architek-
ten A. Sasse (vgl. z.B. Falkenstraße 21,21a)
am nördlichen Abschnitt der Hanomagstraße
und als Kopfbau zum damals noch rechtecki-
gen, kleineren Deisterplatz die „Kanonen-
werkstatt“. Es ist ein durchweg in Eisenkon-
struktion ausgeführtes, vorwiegend vierge-
schossiges Fabrikgebäude mit flachem Dach.
Der Grundriß paßt sich dem Straßenverlauf an
und besteht aus zwei ungleichen, stumpfwink-
lig zusammenstoßenden Flügeln. Während
die Hofseite die oben erwähnte „Ziegelaus-
fachung“ und große Glasflächen erhielt, gab
man der Straßenfassade eine „architektoni-
sche massive Ausbildung“ mit Natursteinsok-
kel und Verblendziegeln. Die Gliederung der
mächtigen Fronten erfolgt durch kolossale
drei Geschosse umfassende gemauerte Vor-
lagen (innen Stahlstützen) mit abschließen-
dem Gesims; über diesem erscheint atti-
kaähnlich das kleinteilige vierte Geschoß.
Leicht vortretende gerahmte Doppelachsen
mit aufgesetzten „Schautafeln“ mit dem Fir-
menzeichen skandieren die reihende Vertikal-
ordnung.
Die vor allem platzwirksame Nordseite belebt
ein dekorativ-geometrischer Rahmen aus far-
bigen Kacheln, Majolika-Quadraten und Pro-
duktdarstellungen; den Firmennamen (verän-
dert) flankierend erheben sich über den Ecken
zwei männliche Personifikationen: „Industrie“
und „Arbeit“ von Hantelmann und Herting.
Der Vergleich zu den älteren Hallen macht
deutlich, daß sich - fußend z.B. auf den Ent-
würfen von P. Behrens, der etwa gleichzeitig
am Schlorumpfsweg in Ricklingen Fabrikge-
bäude für die HAWA baute - in der Industrie-
architektur eine pathetische Sachlichkeit
durchgesetzt hatte.
In den zwanziger Jahren dehnte sich die Ha-
nomag kontinuierlich aus, einbezogen wurde
z.B. der Bereich der ehemaligen Zündhüt-
chenfabrik zwischen Bornumer- und Hano-
magstraße. Den ausgedehnten Trakt entlang
der Göttinger Straße (Nr. 14) u.a. mit Sozial-,
Wasch-, Werkluftschutz- und Feuerwehrräu-
men und mit dem breiten Werkstor, baute
1939/40 E.R. Mewes. Es handelt sich um eine
Gruppe kubischer Baukörper unterschied-
licher Höhe und Geschossigkeit, die kontra-
stierend einander zu durchdringen scheinen.
Dabei beschränkt sich die Gliederung vor al-
lem auf die Summierung spezifischer Fenster¬
formen, die entweder die Breitenstreckung
oder - unterstützt durch wenige Vertikalele-
mente - die Höhenentwicklung betonen. Vor
dem Tor schaffen flankierende Flügel eine Art
Hof; an dem rechten Flügel massiert sich ar-
chitektonische Gliederung: enggestellte ge-
mauerte Pfeiler einer Vorhalle setzen sich in
kantigen Vorlagen bis zur Oberkante des
sechsgeschossigen „Turmes“ fort; rammen-
artig stoßen über 4 Pfeilern Blöcke mit symbo-
lischen Darstellungen der Elemente vor. Als
Gegenstück zu diesen „gefesselten“ Elemen-
ten steht links der Einfahrten das gigantische
heroisierende Arbeiterstandbild (Herting
1941) - Denkmal des Bezwingers/Beherr-
schers der Elemente, eine den tatsächlichen
politischen Verhältnissen hohnsprechende
Überhöhung der Arbeiterklasse.
In den letzten Kriegsjahren wurde das von der
Göttinger Straße zurückliegende Gebäude für
die Produktion von Flak-Geräten aufgerichtet.
Die dreischiffige Stahlkonstruktion war im
Rohbau in Wilhelmshafen fertiggestellt (an-
geblich als U-Boot-Halle gedacht, durch die
Verlegung der U-Boot-Produktion in Bunker
ohne Nutzung), wurde nach Linden translo-
Hanomagstraße 9, Hanomag, Verwaltungs-
gebäude, 1903, Architekt G. Phillips
Hanomagstraße/Ecke Deisterplatz, Hanomag,
Fabrikgebäude, 1916, Architekt A. Sasse
Deisterplatz/Göttinger Straße, Hanomag, Fabrikgebäude
151