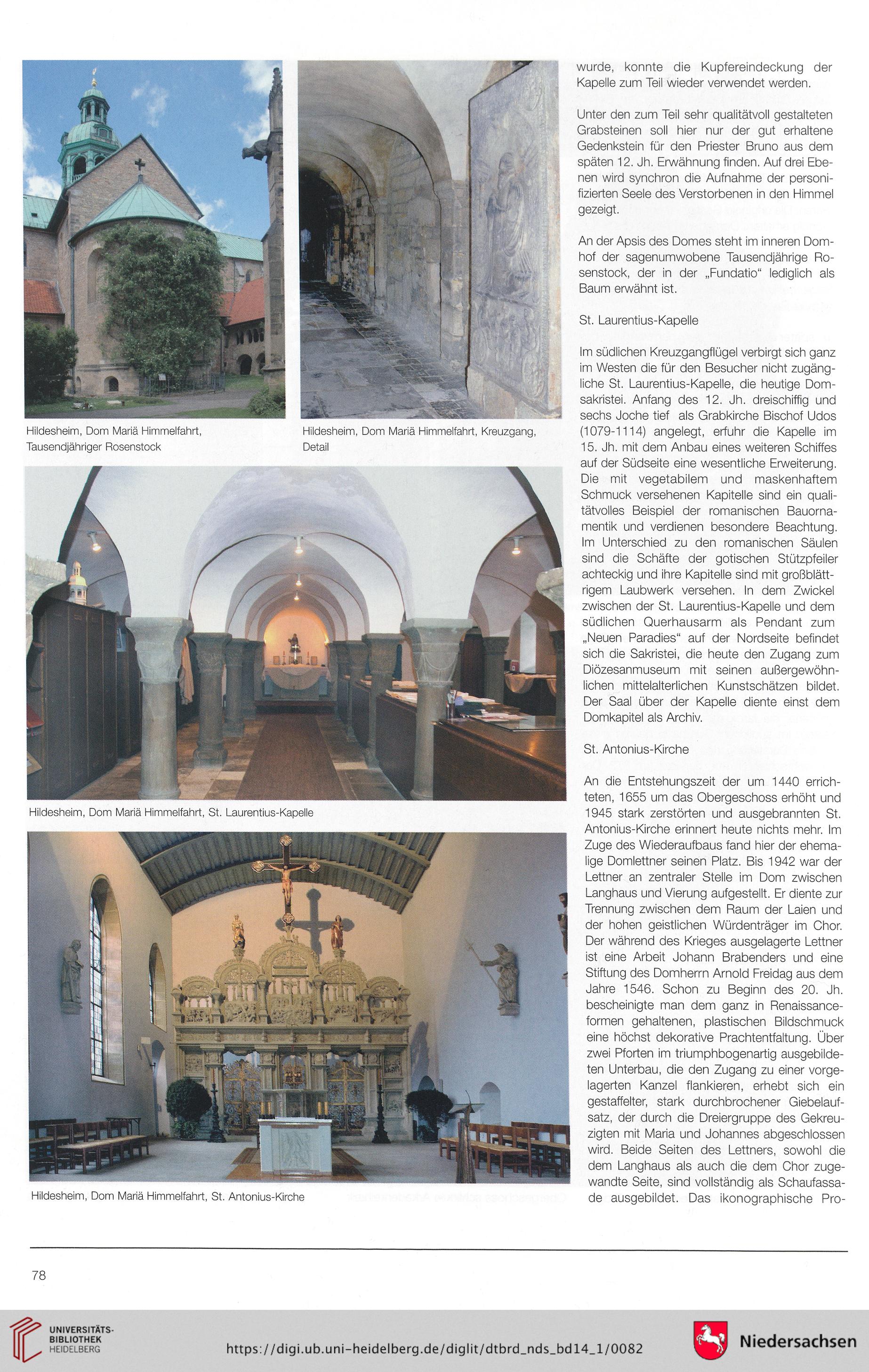Hildesheim, Dom Mariä Himmelfahrt,
Tausendjähriger Rosenstock
Hildesheim, Dom Mariä Himmelfahrt, Kreuzgang,
Detail
wurde, konnte die Kupfereindeckung der
Kapelle zum Teil wieder verwendet werden.
Unter den zum Teil sehr qualitätvoll gestalteten
Grabsteinen soll hier nur der gut erhaltene
Gedenkstein für den Priester Bruno aus dem
späten 12. Jh. Erwähnung finden. Auf drei Ebe-
nen wird synchron die Aufnahme der personi-
fizierten Seele des Verstorbenen in den Himmel
gezeigt.
An der Apsis des Domes steht im inneren Dom-
hof der sagenumwobene Tausendjährige Ro-
senstock, der in der „Fundatio“ lediglich als
Baum erwähnt ist.
St. Laurentius-Kapelle
Im südlichen Kreuzgangflügel verbirgt sich ganz
im Westen die für den Besucher nicht zugäng-
liche St. Laurentius-Kapelle, die heutige Dom-
sakristei. Anfang des 12. Jh. dreischiffig und
sechs Joche tief als Grabkirche Bischof Udos
(1079-1114) angelegt, erfuhr die Kapelle im
15. Jh. mit dem Anbau eines weiteren Schiffes
auf der Südseite eine wesentliche Erweiterung.
Die mit vegetabilem und maskenhaftem
Schmuck versehenen Kapitelle sind ein quali-
tätvolles Beispiel der romanischen Bauorna-
mentik und verdienen besondere Beachtung.
Im Unterschied zu den romanischen Säulen
sind die Schäfte der gotischen Stützpfeiler
achteckig und ihre Kapitelle sind mit großblätt-
rigem Laubwerk versehen. In dem Zwickel
zwischen der St. Laurentius-Kapelle und dem
südlichen Querhausarm als Pendant zum
„Neuen Paradies“ auf der Nordseite befindet
sich die Sakristei, die heute den Zugang zum
Diözesanmuseum mit seinen außergewöhn-
lichen mittelalterlichen Kunstschätzen bildet.
Der Saal über der Kapelle diente einst dem
Domkapitel als Archiv.
St. Antonius-Kirche
An die Entstehungszeit der um 1440 errich-
teten, 1655 um das Obergeschoss erhöht und
Hildesheim, Dom Mariä Himmelfahrt, St. Laurentius-Kapelle
Hildesheim, Dom Mariä Himmelfahrt, St. Antonius-Kirche
1945 stark zerstörten und ausgebrannten St.
Antonius-Kirche erinnert heute nichts mehr. Im
Zuge des Wiederaufbaus fand hier der ehema-
lige Domlettner seinen Platz. Bis 1942 war der
Lettner an zentraler Stelle im Dom zwischen
Langhaus und Vierung aufgestellt. Er diente zur
Trennung zwischen dem Raum der Laien und
der hohen geistlichen Würdenträger im Chor.
Der während des Krieges ausgelagerte Lettner
ist eine Arbeit Johann Brabenders und eine
Stiftung des Domherrn Arnold Freidag aus dem
Jahre 1546. Schon zu Beginn des 20. Jh.
bescheinigte man dem ganz in Renaissance-
formen gehaltenen, plastischen Bildschmuck
eine höchst dekorative Prachtentfaltung. Über
zwei Pforten im triumphbogenartig ausgebilde-
ten Unterbau, die den Zugang zu einer vorge-
lagerten Kanzel flankieren, erhebt sich ein
gestaffelter, stark durchbrochener Giebelauf-
satz, der durch die Dreiergruppe des Gekreu-
zigten mit Maria und Johannes abgeschlossen
wird. Beide Seiten des Lettners, sowohl die
dem Langhaus als auch die dem Chor zuge-
wandte Seite, sind vollständig als Schaufassa-
de ausgebildet. Das ikonographische Pro-
78
Tausendjähriger Rosenstock
Hildesheim, Dom Mariä Himmelfahrt, Kreuzgang,
Detail
wurde, konnte die Kupfereindeckung der
Kapelle zum Teil wieder verwendet werden.
Unter den zum Teil sehr qualitätvoll gestalteten
Grabsteinen soll hier nur der gut erhaltene
Gedenkstein für den Priester Bruno aus dem
späten 12. Jh. Erwähnung finden. Auf drei Ebe-
nen wird synchron die Aufnahme der personi-
fizierten Seele des Verstorbenen in den Himmel
gezeigt.
An der Apsis des Domes steht im inneren Dom-
hof der sagenumwobene Tausendjährige Ro-
senstock, der in der „Fundatio“ lediglich als
Baum erwähnt ist.
St. Laurentius-Kapelle
Im südlichen Kreuzgangflügel verbirgt sich ganz
im Westen die für den Besucher nicht zugäng-
liche St. Laurentius-Kapelle, die heutige Dom-
sakristei. Anfang des 12. Jh. dreischiffig und
sechs Joche tief als Grabkirche Bischof Udos
(1079-1114) angelegt, erfuhr die Kapelle im
15. Jh. mit dem Anbau eines weiteren Schiffes
auf der Südseite eine wesentliche Erweiterung.
Die mit vegetabilem und maskenhaftem
Schmuck versehenen Kapitelle sind ein quali-
tätvolles Beispiel der romanischen Bauorna-
mentik und verdienen besondere Beachtung.
Im Unterschied zu den romanischen Säulen
sind die Schäfte der gotischen Stützpfeiler
achteckig und ihre Kapitelle sind mit großblätt-
rigem Laubwerk versehen. In dem Zwickel
zwischen der St. Laurentius-Kapelle und dem
südlichen Querhausarm als Pendant zum
„Neuen Paradies“ auf der Nordseite befindet
sich die Sakristei, die heute den Zugang zum
Diözesanmuseum mit seinen außergewöhn-
lichen mittelalterlichen Kunstschätzen bildet.
Der Saal über der Kapelle diente einst dem
Domkapitel als Archiv.
St. Antonius-Kirche
An die Entstehungszeit der um 1440 errich-
teten, 1655 um das Obergeschoss erhöht und
Hildesheim, Dom Mariä Himmelfahrt, St. Laurentius-Kapelle
Hildesheim, Dom Mariä Himmelfahrt, St. Antonius-Kirche
1945 stark zerstörten und ausgebrannten St.
Antonius-Kirche erinnert heute nichts mehr. Im
Zuge des Wiederaufbaus fand hier der ehema-
lige Domlettner seinen Platz. Bis 1942 war der
Lettner an zentraler Stelle im Dom zwischen
Langhaus und Vierung aufgestellt. Er diente zur
Trennung zwischen dem Raum der Laien und
der hohen geistlichen Würdenträger im Chor.
Der während des Krieges ausgelagerte Lettner
ist eine Arbeit Johann Brabenders und eine
Stiftung des Domherrn Arnold Freidag aus dem
Jahre 1546. Schon zu Beginn des 20. Jh.
bescheinigte man dem ganz in Renaissance-
formen gehaltenen, plastischen Bildschmuck
eine höchst dekorative Prachtentfaltung. Über
zwei Pforten im triumphbogenartig ausgebilde-
ten Unterbau, die den Zugang zu einer vorge-
lagerten Kanzel flankieren, erhebt sich ein
gestaffelter, stark durchbrochener Giebelauf-
satz, der durch die Dreiergruppe des Gekreu-
zigten mit Maria und Johannes abgeschlossen
wird. Beide Seiten des Lettners, sowohl die
dem Langhaus als auch die dem Chor zuge-
wandte Seite, sind vollständig als Schaufassa-
de ausgebildet. Das ikonographische Pro-
78