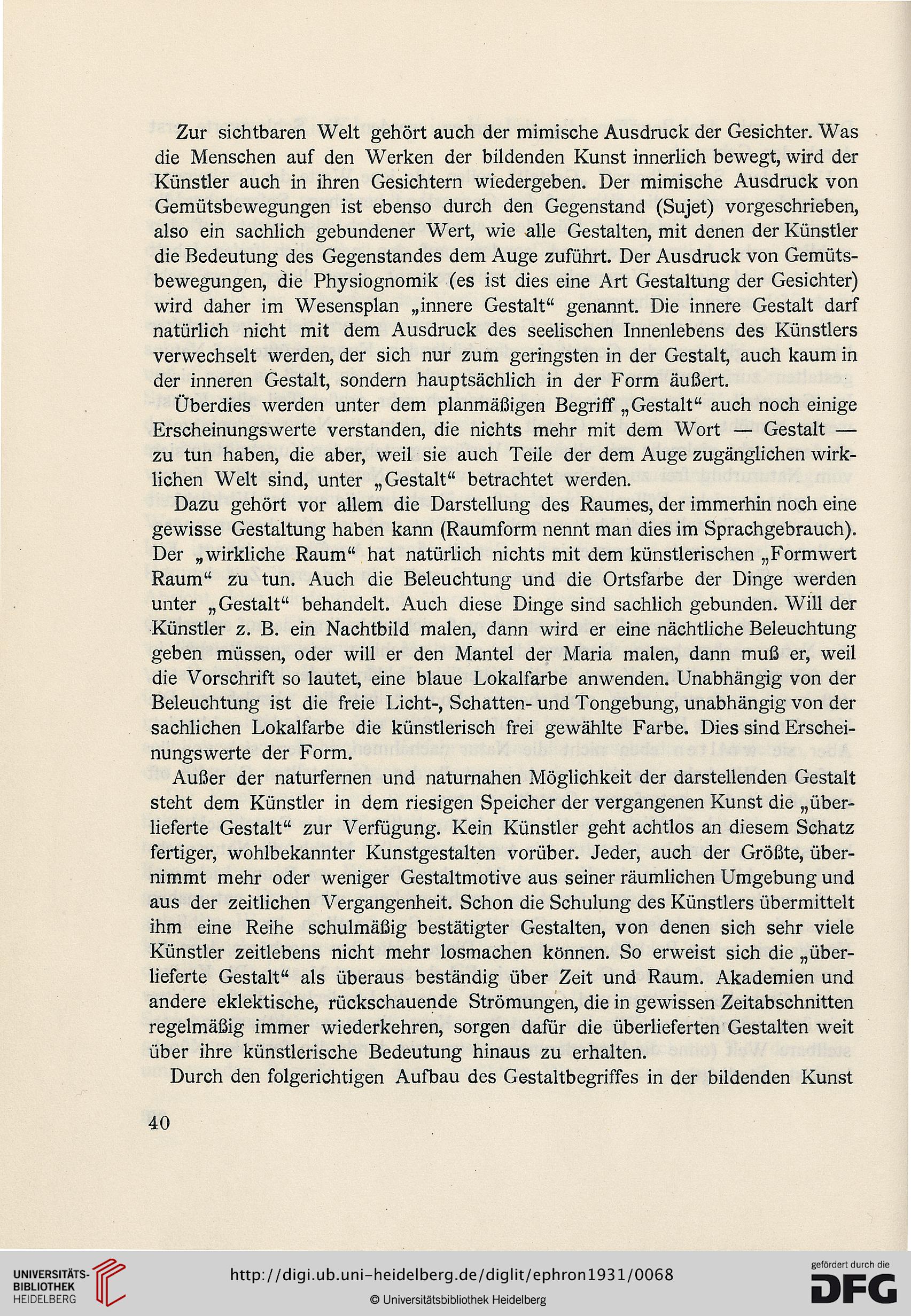Zur sichtbaren Welt gehört auch der mimische Ausdruck der Gesichter. Was
die Menschen auf den Werken der bildenden Kunst innerlich bewegt, wird der
Künstler auch in ihren Gesichtern wiedergeben. Der mimische Ausdruck von
Gemütsbewegungen ist ebenso durch den Gegenstand (Sujet) vorgeschrieben,
also ein sachlich gebundener Wert, wie alle Gestalten, mit denen der Künstler
die Bedeutung des Gegenstandes dem Auge zuführt. Der Ausdruck von Gemüts-
bewegungen, die Physiognomik (es ist dies eine Art Gestaltung der Gesichter)
wird daher im Wesensplan „innere Gestalt“ genannt. Die innere Gestalt darf
natürlich nicht mit dem Ausdruck des seelischen Innenlebens des Künstlers
verwechselt werden, der sich nur zum geringsten in der Gestalt, auch kaum in
der inneren Gestalt, sondern hauptsächlich in der Form äußert.
Überdies werden unter dem planmäßigen Begriff „Gestalt“ auch noch einige
Erscheinungswerte verstanden, die nichts mehr mit dem Wort — Gestalt —
zu tun haben, die aber, weil sie auch Teile der dem Auge zugänglichen wirk-
lichen Welt sind, unter „Gestalt“ betrachtet werden.
Dazu gehört vor allem die Darstellung des Raumes, der immerhin noch eine
gewisse Gestaltung haben kann (Raumform nennt man dies im Sprachgebrauch).
Der „wirkliche Raum“ hat natürlich nichts mit dem künstlerischen „Formwert
Raum“ zu tun. Auch die Beleuchtung und die Ortsfarbe der Dinge werden
unter „Gestalt“ behandelt. Auch diese Dinge sind sachlich gebunden. Will der
Künstler z. B. ein Nachtbild malen, dann wird er eine nächtliche Beleuchtung
geben müssen, oder will er den Mantel der Maria malen, dann muß er, weil
die Vorschrift so lautet, eine blaue Lokalfarbe anwenden. Unabhängig von der
Beleuchtung ist die freie Licht-, Schatten-und Tongebung, unabhängig von der
sachlichen Lokalfarbe die künstlerisch frei gewählte Farbe. Dies sind Erschei-
nungswerte der Form.
Außer der naturfernen und naturnahen Möglichkeit der darstellenden Gestalt
steht dem Künstler in dem riesigen Speicher der vergangenen Kunst die „über-
lieferte Gestalt“ zur Verfügung. Kein Künstler geht achtlos an diesem Schatz
fertiger, wohlbekannter Kunstgestalten vorüber. Jeder, auch der Größte, über-
nimmt mehr oder weniger Gestaltmotive aus seiner räumlichen Umgebung und
aus der zeitlichen Vergangenheit. Schon die Schulung des Künstlers übermittelt
ihm eine Reihe schulmäßig bestätigter Gestalten, von denen sich sehr viele
Künstler zeitlebens nicht mehr losmachen können. So erweist sich die „über-
lieferte Gestalt“ als überaus beständig über Zeit und Raum. Akademien und
andere eklektische, rückschauende Strömungen, die in gewissen Zeitabschnitten
regelmäßig immer wiederkehren, sorgen dafür die überlieferten Gestalten weit
über ihre künstlerische Bedeutung hinaus zu erhalten.
Durch den folgerichtigen Aufbau des Gestaltbegriffes in der bildenden Kunst
40
die Menschen auf den Werken der bildenden Kunst innerlich bewegt, wird der
Künstler auch in ihren Gesichtern wiedergeben. Der mimische Ausdruck von
Gemütsbewegungen ist ebenso durch den Gegenstand (Sujet) vorgeschrieben,
also ein sachlich gebundener Wert, wie alle Gestalten, mit denen der Künstler
die Bedeutung des Gegenstandes dem Auge zuführt. Der Ausdruck von Gemüts-
bewegungen, die Physiognomik (es ist dies eine Art Gestaltung der Gesichter)
wird daher im Wesensplan „innere Gestalt“ genannt. Die innere Gestalt darf
natürlich nicht mit dem Ausdruck des seelischen Innenlebens des Künstlers
verwechselt werden, der sich nur zum geringsten in der Gestalt, auch kaum in
der inneren Gestalt, sondern hauptsächlich in der Form äußert.
Überdies werden unter dem planmäßigen Begriff „Gestalt“ auch noch einige
Erscheinungswerte verstanden, die nichts mehr mit dem Wort — Gestalt —
zu tun haben, die aber, weil sie auch Teile der dem Auge zugänglichen wirk-
lichen Welt sind, unter „Gestalt“ betrachtet werden.
Dazu gehört vor allem die Darstellung des Raumes, der immerhin noch eine
gewisse Gestaltung haben kann (Raumform nennt man dies im Sprachgebrauch).
Der „wirkliche Raum“ hat natürlich nichts mit dem künstlerischen „Formwert
Raum“ zu tun. Auch die Beleuchtung und die Ortsfarbe der Dinge werden
unter „Gestalt“ behandelt. Auch diese Dinge sind sachlich gebunden. Will der
Künstler z. B. ein Nachtbild malen, dann wird er eine nächtliche Beleuchtung
geben müssen, oder will er den Mantel der Maria malen, dann muß er, weil
die Vorschrift so lautet, eine blaue Lokalfarbe anwenden. Unabhängig von der
Beleuchtung ist die freie Licht-, Schatten-und Tongebung, unabhängig von der
sachlichen Lokalfarbe die künstlerisch frei gewählte Farbe. Dies sind Erschei-
nungswerte der Form.
Außer der naturfernen und naturnahen Möglichkeit der darstellenden Gestalt
steht dem Künstler in dem riesigen Speicher der vergangenen Kunst die „über-
lieferte Gestalt“ zur Verfügung. Kein Künstler geht achtlos an diesem Schatz
fertiger, wohlbekannter Kunstgestalten vorüber. Jeder, auch der Größte, über-
nimmt mehr oder weniger Gestaltmotive aus seiner räumlichen Umgebung und
aus der zeitlichen Vergangenheit. Schon die Schulung des Künstlers übermittelt
ihm eine Reihe schulmäßig bestätigter Gestalten, von denen sich sehr viele
Künstler zeitlebens nicht mehr losmachen können. So erweist sich die „über-
lieferte Gestalt“ als überaus beständig über Zeit und Raum. Akademien und
andere eklektische, rückschauende Strömungen, die in gewissen Zeitabschnitten
regelmäßig immer wiederkehren, sorgen dafür die überlieferten Gestalten weit
über ihre künstlerische Bedeutung hinaus zu erhalten.
Durch den folgerichtigen Aufbau des Gestaltbegriffes in der bildenden Kunst
40