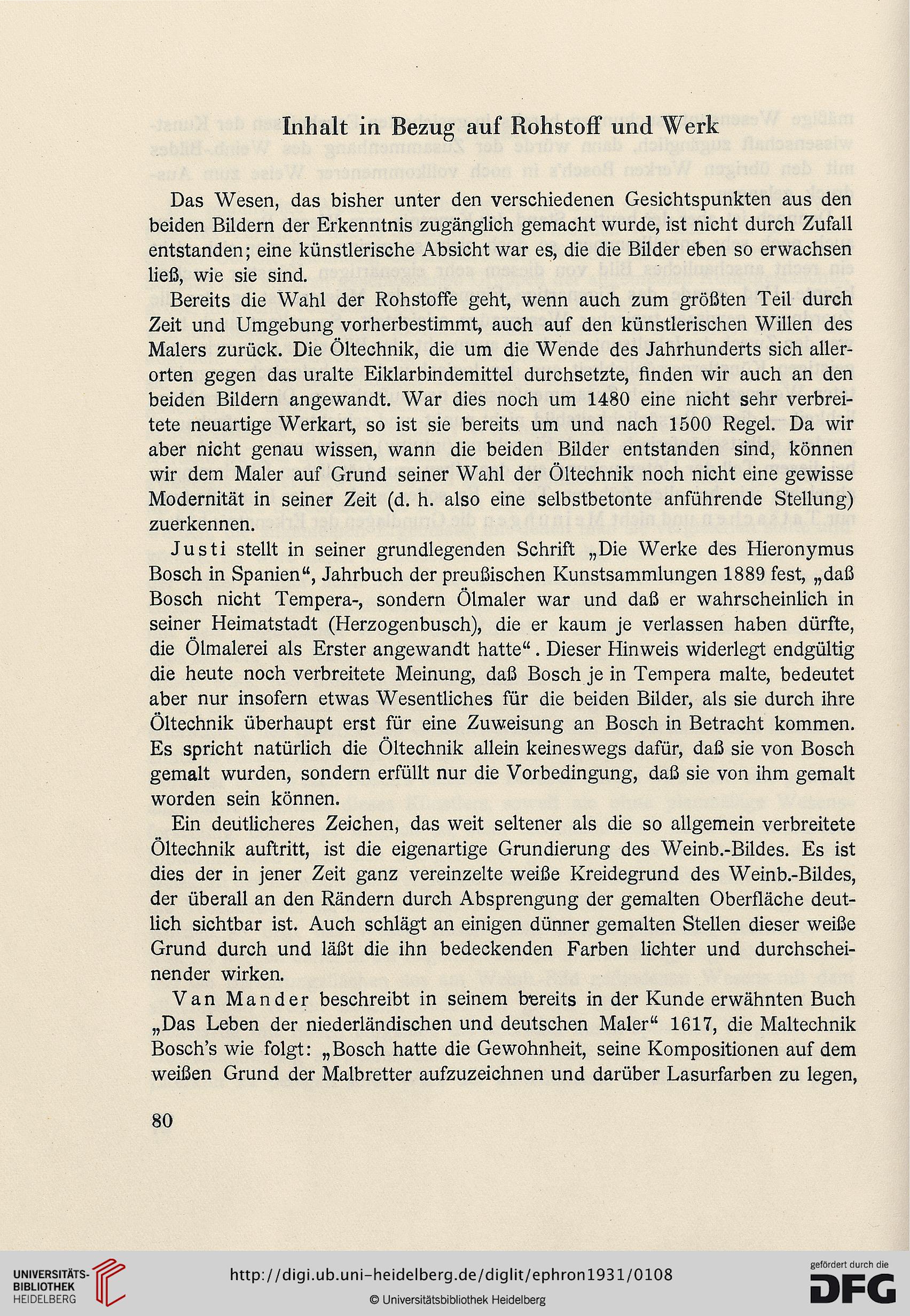Inhalt in Bezug auf Rohstoff und Werk
Das Wesen, das bisher unter den verschiedenen Gesichtspunkten aus den
beiden Bildern der Erkenntnis zugänglich gemacht wurde, ist nicht durch Zufall
entstanden; eine künstlerische Absicht war es, die die Bilder eben so erwachsen
ließ, wie sie sind.
Bereits die Wahl der Rohstoffe geht, wenn auch zum größten Teil durch
Zeit und Umgebung vorherbestimmt, auch auf den künstlerischen Willen des
Malers zurück. Die Öltechnik, die um die Wende des Jahrhunderts sich aller-
orten gegen das uralte Eiklarbindemittel durchsetzte, finden wir auch an den
beiden Bildern angewandt. War dies noch um 1480 eine nicht sehr verbrei-
tete neuartige Werkart, so ist sie bereits um und nach 1500 Regel. Da wir
aber nicht genau wissen, wann die beiden Bilder entstanden sind, können
wir dem Maler auf Grund seiner Wahl der Öltechnik noch nicht eine gewisse
Modernität in seiner Zeit (d. h. also eine selbstbetonte anführende Stellung)
zuerkennen.
Justi stellt in seiner grundlegenden Schrift „Die Werke des Hieronymus
Bosch in Spanien“, Jahrbuch der preußischen Kunstsammlungen 1889 fest, „daß
Bosch nicht Tempera-, sondern Ölmaler war und daß er wahrscheinlich in
seiner Heimatstadt (Herzogenbusch), die er kaum je verlassen haben dürfte,
die Ölmalerei als Erster angewandt hatte“ . Dieser Hinweis widerlegt endgültig
die heute noch verbreitete Meinung, daß Bosch je in Tempera malte, bedeutet
aber nur insofern etwas Wesentliches für die beiden Bilder, als sie durch ihre
Öltechnik überhaupt erst für eine Zuweisung an Bosch in Betracht kommen.
Es spricht natürlich die Öltechnik allein keineswegs dafür, daß sie von Bosch
gemalt wurden, sondern erfüllt nur die Vorbedingung, daß sie von ihm gemalt
worden sein können.
Ein deutlicheres Zeichen, das weit seltener als die so allgemein verbreitete
Öltechnik auftritt, ist die eigenartige Grundierung des Weinb.-Bildes. Es ist
dies der in jener Zeit ganz vereinzelte weiße Kreidegrund des Weinb.-Bildes,
der überall an den Rändern durch Absprengung der gemalten Oberfläche deut-
lich sichtbar ist. Auch schlägt an einigen dünner gemalten Stellen dieser weiße
Grund durch und läßt die ihn bedeckenden Farben lichter und durchschei-
nender wirken.
Van Mander beschreibt in seinem bereits in der Kunde erwähnten Buch
„Das Leben der niederländischen und deutschen Maler“ 1617, die Maltechnik
Bosch’s wie folgt: „Bosch hatte die Gewohnheit, seine Kompositionen auf dem
weißen Grund der Malbretter aufzuzeichnen und darüber Lasurfarben zu legen,
80
Das Wesen, das bisher unter den verschiedenen Gesichtspunkten aus den
beiden Bildern der Erkenntnis zugänglich gemacht wurde, ist nicht durch Zufall
entstanden; eine künstlerische Absicht war es, die die Bilder eben so erwachsen
ließ, wie sie sind.
Bereits die Wahl der Rohstoffe geht, wenn auch zum größten Teil durch
Zeit und Umgebung vorherbestimmt, auch auf den künstlerischen Willen des
Malers zurück. Die Öltechnik, die um die Wende des Jahrhunderts sich aller-
orten gegen das uralte Eiklarbindemittel durchsetzte, finden wir auch an den
beiden Bildern angewandt. War dies noch um 1480 eine nicht sehr verbrei-
tete neuartige Werkart, so ist sie bereits um und nach 1500 Regel. Da wir
aber nicht genau wissen, wann die beiden Bilder entstanden sind, können
wir dem Maler auf Grund seiner Wahl der Öltechnik noch nicht eine gewisse
Modernität in seiner Zeit (d. h. also eine selbstbetonte anführende Stellung)
zuerkennen.
Justi stellt in seiner grundlegenden Schrift „Die Werke des Hieronymus
Bosch in Spanien“, Jahrbuch der preußischen Kunstsammlungen 1889 fest, „daß
Bosch nicht Tempera-, sondern Ölmaler war und daß er wahrscheinlich in
seiner Heimatstadt (Herzogenbusch), die er kaum je verlassen haben dürfte,
die Ölmalerei als Erster angewandt hatte“ . Dieser Hinweis widerlegt endgültig
die heute noch verbreitete Meinung, daß Bosch je in Tempera malte, bedeutet
aber nur insofern etwas Wesentliches für die beiden Bilder, als sie durch ihre
Öltechnik überhaupt erst für eine Zuweisung an Bosch in Betracht kommen.
Es spricht natürlich die Öltechnik allein keineswegs dafür, daß sie von Bosch
gemalt wurden, sondern erfüllt nur die Vorbedingung, daß sie von ihm gemalt
worden sein können.
Ein deutlicheres Zeichen, das weit seltener als die so allgemein verbreitete
Öltechnik auftritt, ist die eigenartige Grundierung des Weinb.-Bildes. Es ist
dies der in jener Zeit ganz vereinzelte weiße Kreidegrund des Weinb.-Bildes,
der überall an den Rändern durch Absprengung der gemalten Oberfläche deut-
lich sichtbar ist. Auch schlägt an einigen dünner gemalten Stellen dieser weiße
Grund durch und läßt die ihn bedeckenden Farben lichter und durchschei-
nender wirken.
Van Mander beschreibt in seinem bereits in der Kunde erwähnten Buch
„Das Leben der niederländischen und deutschen Maler“ 1617, die Maltechnik
Bosch’s wie folgt: „Bosch hatte die Gewohnheit, seine Kompositionen auf dem
weißen Grund der Malbretter aufzuzeichnen und darüber Lasurfarben zu legen,
80