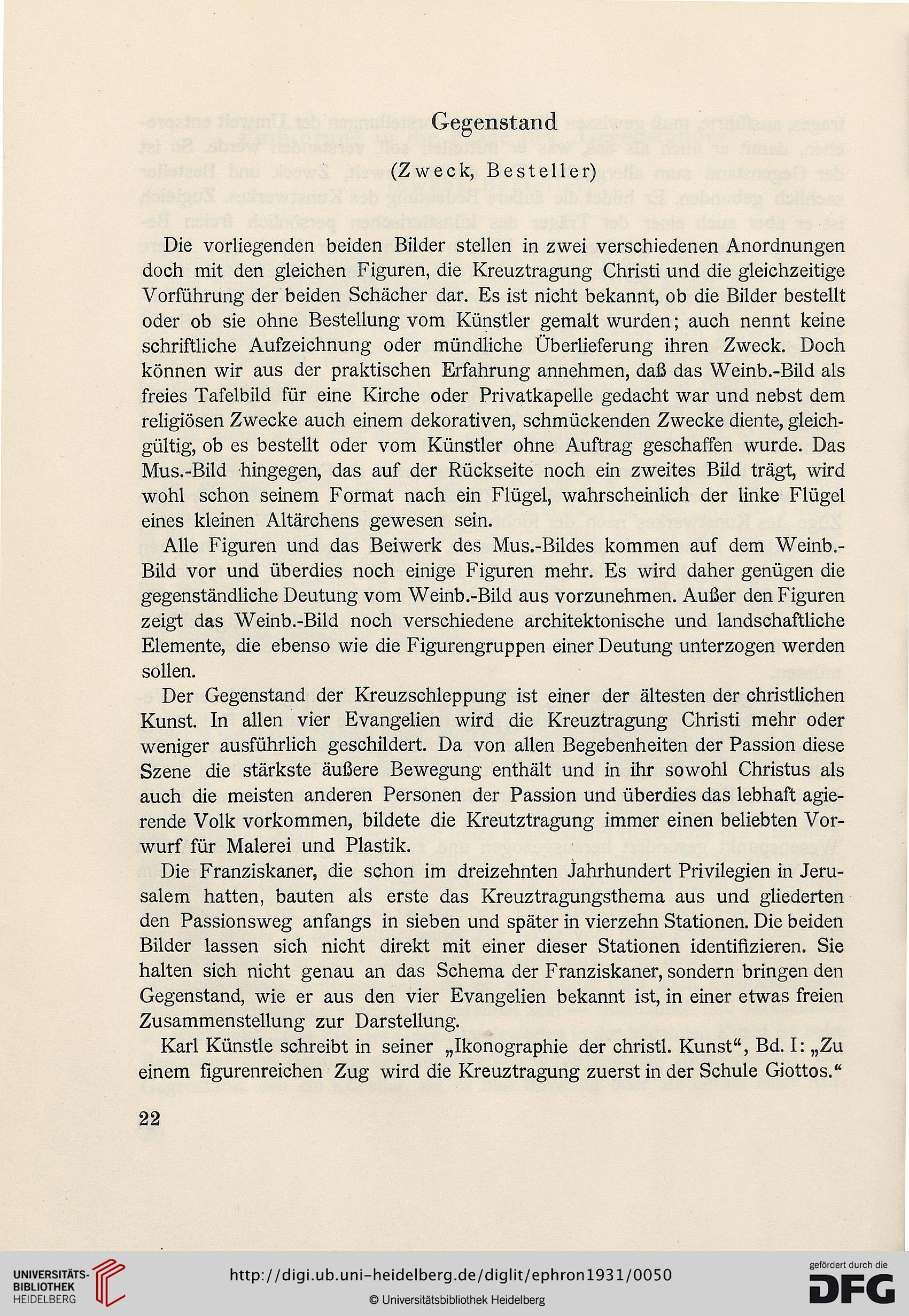Gegenstand
(Zweck, Besteller)
Die vorliegenden beiden Bilder stellen in zwei verschiedenen Anordnungen
doch mit den gleichen Figuren, die Kreuztragung Christi und die gleichzeitige
Vorführung der beiden Schächer dar. Es ist nicht bekannt, ob die Bilder bestellt
oder ob sie ohne Bestellung vom Künstler gemalt wurden; auch nennt keine
schriftliche Aufzeichnung oder mündliche Überlieferung ihren Zweck. Doch
können wir aus der praktischen Erfahrung annehmen, daß das Weinb.-Bild als
freies Tafelbild für eine Kirche oder Privatkapelle gedacht war und nebst dem
religiösen Zwecke auch einem dekorativen, schmückenden Zwecke diente, gleich-
gültig, ob es bestellt oder vom Künstler ohne Auftrag geschaffen wurde. Das
Mus.-Bild hingegen, das auf der Rückseite noch ein zweites Bild trägt, wird
wohl schon seinem Format nach ein Flügel, wahrscheinlich der linke Flügel
eines kleinen Altärchens gewesen sein.
Alle Figuren und das Beiwerk des Mus.-Bildes kommen auf dem Weinb.-
Bild vor und überdies noch einige Figuren mehr. Es wird daher genügen die
gegenständliche Deutung vom Weinb.-Bild aus vorzunehmen. Außer den Figuren
zeigt das Weinb.-Bild noch verschiedene architektonische und landschaftliche
Elemente, die ebenso wie die Figurengruppen einerDeutung unterzogen werden
sollen.
Der Gegenstand der Kreuzschleppung ist einer der ältesten der christlichen
Kunst. In allen vier Evangelien wird die Kreuztragung Christi mehr oder
weniger ausführlich geschildert. Da von allen Begebenheiten der Passion diese
Szene die stärkste äußere Bewegung enthält und in ihr sowohl Christus als
auch die meisten anderen Personen der Passion und überdies das lebhaft agie-
rende Volk vorkommen, bildete die Kreutztragung immer einen beliebten Vor-
wurf für Malerei und Plastik.
Die Franziskaner, die schon im dreizehnten Jahrhundert Privilegien in Jeru-
salem hatten, bauten als erste das Kreuztragungsthema aus und gliederten
den Passionsweg anfangs in sieben und später in vierzehn Stationen. Die beiden
Bilder lassen sich nicht direkt mit einer dieser Stationen identiflzieren. Sie
halten sich nicht genau an das Schema der Franziskaner, sondern bringen den
Gegenstand, wie er aus den vier Evangelien bekannt ist, in einer etwas freien
Zusammenstellung zur Darstellung.
Karl Künstle schreibt in seiner „Ikonographie der christl. Kunst“, Bd. I: „Zu
einem figurenreichen Zug wird die Kreuztragung zuerst in der Schule Giottos.“
22
(Zweck, Besteller)
Die vorliegenden beiden Bilder stellen in zwei verschiedenen Anordnungen
doch mit den gleichen Figuren, die Kreuztragung Christi und die gleichzeitige
Vorführung der beiden Schächer dar. Es ist nicht bekannt, ob die Bilder bestellt
oder ob sie ohne Bestellung vom Künstler gemalt wurden; auch nennt keine
schriftliche Aufzeichnung oder mündliche Überlieferung ihren Zweck. Doch
können wir aus der praktischen Erfahrung annehmen, daß das Weinb.-Bild als
freies Tafelbild für eine Kirche oder Privatkapelle gedacht war und nebst dem
religiösen Zwecke auch einem dekorativen, schmückenden Zwecke diente, gleich-
gültig, ob es bestellt oder vom Künstler ohne Auftrag geschaffen wurde. Das
Mus.-Bild hingegen, das auf der Rückseite noch ein zweites Bild trägt, wird
wohl schon seinem Format nach ein Flügel, wahrscheinlich der linke Flügel
eines kleinen Altärchens gewesen sein.
Alle Figuren und das Beiwerk des Mus.-Bildes kommen auf dem Weinb.-
Bild vor und überdies noch einige Figuren mehr. Es wird daher genügen die
gegenständliche Deutung vom Weinb.-Bild aus vorzunehmen. Außer den Figuren
zeigt das Weinb.-Bild noch verschiedene architektonische und landschaftliche
Elemente, die ebenso wie die Figurengruppen einerDeutung unterzogen werden
sollen.
Der Gegenstand der Kreuzschleppung ist einer der ältesten der christlichen
Kunst. In allen vier Evangelien wird die Kreuztragung Christi mehr oder
weniger ausführlich geschildert. Da von allen Begebenheiten der Passion diese
Szene die stärkste äußere Bewegung enthält und in ihr sowohl Christus als
auch die meisten anderen Personen der Passion und überdies das lebhaft agie-
rende Volk vorkommen, bildete die Kreutztragung immer einen beliebten Vor-
wurf für Malerei und Plastik.
Die Franziskaner, die schon im dreizehnten Jahrhundert Privilegien in Jeru-
salem hatten, bauten als erste das Kreuztragungsthema aus und gliederten
den Passionsweg anfangs in sieben und später in vierzehn Stationen. Die beiden
Bilder lassen sich nicht direkt mit einer dieser Stationen identiflzieren. Sie
halten sich nicht genau an das Schema der Franziskaner, sondern bringen den
Gegenstand, wie er aus den vier Evangelien bekannt ist, in einer etwas freien
Zusammenstellung zur Darstellung.
Karl Künstle schreibt in seiner „Ikonographie der christl. Kunst“, Bd. I: „Zu
einem figurenreichen Zug wird die Kreuztragung zuerst in der Schule Giottos.“
22