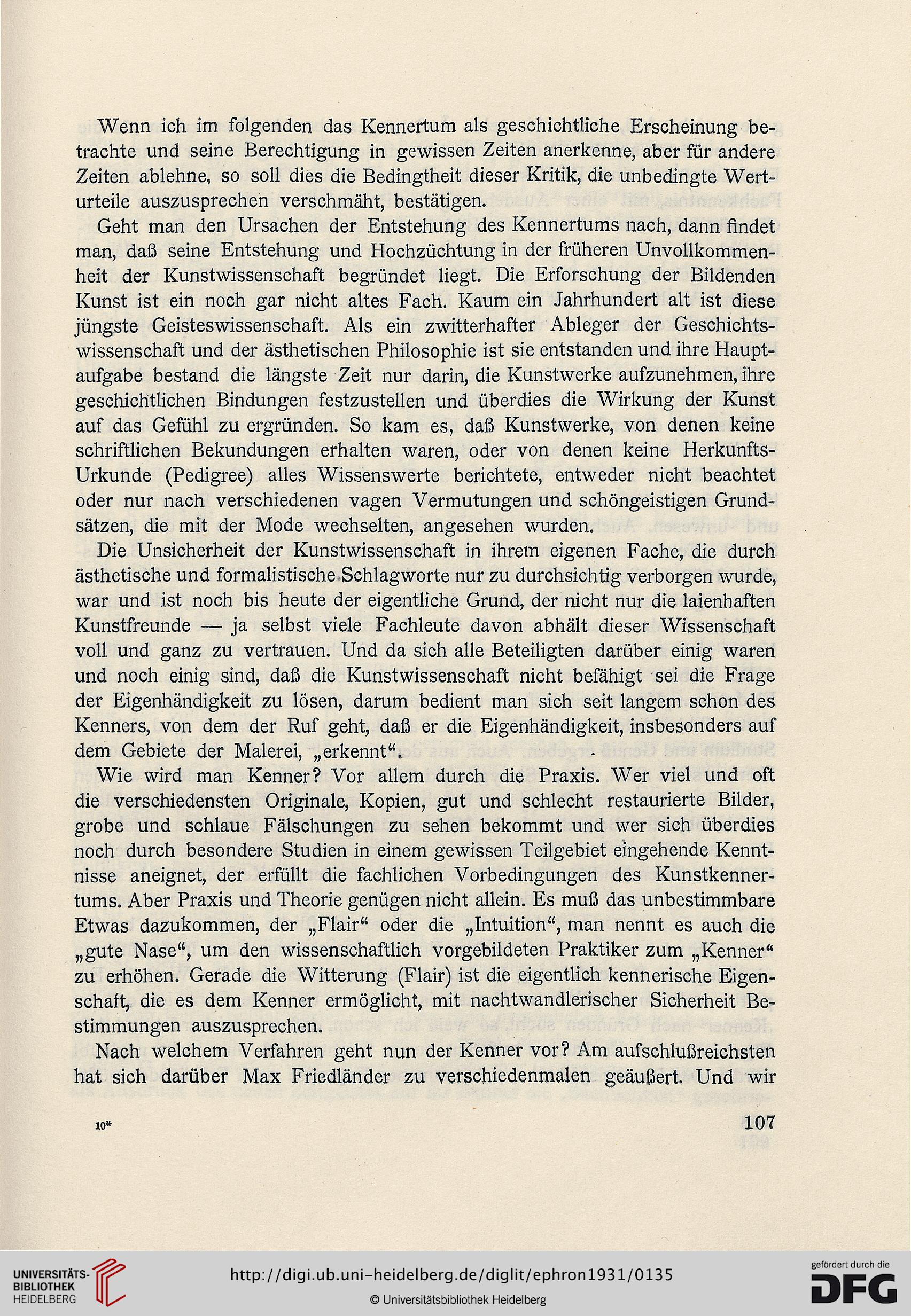Wenn ich im folgenden das Kennertum als geschichtliche Erscheinung be-
trachte und seine Berechtigung in gewissen Zeiten anerkenne, aber für andere
Zeiten ablehne, so soll dies die Bedingtheit dieser Kritik, die unbedingte Wert-
urteile auszusprechen verschmäht, bestätigen.
Geht man den Ursachen der Entstehung des Kennertums nach, dann findet
man, daß seine Entstehung und Hochzüchtung in der früheren Unvollkommen-
heit der Kunstwissenschaft begründet liegt. Die Erforschung der Bildenden
Kunst ist ein noch gar nicht altes Fach. Kaum ein Jahrhundert alt ist diese
jüngste Geisteswissenschaft. Als ein zwitterhafter Ableger der Geschichts-
wissenschaft und der ästhetischen Philosophie ist sie entstanden und ihre Haupt-
aufgabe bestand die längste Zeit nur darin, die Kunstwerke aufzunehmen, ihre
geschichtlichen Bindungen festzustellen und überdies die Wirkung der Kunst
auf das Gefühl zu ergründen. So kam es, daß Kunstwerke, von denen keine
schriftlichen Bekundungen erhalten waren, oder von denen keine Herkunfts-
Urkunde (Pedigree) alles Wissenswerte berichtete, entweder nicht beachtet
oder nur nach verschiedenen vagen Vermutungen und schöngeistigen Grund-
sätzen, die mit der Mode wechselten, angesehen wurden.
Die Unsicherheit der Kunstwissenschaft in ihrem eigenen Fache, die durch
ästhetische und formalistische Schlagworte nur zu durchsichtig verborgen wurde,
war und ist noch bis heute der eigentliche Grund, der nicht nur die laienhaften
Kunstfreunde — ja selbst viele Fachleute davon abhält dieser Wissenschaft
voll und ganz zu vertrauen. Und da sich alle Beteiligten darüber einig waren
und noch einig sind, daß die Kunstwissenschaft nicht befähigt sei die Frage
der Eigenhändigkeit zu lösen, darum bedient man sich seit langem schon des
Kenners, von dem der Ruf geht, daß er die Eigenhändigkeit, insbesonders auf
dem Gebiete der Malerei, „erkennt“.
Wie wird man Kenner? Vor allem durch die Praxis. Wer viel und oft
die verschiedensten Originale, Kopien, gut und schlecht restaurierte Bilder,
grobe und schlaue Fälschungen zu sehen bekommt und wer sich überdies
noch durch besondere Studien in einem gewissen Teilgebiet eingehende Kennt-
nisse aneignet, der erfüllt die fachlichen Vorbedingungen des Kunstkenner-
tums. Aber Praxis und Theorie genügen nicht allein. Es muß das unbestimmbare
Etwas dazukommen, der „Flair“ oder die „Intuition“, man nennt es auch die
„gute Nase“, um den wissenschaftlich vorgebildeten Praktiker zum „Kenner“
zu erhöhen. Gerade die Witterung (Flair) ist die eigentlich kennerische Eigen-
schait, die es dem Kenner ermöglicht, mit nachtwandlerischer Sicherheit Be-
stimmungen auszusprechen.
Nach welchem Verfahren geht nun der Kenner vor? Am aufschlußreichsten
hat sich darüber Max Friedländer zu verschiedenmalen geäußert. Und wir
10*
107
trachte und seine Berechtigung in gewissen Zeiten anerkenne, aber für andere
Zeiten ablehne, so soll dies die Bedingtheit dieser Kritik, die unbedingte Wert-
urteile auszusprechen verschmäht, bestätigen.
Geht man den Ursachen der Entstehung des Kennertums nach, dann findet
man, daß seine Entstehung und Hochzüchtung in der früheren Unvollkommen-
heit der Kunstwissenschaft begründet liegt. Die Erforschung der Bildenden
Kunst ist ein noch gar nicht altes Fach. Kaum ein Jahrhundert alt ist diese
jüngste Geisteswissenschaft. Als ein zwitterhafter Ableger der Geschichts-
wissenschaft und der ästhetischen Philosophie ist sie entstanden und ihre Haupt-
aufgabe bestand die längste Zeit nur darin, die Kunstwerke aufzunehmen, ihre
geschichtlichen Bindungen festzustellen und überdies die Wirkung der Kunst
auf das Gefühl zu ergründen. So kam es, daß Kunstwerke, von denen keine
schriftlichen Bekundungen erhalten waren, oder von denen keine Herkunfts-
Urkunde (Pedigree) alles Wissenswerte berichtete, entweder nicht beachtet
oder nur nach verschiedenen vagen Vermutungen und schöngeistigen Grund-
sätzen, die mit der Mode wechselten, angesehen wurden.
Die Unsicherheit der Kunstwissenschaft in ihrem eigenen Fache, die durch
ästhetische und formalistische Schlagworte nur zu durchsichtig verborgen wurde,
war und ist noch bis heute der eigentliche Grund, der nicht nur die laienhaften
Kunstfreunde — ja selbst viele Fachleute davon abhält dieser Wissenschaft
voll und ganz zu vertrauen. Und da sich alle Beteiligten darüber einig waren
und noch einig sind, daß die Kunstwissenschaft nicht befähigt sei die Frage
der Eigenhändigkeit zu lösen, darum bedient man sich seit langem schon des
Kenners, von dem der Ruf geht, daß er die Eigenhändigkeit, insbesonders auf
dem Gebiete der Malerei, „erkennt“.
Wie wird man Kenner? Vor allem durch die Praxis. Wer viel und oft
die verschiedensten Originale, Kopien, gut und schlecht restaurierte Bilder,
grobe und schlaue Fälschungen zu sehen bekommt und wer sich überdies
noch durch besondere Studien in einem gewissen Teilgebiet eingehende Kennt-
nisse aneignet, der erfüllt die fachlichen Vorbedingungen des Kunstkenner-
tums. Aber Praxis und Theorie genügen nicht allein. Es muß das unbestimmbare
Etwas dazukommen, der „Flair“ oder die „Intuition“, man nennt es auch die
„gute Nase“, um den wissenschaftlich vorgebildeten Praktiker zum „Kenner“
zu erhöhen. Gerade die Witterung (Flair) ist die eigentlich kennerische Eigen-
schait, die es dem Kenner ermöglicht, mit nachtwandlerischer Sicherheit Be-
stimmungen auszusprechen.
Nach welchem Verfahren geht nun der Kenner vor? Am aufschlußreichsten
hat sich darüber Max Friedländer zu verschiedenmalen geäußert. Und wir
10*
107