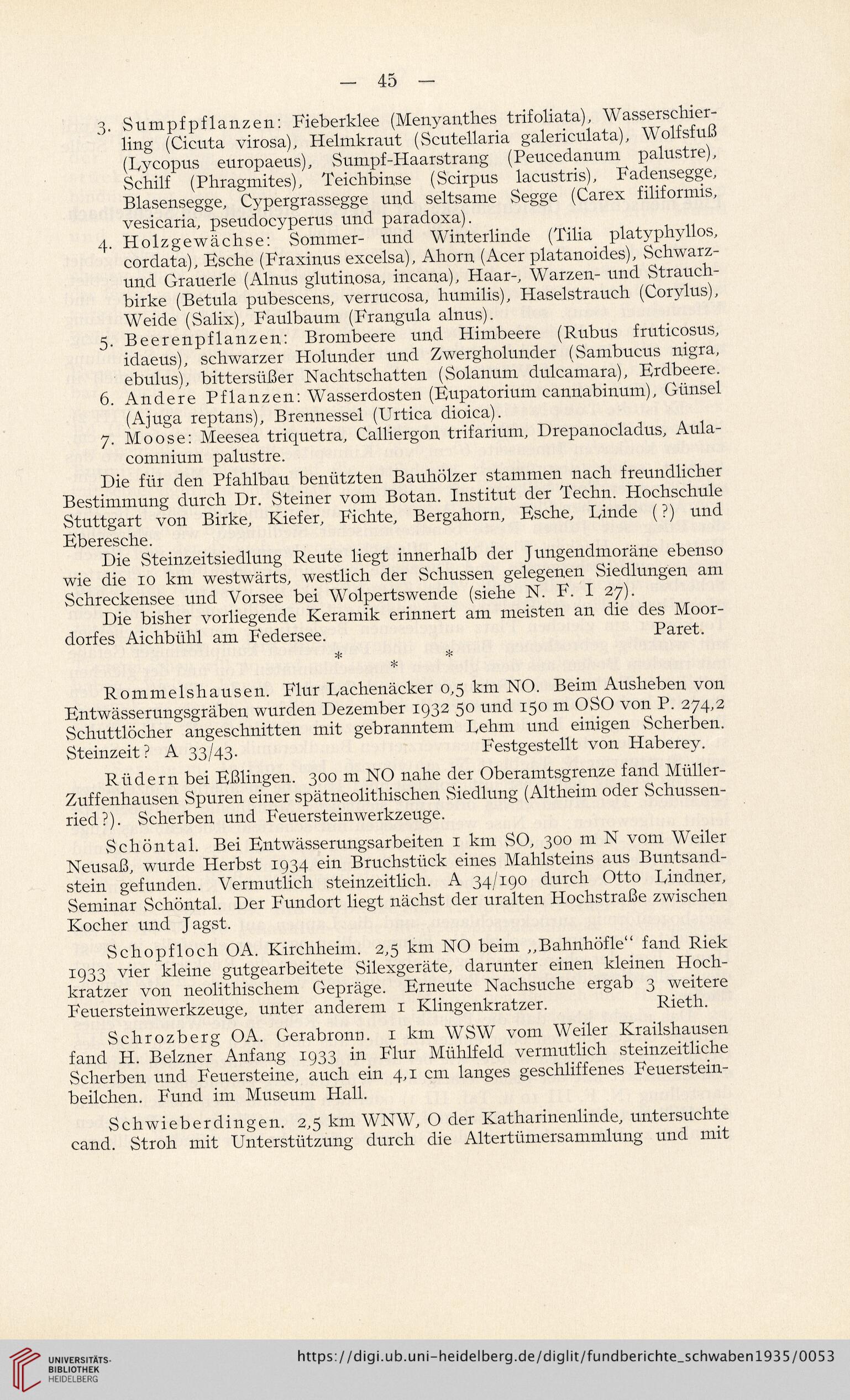45
3- Sumpfpflanzen: Fieberklee (Menyanthes trifoliata), Wasserschier-
ling (Cicuta virosa), Helmkraut (Scutellaria galericulata), Wolfsfuß
(Rycopus europaeus), Sumpf-Haarstrang (Peucedanum palustre),
Schilf (Phragmites), Teichbinse (Scirpus lacustris), Fadensegge,
Blasensegge, Cypergrassegge und seltsame Segge (Carex filiformis,
vesicaria, pseudocyperus und paradoxa).
4. Holzgewächse: Sommer- und Winterlinde (Tilia platyphyllos,
cordata), Esche (Fraxinus excelsa), Ahorn (Acer platanoides), Schwarz-
und Grauerle (Ainus glutinosa, incana), Haar-, Warzen- und Strauch-
birke (Betula pubescens, verrucosa, humilis), Haselstrauch (Corylus),
Weide (Salix), Faulbaum (Frangula alnus).
5. Beerenpflanzen: Brombeere und Himbeere (Rubus fruticosus,
idaeus), schwarzer Holunder und Zwergholunder (Sambucus nigra,
ebulus), bittersüßer Nachtschatten (Solanum dulcamara), Erdbeere.
6. Andere Pflanzen: Wasserdosten (Eupatorium cannabinum), Günsel
(Ajuga reptans), Brennessel (Urtica dioica).
7. Moose: Meesea triquetra, Calliergon trifarium, Drepanocladus, Aula-
comnium palustre.
Die für den Pfahlbau benützten Bauhölzer stammen nach freundlicher
Bestimmung durch Dr. Steiner vom Botan. Institut der Techn. Hochschule
Stuttgart von Birke, Kiefer, Fichte, Bergahorn, Esche, Rinde (?) und
Eberesche.
Die Steinzeitsiedlung Reute liegt innerhalb der Jungendmoräne ebenso
wie die 10 km westwärts, westlich der Schüssen gelegenen Siedlungen am
Schreckensee und Vorsee bei Wolpertswende (siehe N. F. I 27).
Die bisher vorliegende Keramik erinnert am meisten an die des Moor-
dorfes Aichbühl am Federsee. Paret.
*
*
Rommelshausen. Flur Rachenäcker 0,5 km NO. Beim Ausheben von
Entwässerungsgräben wurden Dezember 1932 50 und 150 m OSO von P. 274,2
Schuttlöcher angeschnitten mit gebranntem Rehm und einigen Scherben.
Steinzeit? A 33/43. Festgestellt von Haberey.
Rüdern bei Eßlingen. 300 m NO nahe der Oberamtsgrenze fand Müller-
Zuffenhausen Spuren einer spätneolithischen Siedlung (Altheim oder Schussen-
ried?). Scherben und Feuersteinwerkzeuge.
Schöntal. Bei Entwässerungsarbeiten 1 km SO, 300 m N vom Weiler
Neusäß, wurde Herbst 1934 ein Bruchstück eines Mahlsteins aus Buntsand-
stein gefunden. Vermutlich steinzeitlich. A 34/190 durch Otto Rindner,
Seminar Schöntal. Der Fundort liegt nächst der uralten Hochstraße zwischen
Kocher und Jagst.
Schopfloch OA. Kirchheim. 2,5 km NO beim „Bahnhöfle“ fand Riek
1933 vier kleine gutgearbeitete Silexgeräte, darunter einen kleinen Hoch-
kratzer von neolithischem Gepräge. Erneute Nachsuche ergab 3 weitere
Feuerstein Werkzeuge, unter anderem 1 Klingenkratzer. Rieth.
Schrozberg OA. Gerabronn. 1 km WSW vom Weiler Krailshausen
fand H. Belzner Anfang 1933 in Flur Mühlfeld vermutlich steinzeitliche
Scherben und Feuersteine, auch ein 4,1 cm langes geschliffenes Feuerstein-
beilchen. Fund im Museum Hall.
Schwieberdingen. 2,5 km WNW, O der Katharinenlinde, untersuchte
cand. Stroh mit Unterstützung durch die Altertümersammlung und mit
3- Sumpfpflanzen: Fieberklee (Menyanthes trifoliata), Wasserschier-
ling (Cicuta virosa), Helmkraut (Scutellaria galericulata), Wolfsfuß
(Rycopus europaeus), Sumpf-Haarstrang (Peucedanum palustre),
Schilf (Phragmites), Teichbinse (Scirpus lacustris), Fadensegge,
Blasensegge, Cypergrassegge und seltsame Segge (Carex filiformis,
vesicaria, pseudocyperus und paradoxa).
4. Holzgewächse: Sommer- und Winterlinde (Tilia platyphyllos,
cordata), Esche (Fraxinus excelsa), Ahorn (Acer platanoides), Schwarz-
und Grauerle (Ainus glutinosa, incana), Haar-, Warzen- und Strauch-
birke (Betula pubescens, verrucosa, humilis), Haselstrauch (Corylus),
Weide (Salix), Faulbaum (Frangula alnus).
5. Beerenpflanzen: Brombeere und Himbeere (Rubus fruticosus,
idaeus), schwarzer Holunder und Zwergholunder (Sambucus nigra,
ebulus), bittersüßer Nachtschatten (Solanum dulcamara), Erdbeere.
6. Andere Pflanzen: Wasserdosten (Eupatorium cannabinum), Günsel
(Ajuga reptans), Brennessel (Urtica dioica).
7. Moose: Meesea triquetra, Calliergon trifarium, Drepanocladus, Aula-
comnium palustre.
Die für den Pfahlbau benützten Bauhölzer stammen nach freundlicher
Bestimmung durch Dr. Steiner vom Botan. Institut der Techn. Hochschule
Stuttgart von Birke, Kiefer, Fichte, Bergahorn, Esche, Rinde (?) und
Eberesche.
Die Steinzeitsiedlung Reute liegt innerhalb der Jungendmoräne ebenso
wie die 10 km westwärts, westlich der Schüssen gelegenen Siedlungen am
Schreckensee und Vorsee bei Wolpertswende (siehe N. F. I 27).
Die bisher vorliegende Keramik erinnert am meisten an die des Moor-
dorfes Aichbühl am Federsee. Paret.
*
*
Rommelshausen. Flur Rachenäcker 0,5 km NO. Beim Ausheben von
Entwässerungsgräben wurden Dezember 1932 50 und 150 m OSO von P. 274,2
Schuttlöcher angeschnitten mit gebranntem Rehm und einigen Scherben.
Steinzeit? A 33/43. Festgestellt von Haberey.
Rüdern bei Eßlingen. 300 m NO nahe der Oberamtsgrenze fand Müller-
Zuffenhausen Spuren einer spätneolithischen Siedlung (Altheim oder Schussen-
ried?). Scherben und Feuersteinwerkzeuge.
Schöntal. Bei Entwässerungsarbeiten 1 km SO, 300 m N vom Weiler
Neusäß, wurde Herbst 1934 ein Bruchstück eines Mahlsteins aus Buntsand-
stein gefunden. Vermutlich steinzeitlich. A 34/190 durch Otto Rindner,
Seminar Schöntal. Der Fundort liegt nächst der uralten Hochstraße zwischen
Kocher und Jagst.
Schopfloch OA. Kirchheim. 2,5 km NO beim „Bahnhöfle“ fand Riek
1933 vier kleine gutgearbeitete Silexgeräte, darunter einen kleinen Hoch-
kratzer von neolithischem Gepräge. Erneute Nachsuche ergab 3 weitere
Feuerstein Werkzeuge, unter anderem 1 Klingenkratzer. Rieth.
Schrozberg OA. Gerabronn. 1 km WSW vom Weiler Krailshausen
fand H. Belzner Anfang 1933 in Flur Mühlfeld vermutlich steinzeitliche
Scherben und Feuersteine, auch ein 4,1 cm langes geschliffenes Feuerstein-
beilchen. Fund im Museum Hall.
Schwieberdingen. 2,5 km WNW, O der Katharinenlinde, untersuchte
cand. Stroh mit Unterstützung durch die Altertümersammlung und mit