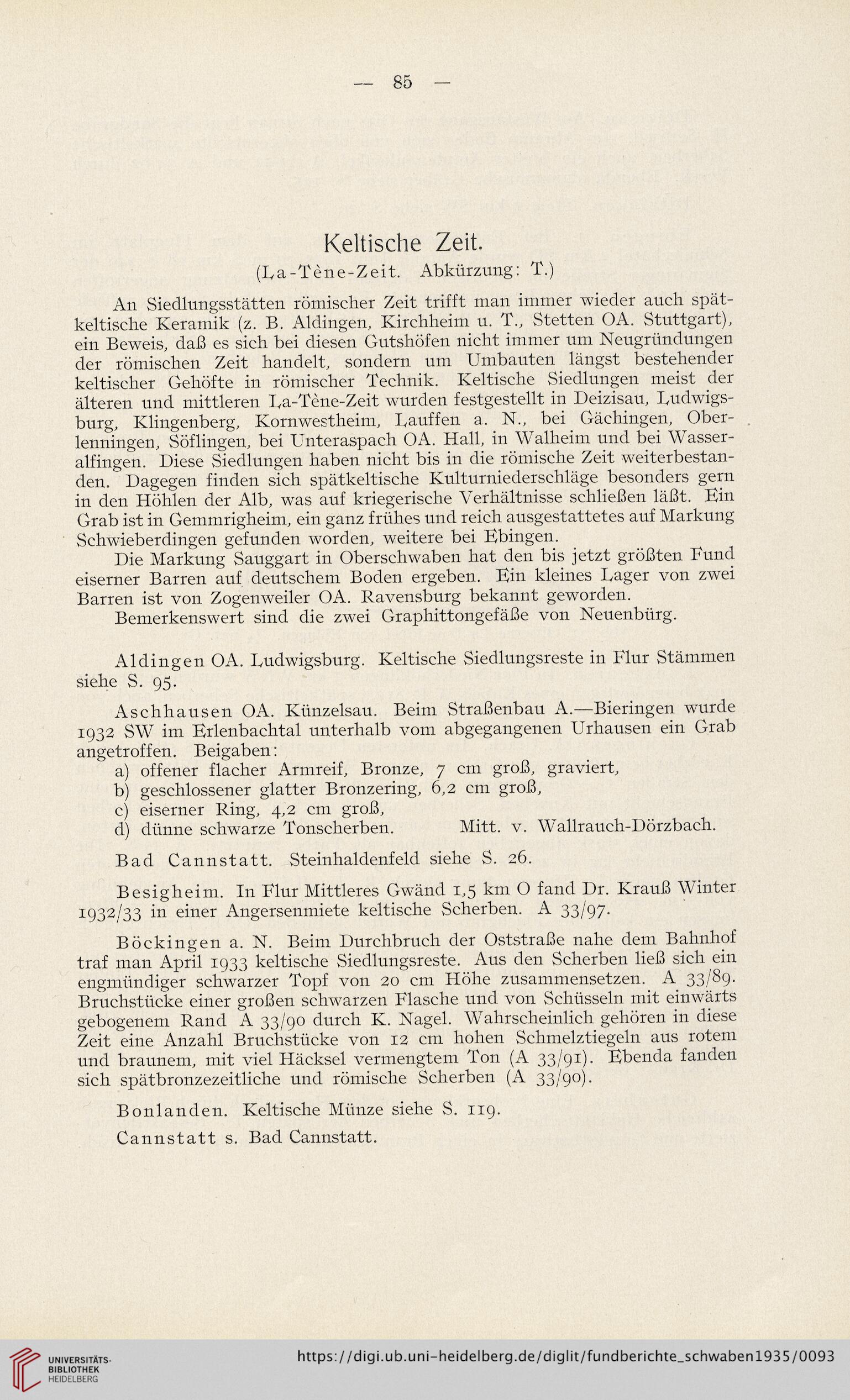85
Keltische Zeit.
(La-Tene-Zeit. Abkürzung: T.)
An Siedlungsstätten römischer Zeit trifft man immer wieder auch spät-
keltische Keramik (z. B. Aldingen, Kirchheim u. T., Stetten OA. Stuttgart),
ein Beweis, daß es sich bei diesen Gutshöfen nicht immer um Neugründungen
der römischen Zeit handelt, sondern um Umbauten längst bestehender
keltischer Gehöfte in römischer Technik. Keltische Siedlungen meist der
älteren und mittleren La-Tene-Zeit wurden festgestellt in Deizisau, Ludwigs-
burg, Klingenberg, Kornwestheim, Lauff en a. N., bei Gächingen, Ober-
lenningen, Söflingen, bei Unteraspach OA. Hall, in Walheim und bei Wasser-
alfingen. Diese Siedlungen haben nicht bis in die römische Zeit weiterbestan-
den. Dagegen finden sich spätkeltische Kulturniederschläge besonders gern
in den Höhlen der Alb, was auf kriegerische Verhältnisse schließen läßt. Ein
Grab ist in Gemmrigheim, ein ganz frühes und reich ausgestattetes auf Markung
Schwieberdingen gefunden worden, weitere bei Ebingen.
Die Markung Sauggart in Oberschwaben hat den bis jetzt größten Fund
eiserner Barren auf deutschem Boden ergeben. Ein kleines Lager von zwei
Barren ist von Zogenweiler OA. Ravensburg bekannt geworden.
Bemerkenswert sind die zwei Graphittongefäße von Neuenbürg.
Aldingen OA. Ludwigsburg. Keltische Siedlungsreste in Flur Stämmen
siehe S. 95.
Aschhausen OA. Künzelsau. Beim Straßenbau A.—Bieringen wurde
1932 SW im Erlenbachtal unterhalb vom abgegangenen Urhausen ein Grab
angetroffen. Beigaben:
a) offener flacher Armreif, Bronze, 7 cm groß, graviert,
b) geschlossener glatter Bronzering, 6,2 cm groß,
c) eiserner Ring, 4,2 cm groß,
d) dünne schwarze Tonscherben. Mitt. v. Wallrauch-Dörzbach.
Bad Cannstatt. Steinhaldenfeld siehe S. 26.
Besigheim. In Flur Mittleres Gwänd 1,5 km O fand Dr. Krauß Winter
1932/33 in einer Angersenmiete keltische Scherben. A 33/97.
Böckingen a. N. Beim Durchbruch der Oststraße nahe dem Bahnhof
traf man April 1933 keltische Siedlungsreste. Aus den Scherben ließ sich ein
engmündiger schwarzer Topf von 20 cm Höhe zusammensetzen. A 33/89.
Bruchstücke einer großen schwarzen Flasche und von Schüsseln mit einwärts
gebogenem Rand A 33/90 durch K. Nagel. Wahrscheinlich gehören in diese
Zeit eine Anzahl Bruchstücke von 12 cm hohen Schmelztiegeln aus rotem
und braunem, mit viel Häcksel vermengtem Ton (A 33/91). Ebenda fanden
sich spätbronzezeitliche und römische Scherben (A 33/90).
Bonlanden. Keltische Münze siehe S. 119.
Cannstatt s. Bad Cannstatt.
Keltische Zeit.
(La-Tene-Zeit. Abkürzung: T.)
An Siedlungsstätten römischer Zeit trifft man immer wieder auch spät-
keltische Keramik (z. B. Aldingen, Kirchheim u. T., Stetten OA. Stuttgart),
ein Beweis, daß es sich bei diesen Gutshöfen nicht immer um Neugründungen
der römischen Zeit handelt, sondern um Umbauten längst bestehender
keltischer Gehöfte in römischer Technik. Keltische Siedlungen meist der
älteren und mittleren La-Tene-Zeit wurden festgestellt in Deizisau, Ludwigs-
burg, Klingenberg, Kornwestheim, Lauff en a. N., bei Gächingen, Ober-
lenningen, Söflingen, bei Unteraspach OA. Hall, in Walheim und bei Wasser-
alfingen. Diese Siedlungen haben nicht bis in die römische Zeit weiterbestan-
den. Dagegen finden sich spätkeltische Kulturniederschläge besonders gern
in den Höhlen der Alb, was auf kriegerische Verhältnisse schließen läßt. Ein
Grab ist in Gemmrigheim, ein ganz frühes und reich ausgestattetes auf Markung
Schwieberdingen gefunden worden, weitere bei Ebingen.
Die Markung Sauggart in Oberschwaben hat den bis jetzt größten Fund
eiserner Barren auf deutschem Boden ergeben. Ein kleines Lager von zwei
Barren ist von Zogenweiler OA. Ravensburg bekannt geworden.
Bemerkenswert sind die zwei Graphittongefäße von Neuenbürg.
Aldingen OA. Ludwigsburg. Keltische Siedlungsreste in Flur Stämmen
siehe S. 95.
Aschhausen OA. Künzelsau. Beim Straßenbau A.—Bieringen wurde
1932 SW im Erlenbachtal unterhalb vom abgegangenen Urhausen ein Grab
angetroffen. Beigaben:
a) offener flacher Armreif, Bronze, 7 cm groß, graviert,
b) geschlossener glatter Bronzering, 6,2 cm groß,
c) eiserner Ring, 4,2 cm groß,
d) dünne schwarze Tonscherben. Mitt. v. Wallrauch-Dörzbach.
Bad Cannstatt. Steinhaldenfeld siehe S. 26.
Besigheim. In Flur Mittleres Gwänd 1,5 km O fand Dr. Krauß Winter
1932/33 in einer Angersenmiete keltische Scherben. A 33/97.
Böckingen a. N. Beim Durchbruch der Oststraße nahe dem Bahnhof
traf man April 1933 keltische Siedlungsreste. Aus den Scherben ließ sich ein
engmündiger schwarzer Topf von 20 cm Höhe zusammensetzen. A 33/89.
Bruchstücke einer großen schwarzen Flasche und von Schüsseln mit einwärts
gebogenem Rand A 33/90 durch K. Nagel. Wahrscheinlich gehören in diese
Zeit eine Anzahl Bruchstücke von 12 cm hohen Schmelztiegeln aus rotem
und braunem, mit viel Häcksel vermengtem Ton (A 33/91). Ebenda fanden
sich spätbronzezeitliche und römische Scherben (A 33/90).
Bonlanden. Keltische Münze siehe S. 119.
Cannstatt s. Bad Cannstatt.