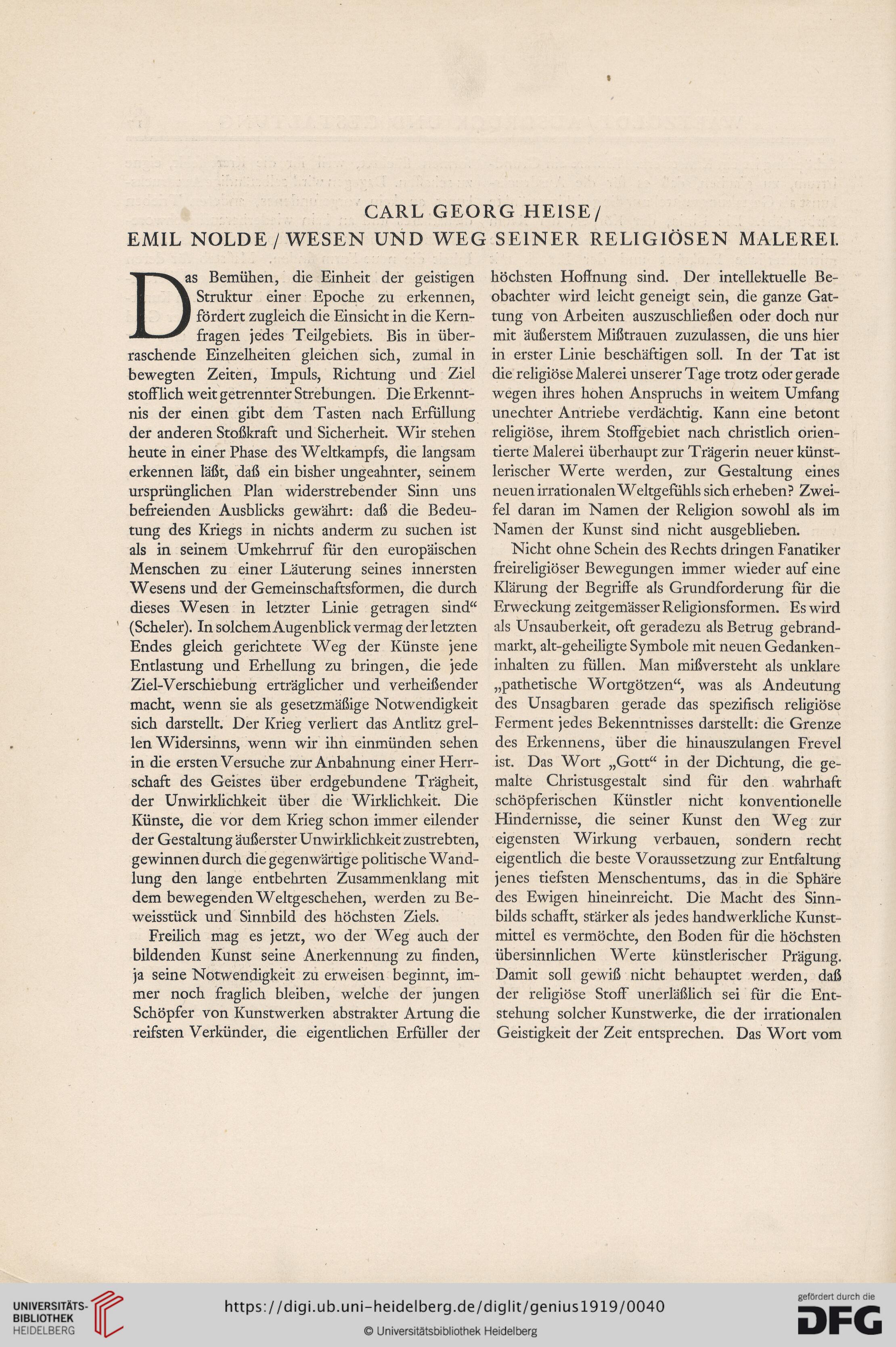CARL GEORG HEISE/
EMIL NOLDE/WESEN UND WEG SEINER RELIGIÖSEN MALEREI.
Das Bemühen, die Einheit der geistigen
k Struktur einer Epoche zu erkennen,
| fördert zugleich die Einsicht in die Kern-
fragen jedes Teilgebiets. Bis in über-
raschende Einzelheiten gleichen sich, zumal in
bewegten Zeiten, Impuls, Richtung und Ziel
stofflich weit getrennter Strebungen. Die Erkennt-
nis der einen gibt dem Tasten nach Erfüllung
der anderen Stoßkraft und Sicherheit. Wir stehen
heute in einer Phase des Weltkampfs, die langsam
erkennen läßt, daß ein bisher ungeahnter, seinem
ursprünglichen Plan widerstrebender Sinn uns
befreienden Ausblicks gewährt: daß die Bedeu-
tung des Kriegs in nichts anderm zu suchen ist
als in seinem Umkehrruf für den europäischen
Menschen zu einer Läuterung seines innersten
Wesens und der Gemeinschaftsformen, die durch
dieses Wesen in letzter Linie getragen sind“
(Scheier). In solchem Augenblick vermag der letzten
Endes gleich gerichtete Weg der Künste jene
Entlastung und Erhellung zu bringen, die jede
Ziel-Verschiebung erträglicher und verheißender
macht, wenn sie als gesetzmäßige Notwendigkeit
sich darstellt. Der Krieg verliert das Antlitz grel-
len Widersinns, wenn wir ihn einmünden sehen
in die ersten Versuche zur Anbahnung einer Herr-
schaft des Geistes über erdgebundene Trägheit,
der Unwirklichkeit über die Wirklichkeit. Die
Künste, die vor dem Krieg schon immer eilender
der Gestaltung äußerster Unwirklichkeit zustrebten,
gewinnen durch die gegenwärtige politische Wand-
lung den lange entbehrten Zusammenklang mit
dem bewegenden Weltgeschehen, werden zu Be-
weisstück und Sinnbild des höchsten Ziels.
Freilich mag es jetzt, wo der Weg auch der
bildenden Kunst seine Anerkennung zu finden,
ja seine Notwendigkeit zu erweisen beginnt, im-
mer noch fraglich bleiben, welche der jungen
Schöpfer von Kunstwerken abstrakter Artung die
reifsten Verkünder, die eigentlichen Erfüllet der
höchsten Hoffnung sind. Der intellektuelle Be-
obachter wird leicht geneigt sein, die ganze Gat-
tung von Arbeiten auszuschließen oder doch nur
mit äußerstem Mißtrauen zuzulassen, die uns hier
in erster Linie beschäftigen soll. In der Tat ist
die religiöse Malerei unserer Tage trotz oder gerade
wegen ihres hohen Anspruchs in weitem Umfang
unechter Antriebe verdächtig. Kann eine betont
religiöse, ihrem Stoffgebiet nach christlich orien-
tierte Malerei überhaupt zur Trägerin neuer künst-
lerischer Werte werden, zur Gestaltung eines
neuen irrationalen Weltgefühls sich erheben? Zwei-
fel daran im Namen der Religion sowohl als im
Namen der Kunst sind nicht ausgeblieben.
Nicht ohne Schein des Rechts dringen Fanatiker
freireligiöser Bewegungen immer wieder auf eine
Klärung der Begriffe als Grundforderung für die
Erweckung zeitgemässer Religionsformen. Es wird
als Unsauberkeit, oft geradezu als Betrug gebrand-
markt, alt-geheiligte Symbole mit neuen Gedanken-
inhalten zu füllen. Man mißversteht als unklare
„pathetische Wortgötzen“, was als Andeutung
des Unsagbaren gerade das spezifisch religiöse
Ferment jedes Bekenntnisses darstellt: die Grenze
des Erkennens, über die hinauszulangen Frevel
ist. Das Wort „Gott“ in der Dichtung, die ge-
malte Christusgestalt sind für den wahrhaft
schöpferischen Künstler nicht konventionelle
Hindernisse, die seiner Kunst den Weg zur
eigensten Wirkung verbauen, sondern recht
eigentlich die beste Voraussetzung zur Entfaltung
jenes tiefsten Menschentums, das in die Sphäre
des Ewigen hineinreicht. Die Macht des Sinn-
bilds schafft, stärker als jedes handwerkliche Kunst-
mittel es vermöchte, den Boden für die höchsten
übersinnlichen Werte künstlerischer Prägung.
Damit soll gewiß nicht behauptet werden, daß
der religiöse Stoff unerläßlich sei für die Ent-
stehung solcher Kunstwerke, die der irrationalen
Geistigkeit der Zeit entsprechen. Das Wort vom
EMIL NOLDE/WESEN UND WEG SEINER RELIGIÖSEN MALEREI.
Das Bemühen, die Einheit der geistigen
k Struktur einer Epoche zu erkennen,
| fördert zugleich die Einsicht in die Kern-
fragen jedes Teilgebiets. Bis in über-
raschende Einzelheiten gleichen sich, zumal in
bewegten Zeiten, Impuls, Richtung und Ziel
stofflich weit getrennter Strebungen. Die Erkennt-
nis der einen gibt dem Tasten nach Erfüllung
der anderen Stoßkraft und Sicherheit. Wir stehen
heute in einer Phase des Weltkampfs, die langsam
erkennen läßt, daß ein bisher ungeahnter, seinem
ursprünglichen Plan widerstrebender Sinn uns
befreienden Ausblicks gewährt: daß die Bedeu-
tung des Kriegs in nichts anderm zu suchen ist
als in seinem Umkehrruf für den europäischen
Menschen zu einer Läuterung seines innersten
Wesens und der Gemeinschaftsformen, die durch
dieses Wesen in letzter Linie getragen sind“
(Scheier). In solchem Augenblick vermag der letzten
Endes gleich gerichtete Weg der Künste jene
Entlastung und Erhellung zu bringen, die jede
Ziel-Verschiebung erträglicher und verheißender
macht, wenn sie als gesetzmäßige Notwendigkeit
sich darstellt. Der Krieg verliert das Antlitz grel-
len Widersinns, wenn wir ihn einmünden sehen
in die ersten Versuche zur Anbahnung einer Herr-
schaft des Geistes über erdgebundene Trägheit,
der Unwirklichkeit über die Wirklichkeit. Die
Künste, die vor dem Krieg schon immer eilender
der Gestaltung äußerster Unwirklichkeit zustrebten,
gewinnen durch die gegenwärtige politische Wand-
lung den lange entbehrten Zusammenklang mit
dem bewegenden Weltgeschehen, werden zu Be-
weisstück und Sinnbild des höchsten Ziels.
Freilich mag es jetzt, wo der Weg auch der
bildenden Kunst seine Anerkennung zu finden,
ja seine Notwendigkeit zu erweisen beginnt, im-
mer noch fraglich bleiben, welche der jungen
Schöpfer von Kunstwerken abstrakter Artung die
reifsten Verkünder, die eigentlichen Erfüllet der
höchsten Hoffnung sind. Der intellektuelle Be-
obachter wird leicht geneigt sein, die ganze Gat-
tung von Arbeiten auszuschließen oder doch nur
mit äußerstem Mißtrauen zuzulassen, die uns hier
in erster Linie beschäftigen soll. In der Tat ist
die religiöse Malerei unserer Tage trotz oder gerade
wegen ihres hohen Anspruchs in weitem Umfang
unechter Antriebe verdächtig. Kann eine betont
religiöse, ihrem Stoffgebiet nach christlich orien-
tierte Malerei überhaupt zur Trägerin neuer künst-
lerischer Werte werden, zur Gestaltung eines
neuen irrationalen Weltgefühls sich erheben? Zwei-
fel daran im Namen der Religion sowohl als im
Namen der Kunst sind nicht ausgeblieben.
Nicht ohne Schein des Rechts dringen Fanatiker
freireligiöser Bewegungen immer wieder auf eine
Klärung der Begriffe als Grundforderung für die
Erweckung zeitgemässer Religionsformen. Es wird
als Unsauberkeit, oft geradezu als Betrug gebrand-
markt, alt-geheiligte Symbole mit neuen Gedanken-
inhalten zu füllen. Man mißversteht als unklare
„pathetische Wortgötzen“, was als Andeutung
des Unsagbaren gerade das spezifisch religiöse
Ferment jedes Bekenntnisses darstellt: die Grenze
des Erkennens, über die hinauszulangen Frevel
ist. Das Wort „Gott“ in der Dichtung, die ge-
malte Christusgestalt sind für den wahrhaft
schöpferischen Künstler nicht konventionelle
Hindernisse, die seiner Kunst den Weg zur
eigensten Wirkung verbauen, sondern recht
eigentlich die beste Voraussetzung zur Entfaltung
jenes tiefsten Menschentums, das in die Sphäre
des Ewigen hineinreicht. Die Macht des Sinn-
bilds schafft, stärker als jedes handwerkliche Kunst-
mittel es vermöchte, den Boden für die höchsten
übersinnlichen Werte künstlerischer Prägung.
Damit soll gewiß nicht behauptet werden, daß
der religiöse Stoff unerläßlich sei für die Ent-
stehung solcher Kunstwerke, die der irrationalen
Geistigkeit der Zeit entsprechen. Das Wort vom