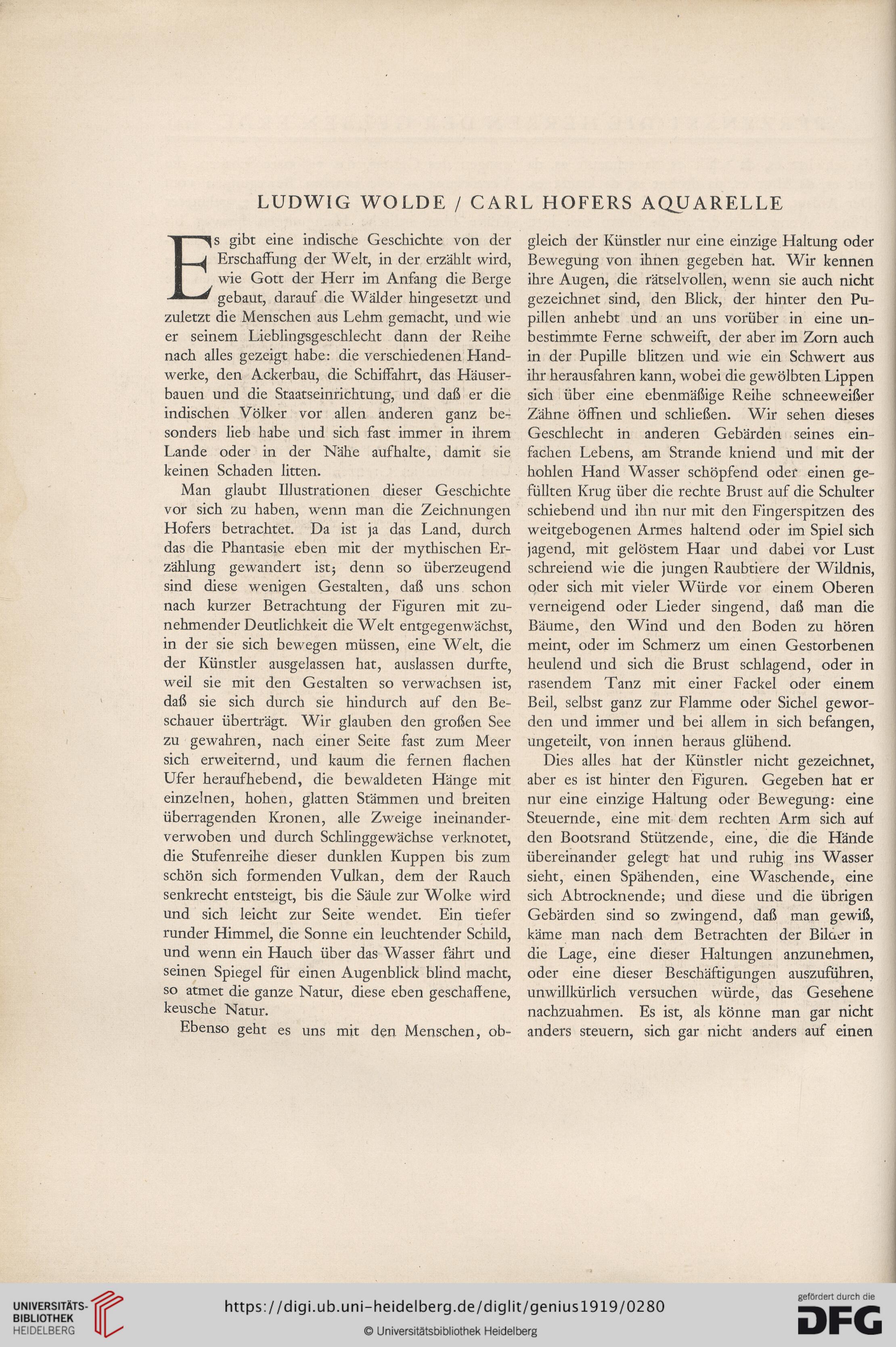LUDWIG WOLDE / CARL HOFERS AQUARELLE
s gibt eine indische Geschichte von der
Erschaffung der Welt, in der erzählt wird,
wie Gott der Herr im Anfang die Berge
gebaut, darauf die Wälder hingesetzt und
zuletzt die Menschen aus Lehm gemacht, und wie
er seinem Lieblingsgeschlecht dann der Reihe
nach alles gezeigt habe: die verschiedenen Hand-
werke, den Ackerbau, die Schiffahrt, das Häuser-
bauen und die Staatseinrichtung, und daß er die
indischen Völker vor allen anderen ganz be-
sonders lieb habe und sich fast immer in ihrem
Lande oder in der Nähe aufhalte, damit sie
keinen Schaden litten.
Man glaubt Illustrationen dieser Geschichte
vor sich zu haben, wenn man die Zeichnungen
Hofers betrachtet. Da ist ja das Land, durch
das die Phantasie eben mit der mythischen Er-
zählung gewandert ist; denn so überzeugend
sind diese wenigen Gestalten, daß uns schon
nach kurzer Betrachtung der Figuren mit zu-
nehmender Deutlichkeit die Welt entgegenwächst,
in der sie sich bewegen müssen, eine Welt, die
der Künstler ausgelassen hat, auslassen durfte,
weil sie mit den Gestalten so verwachsen ist,
daß sie sich durch sie hindurch auf den Be-
schauer überträgt. Wir glauben den großen See
zu gewahren, nach einer Seite fast zum Meer
sich erweiternd, und kaum die fernen flachen
Ufer heraufhebend, die bewaldeten Hänge mit
einzelnen, hohen, glatten Stämmen und breiten
überragenden Kronen, alle Zweige ineinander-
verwoben und durch Schlinggewächse verknotet,
die Stufenreihe dieser dunklen Kuppen bis zum
schön sich formenden Vulkan, dem der Rauch
senkrecht entsteigt, bis die Säule zur Wolke wird
und sich leicht zur Seite wendet. Ein tiefer
runder Himmel, die Sonne ein leuchtender Schild,
und wenn ein Hauch über das Wasser fährt und
seinen Spiegel für einen Augenblick blind macht,
so atmet die ganze Natur, diese eben geschaffene,
keusche Natur.
Ebenso geht es uns mit den Menschen, ob-
gleich der Künstler nur eine einzige Haltung oder
Bewegung von ihnen gegeben hat. Wir kennen
ihre Augen, die rätselvollen, wenn sie auch nicht
gezeichnet sind, den Blick, der hinter den Pu-
pillen anhebt und an uns vorüber in eine un-
bestimmte Ferne schweift, der aber im Zorn auch
in der Pupille blitzen und wie ein Schwert aus
ihr herausfahren kann, wobei die gewölbten Lippen
sich über eine ebenmäßige Reihe schneeweißer
Zähne öffnen und schließen. Wir sehen dieses
Geschlecht in anderen Gebärden seines ein-
fachen Lebens, am Strande kniend und mit der
hohlen Hand Wasser schöpfend oder einen ge-
füllten Krug über die rechte Brust auf die Schulter
schiebend und ihn nur mit den Fingerspitzen des
weitgebogenen Armes haltend oder im Spiel sich
jagend, mit gelöstem Haar und dabei vor Lust
schreiend wie die jungen Raubtiere der Wildnis,
oder sich mit vieler Würde vor einem Oberen
verneigend oder Lieder singend, daß man die
Bäume, den Wind und den Boden zu hören
meint, oder im Schmerz um einen Gestorbenen
heulend und sich die Brust schlagend, oder in
rasendem Tanz mit einer Fackel oder einem
Beil, selbst ganz zur Flamme oder Sichel gewor-
den und immer und bei allem in sich befangen,
ungeteilt, von innen heraus glühend.
Dies alles hat der Künstler nicht gezeichnet,
aber es ist hinter den Figuren. Gegeben hat er
nur eine einzige Haltung oder Bewegung: eine
Steuernde, eine mit dem rechten Arm sich auf
den Bootsrand Stützende, eine, die die Hände
übereinander gelegt hat und ruhig ins Wasser
sieht, einen Spähenden, eine Waschende, eine
sich Abtrocknende; und diese und die übrigen
Gebärden sind so zwingend, daß man gewiß,
käme man nach dem Betrachten der Biluer in
die Lage, eine dieser Haltungen anzunehmen,
oder eine dieser Beschäftigungen auszuführen,
unwillkürlich versuchen würde, das Gesehene
nachzuahmen. Es ist, als könne man gar nicht
anders steuern, sich gar nicht anders auf einen
s gibt eine indische Geschichte von der
Erschaffung der Welt, in der erzählt wird,
wie Gott der Herr im Anfang die Berge
gebaut, darauf die Wälder hingesetzt und
zuletzt die Menschen aus Lehm gemacht, und wie
er seinem Lieblingsgeschlecht dann der Reihe
nach alles gezeigt habe: die verschiedenen Hand-
werke, den Ackerbau, die Schiffahrt, das Häuser-
bauen und die Staatseinrichtung, und daß er die
indischen Völker vor allen anderen ganz be-
sonders lieb habe und sich fast immer in ihrem
Lande oder in der Nähe aufhalte, damit sie
keinen Schaden litten.
Man glaubt Illustrationen dieser Geschichte
vor sich zu haben, wenn man die Zeichnungen
Hofers betrachtet. Da ist ja das Land, durch
das die Phantasie eben mit der mythischen Er-
zählung gewandert ist; denn so überzeugend
sind diese wenigen Gestalten, daß uns schon
nach kurzer Betrachtung der Figuren mit zu-
nehmender Deutlichkeit die Welt entgegenwächst,
in der sie sich bewegen müssen, eine Welt, die
der Künstler ausgelassen hat, auslassen durfte,
weil sie mit den Gestalten so verwachsen ist,
daß sie sich durch sie hindurch auf den Be-
schauer überträgt. Wir glauben den großen See
zu gewahren, nach einer Seite fast zum Meer
sich erweiternd, und kaum die fernen flachen
Ufer heraufhebend, die bewaldeten Hänge mit
einzelnen, hohen, glatten Stämmen und breiten
überragenden Kronen, alle Zweige ineinander-
verwoben und durch Schlinggewächse verknotet,
die Stufenreihe dieser dunklen Kuppen bis zum
schön sich formenden Vulkan, dem der Rauch
senkrecht entsteigt, bis die Säule zur Wolke wird
und sich leicht zur Seite wendet. Ein tiefer
runder Himmel, die Sonne ein leuchtender Schild,
und wenn ein Hauch über das Wasser fährt und
seinen Spiegel für einen Augenblick blind macht,
so atmet die ganze Natur, diese eben geschaffene,
keusche Natur.
Ebenso geht es uns mit den Menschen, ob-
gleich der Künstler nur eine einzige Haltung oder
Bewegung von ihnen gegeben hat. Wir kennen
ihre Augen, die rätselvollen, wenn sie auch nicht
gezeichnet sind, den Blick, der hinter den Pu-
pillen anhebt und an uns vorüber in eine un-
bestimmte Ferne schweift, der aber im Zorn auch
in der Pupille blitzen und wie ein Schwert aus
ihr herausfahren kann, wobei die gewölbten Lippen
sich über eine ebenmäßige Reihe schneeweißer
Zähne öffnen und schließen. Wir sehen dieses
Geschlecht in anderen Gebärden seines ein-
fachen Lebens, am Strande kniend und mit der
hohlen Hand Wasser schöpfend oder einen ge-
füllten Krug über die rechte Brust auf die Schulter
schiebend und ihn nur mit den Fingerspitzen des
weitgebogenen Armes haltend oder im Spiel sich
jagend, mit gelöstem Haar und dabei vor Lust
schreiend wie die jungen Raubtiere der Wildnis,
oder sich mit vieler Würde vor einem Oberen
verneigend oder Lieder singend, daß man die
Bäume, den Wind und den Boden zu hören
meint, oder im Schmerz um einen Gestorbenen
heulend und sich die Brust schlagend, oder in
rasendem Tanz mit einer Fackel oder einem
Beil, selbst ganz zur Flamme oder Sichel gewor-
den und immer und bei allem in sich befangen,
ungeteilt, von innen heraus glühend.
Dies alles hat der Künstler nicht gezeichnet,
aber es ist hinter den Figuren. Gegeben hat er
nur eine einzige Haltung oder Bewegung: eine
Steuernde, eine mit dem rechten Arm sich auf
den Bootsrand Stützende, eine, die die Hände
übereinander gelegt hat und ruhig ins Wasser
sieht, einen Spähenden, eine Waschende, eine
sich Abtrocknende; und diese und die übrigen
Gebärden sind so zwingend, daß man gewiß,
käme man nach dem Betrachten der Biluer in
die Lage, eine dieser Haltungen anzunehmen,
oder eine dieser Beschäftigungen auszuführen,
unwillkürlich versuchen würde, das Gesehene
nachzuahmen. Es ist, als könne man gar nicht
anders steuern, sich gar nicht anders auf einen