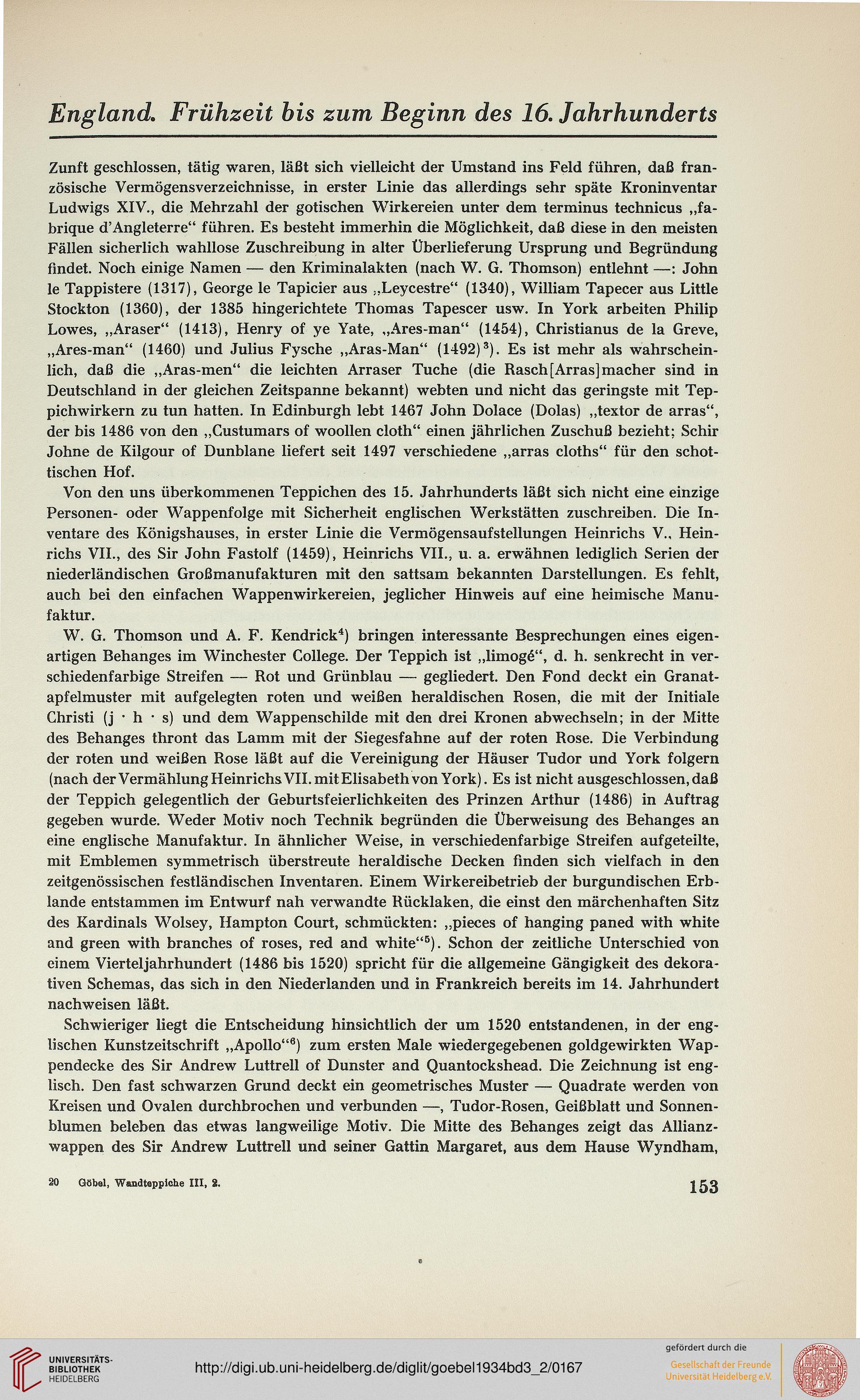England. Frühzeit bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts
Zunft geschlossen, tätig waren, läßt sich vielleicht der Umstand ins Feld führen, daß fran-
zösische Vermögensverzeichnisse, in erster Linie das allerdings sehr späte Kroninventar
Ludwigs XIV., die Mehrzahl der gotischen Wirkereien unter dem terminus technicus „fa-
brique d'Angleterre" führen. Es besteht immerhin die Möglichkeit, daß diese in den meisten
Fällen sicherlich wahllose Zuschreibung in alter Überlieferung Ursprung und Begründung
findet. Noch einige Namen — den Kriminalakten (nach W. G. Thomson) entlehnt —: John
le Tappistere (1317), George le Tapicier aus „Leycestre" (1340), William Tapecer aus Little
Stockton (1360), der 1385 hingerichtete Thomas Tapescer usw. In York arbeiten Philip
Lowes, „Araser" (1413), Henry of ye Yate, „Ares-man" (1454), Christianus de la Greve,
„Ares-man" (1460) und Julius Fysche „Aras-Man" (1492)3). Es ist mehr als wahrschein-
lich, daß die ,,Aras-men" die leichten Arraser Tuche (die Rasch [Arras]macher sind in
Deutschland in der gleichen Zeitspanne bekannt) webten und nicht das geringste mit Tep-
pichwirkern zu tun hatten. In Edinburgh lebt 1467 John Dolace (Dolas) „textor de arras",
der bis 1486 von den „Custumars of woollen cloth" einen jährlichen Zuschuß bezieht: Schir
Johne de Kilgour of Dunblane liefert seit 1497 verschiedene „arras cloths" für den schot-
tischen Hof.
Von den uns überkommenen Teppichen des 15. Jahrhunderts läßt sich nicht eine einzige
Personen- oder Wappenfolge mit Sicherheit englischen Werkstätten zuschreiben. Die In-
ventare des Königshauses, in erster Linie die Vermögensaufstellungen Heinrichs V., Hein-
richs VII., des Sir John Fastolf (1459), Heinrichs VII., u. a. erwähnen lediglich Serien der
niederländischen Großmanufakturen mit den sattsam bekannten Darstellungen. Es fehlt,
auch bei den einfachen Wappenwirkereien, jeglicher Hinweis auf eine heimische Manu-
faktur.
W. G. Thomson und A. F. Kendrick4) bringen interessante Besprechungen eines eigen-
artigen Behanges im Winchester College. Der Teppich ist ,,limog£", d. h. senkrecht in ver-
schiedenfarbige Streifen — Rot und Grünblau — gegliedert. Den Fond deckt ein Granat-
apfelmuster mit aufgelegten roten und weißen heraldischen Rosen, die mit der Initiale
Christi (j ■ h ■ s) und dem Wappenschilde mit den drei Kronen abwechseln; in der Mitte
des Behanges thront das Lamm mit der Siegesfahne auf der roten Rose. Die Verbindung
der roten und weißen Rose läßt auf die Vereinigung der Häuser Tudor und York folgern
(nach der Vermählung Heinrichs VII. mit Elisabeth von York). Es ist nicht ausgeschlossen, daß
der Teppich gelegentlich der Geburtsfeierlichkeiten des Prinzen Arthur (1486) in Auftrag
gegeben wurde. Weder Motiv noch Technik begründen die Überweisung des Behanges an
eine englische Manufaktur. In ähnlicher Weise, in verschiedenfarbige Streifen aufgeteilte,
mit Emblemen symmetrisch überstreute heraldische Decken finden sich vielfach in den
zeitgenössischen festländischen Inventaren. Einem Wirkereibetrieb der burgundischen Erb-
lande entstammen im Entwurf nah verwandte Rücklaken, die einst den märchenhaften Sitz
des Kardinals Wolsey, Hampton Court, schmückten: „pieces of hanging paned with white
and green with branches of roses, red and white"5). Schon der zeitliche Unterschied von
einem Vierteljahrhundert (1486 bis 1520) spricht für die allgemeine Gängigkeit des dekora-
tiven Schemas, das sich in den Niederlanden und in Frankreich bereits im 14. Jahrhundert
nachweisen läßt.
Schwieriger liegt die Entscheidung hinsichtlich der um 1520 entstandenen, in der eng-
lischen Kunstzeitschrift „Apollo"8) zum ersten Male wiedergegebenen goldgewirkten Wap-
pendecke des Sir Andrew Luttreil of Dunster and Quantockshead. Die Zeichnung ist eng-
lisch. Den fast schwarzen Grund deckt ein geometrisches Muster — Quadrate werden von
Kreisen und Ovalen durchbrochen und verbunden —, Tudor-Rosen, Geißblatt und Sonnen-
blumen beleben das etwas langweilige Motiv. Die Mitte des Behanges zeigt das Allianz-
wappen des Sir Andrew Luttrell und seiner Gattin Margaret, aus dem Hause Wyndham,
20 Göbal, Wandteppiche III, 8.
153
Zunft geschlossen, tätig waren, läßt sich vielleicht der Umstand ins Feld führen, daß fran-
zösische Vermögensverzeichnisse, in erster Linie das allerdings sehr späte Kroninventar
Ludwigs XIV., die Mehrzahl der gotischen Wirkereien unter dem terminus technicus „fa-
brique d'Angleterre" führen. Es besteht immerhin die Möglichkeit, daß diese in den meisten
Fällen sicherlich wahllose Zuschreibung in alter Überlieferung Ursprung und Begründung
findet. Noch einige Namen — den Kriminalakten (nach W. G. Thomson) entlehnt —: John
le Tappistere (1317), George le Tapicier aus „Leycestre" (1340), William Tapecer aus Little
Stockton (1360), der 1385 hingerichtete Thomas Tapescer usw. In York arbeiten Philip
Lowes, „Araser" (1413), Henry of ye Yate, „Ares-man" (1454), Christianus de la Greve,
„Ares-man" (1460) und Julius Fysche „Aras-Man" (1492)3). Es ist mehr als wahrschein-
lich, daß die ,,Aras-men" die leichten Arraser Tuche (die Rasch [Arras]macher sind in
Deutschland in der gleichen Zeitspanne bekannt) webten und nicht das geringste mit Tep-
pichwirkern zu tun hatten. In Edinburgh lebt 1467 John Dolace (Dolas) „textor de arras",
der bis 1486 von den „Custumars of woollen cloth" einen jährlichen Zuschuß bezieht: Schir
Johne de Kilgour of Dunblane liefert seit 1497 verschiedene „arras cloths" für den schot-
tischen Hof.
Von den uns überkommenen Teppichen des 15. Jahrhunderts läßt sich nicht eine einzige
Personen- oder Wappenfolge mit Sicherheit englischen Werkstätten zuschreiben. Die In-
ventare des Königshauses, in erster Linie die Vermögensaufstellungen Heinrichs V., Hein-
richs VII., des Sir John Fastolf (1459), Heinrichs VII., u. a. erwähnen lediglich Serien der
niederländischen Großmanufakturen mit den sattsam bekannten Darstellungen. Es fehlt,
auch bei den einfachen Wappenwirkereien, jeglicher Hinweis auf eine heimische Manu-
faktur.
W. G. Thomson und A. F. Kendrick4) bringen interessante Besprechungen eines eigen-
artigen Behanges im Winchester College. Der Teppich ist ,,limog£", d. h. senkrecht in ver-
schiedenfarbige Streifen — Rot und Grünblau — gegliedert. Den Fond deckt ein Granat-
apfelmuster mit aufgelegten roten und weißen heraldischen Rosen, die mit der Initiale
Christi (j ■ h ■ s) und dem Wappenschilde mit den drei Kronen abwechseln; in der Mitte
des Behanges thront das Lamm mit der Siegesfahne auf der roten Rose. Die Verbindung
der roten und weißen Rose läßt auf die Vereinigung der Häuser Tudor und York folgern
(nach der Vermählung Heinrichs VII. mit Elisabeth von York). Es ist nicht ausgeschlossen, daß
der Teppich gelegentlich der Geburtsfeierlichkeiten des Prinzen Arthur (1486) in Auftrag
gegeben wurde. Weder Motiv noch Technik begründen die Überweisung des Behanges an
eine englische Manufaktur. In ähnlicher Weise, in verschiedenfarbige Streifen aufgeteilte,
mit Emblemen symmetrisch überstreute heraldische Decken finden sich vielfach in den
zeitgenössischen festländischen Inventaren. Einem Wirkereibetrieb der burgundischen Erb-
lande entstammen im Entwurf nah verwandte Rücklaken, die einst den märchenhaften Sitz
des Kardinals Wolsey, Hampton Court, schmückten: „pieces of hanging paned with white
and green with branches of roses, red and white"5). Schon der zeitliche Unterschied von
einem Vierteljahrhundert (1486 bis 1520) spricht für die allgemeine Gängigkeit des dekora-
tiven Schemas, das sich in den Niederlanden und in Frankreich bereits im 14. Jahrhundert
nachweisen läßt.
Schwieriger liegt die Entscheidung hinsichtlich der um 1520 entstandenen, in der eng-
lischen Kunstzeitschrift „Apollo"8) zum ersten Male wiedergegebenen goldgewirkten Wap-
pendecke des Sir Andrew Luttreil of Dunster and Quantockshead. Die Zeichnung ist eng-
lisch. Den fast schwarzen Grund deckt ein geometrisches Muster — Quadrate werden von
Kreisen und Ovalen durchbrochen und verbunden —, Tudor-Rosen, Geißblatt und Sonnen-
blumen beleben das etwas langweilige Motiv. Die Mitte des Behanges zeigt das Allianz-
wappen des Sir Andrew Luttrell und seiner Gattin Margaret, aus dem Hause Wyndham,
20 Göbal, Wandteppiche III, 8.
153