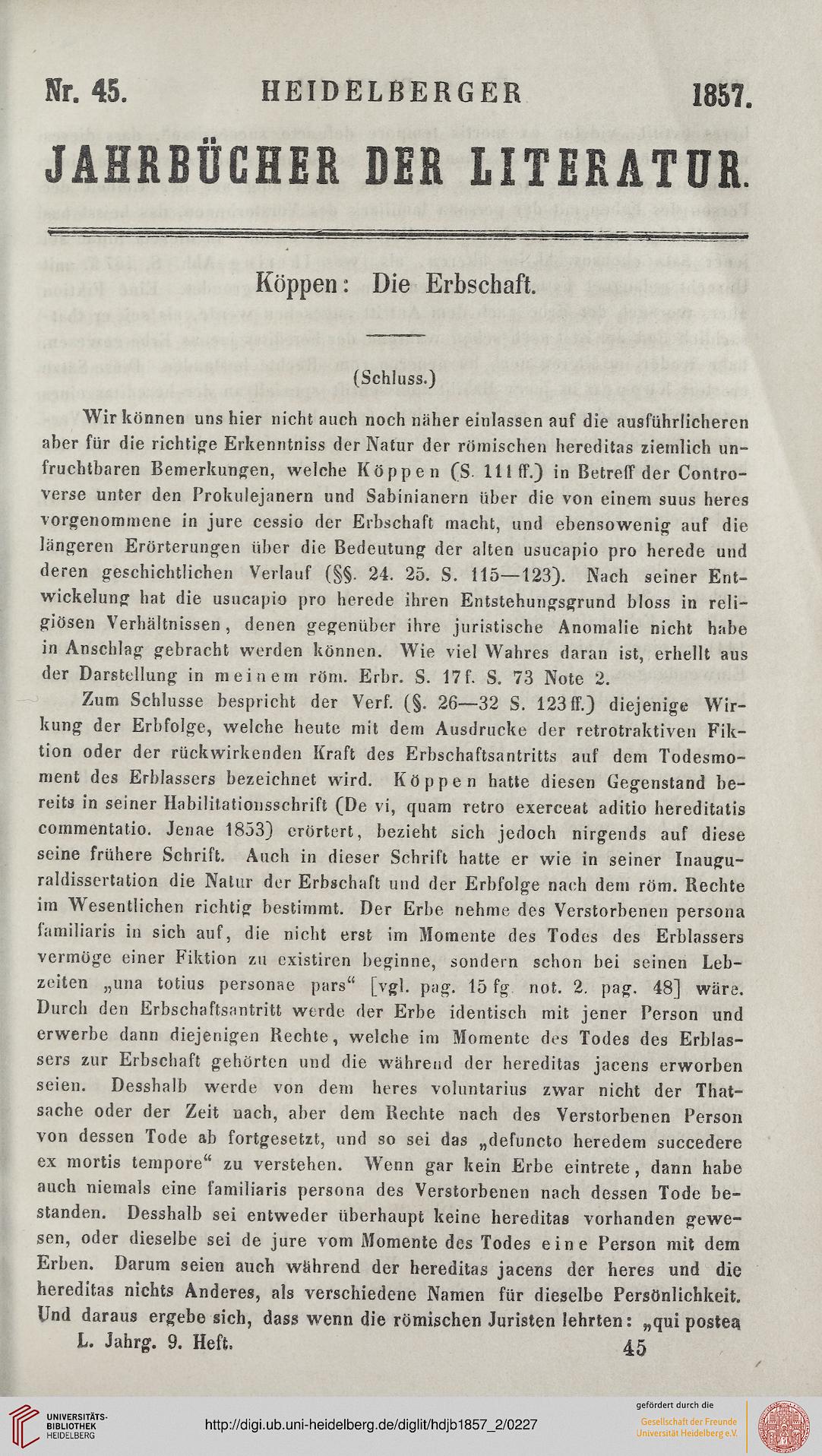Nr. 45. HEIDELBERGER 1857.
JAHRBÜCHER DER LITERATUR.
Koppen: Die Erbschaft.
(Schluss.)
Wir können uns hier nicht auch noch näher einlassen auf die ausführlicheren
aber für die richtige Erkenntniss der Natur der römischen hereditas ziemlich un-
fruchtbaren Bemerkungen, welche Koppen (S. 111 ff.) in Betreff der Contro-
verse unter den Prokulejanern und Sabinianern über die von einem suus heres
vorgenommene in jure cessio der Erbschaft macht, und ebensowenig auf die
längeren Erörterungen über die Bedeutung der alten usucapio pro herede und
deren geschichtlichen Verlauf (§§. 24. 25. S. 115—123). Nach seiner Ent-
wickelung hat die usucapio pro herede ihren Entstehungsgrund bloss in reli-
giösen Verhältnissen, denen gegenüber ihre juristische Anomalie nicht habe
in Anschlag gebracht werden können. Wie viel Wahres daran ist, erhellt aus
der Darstellung in meinem röm. Erbr. S. 17f. S. 73 Note 2.
Zum Schlüsse bespricht der Verf. (§. 26—32 S. 123 ff.) diejenige Wir-
kung der Erbfolge, welche heute mit dem Ausdrucke der retrotraktiven Fik-
tion oder der rückwirkenden Kraft des Erbschaftsantritts auf dem Todesmo-
ment des Erblassers bezeichnet wird. Köppen hatte diesen Gegenstand be-
reits in seiner Habilitationsschrift (De vi, quam retro exerceat aditio hereditatis
commentatio. Jenae 1853) erörtert, bezieht sich jedoch nirgends auf diese
seine frühere Schrift. Auch in dieser Schrift hatte er wie in seiner Inaugu-
raldissertation die Natur der Erbschaft und der Erbfolge nach dem röm. Rechte
im Wesentlichen richtig bestimmt. Der Erbe nehme des Verstorbenen persona
familiaris in sich auf, die nicht erst im Momente des Todes des Erblassers
vermöge einer Fiktion zu existiren beginne, sondern schon bei seinen Leb-
zeiten „una totius personae pars“ [vgl. pag. 15 fg not. 2. pag. 48] wäre.
Durch den Erbschaftsantritt werde der Erbe identisch mit jener Person und
erwerbe dann diejenigen Rechte, welche im Momente des Todes des Erblas-
sers zur Erbschaft gehörten und die während der hereditas jacens erworben
seien. Dessbalb werde von dem heres voluntarius zwar nicht der That-
sache oder der Zeit nach, aber dem Rechte nach des Verstorbenen Person
von dessen Tode ab fortgesetzt, und so sei das „defuncto heredem succedere
ex mortis tempore“ zu verstehen. Wenn gar kein Erbe eintrete , dann habe
auch niemals eine familiaris persona des Verstorbenen nach dessen Tode be-
standen. Desshalb sei entweder überhaupt keine hereditas vorhanden gewe-
sen, oder dieselbe sei de jure vom Momente des Todes eine Person mit dem
Erben. Darum seien auch während der hereditas jacens der heres und die
hereditas nichts Anderes, als verschiedene Namen für dieselbe Persönlichkeit.
Und daraus ergebe sich, dass wenn die römischen Juristen lehrten: „qui postea
L. Jahrg. 9. Heft. 45
JAHRBÜCHER DER LITERATUR.
Koppen: Die Erbschaft.
(Schluss.)
Wir können uns hier nicht auch noch näher einlassen auf die ausführlicheren
aber für die richtige Erkenntniss der Natur der römischen hereditas ziemlich un-
fruchtbaren Bemerkungen, welche Koppen (S. 111 ff.) in Betreff der Contro-
verse unter den Prokulejanern und Sabinianern über die von einem suus heres
vorgenommene in jure cessio der Erbschaft macht, und ebensowenig auf die
längeren Erörterungen über die Bedeutung der alten usucapio pro herede und
deren geschichtlichen Verlauf (§§. 24. 25. S. 115—123). Nach seiner Ent-
wickelung hat die usucapio pro herede ihren Entstehungsgrund bloss in reli-
giösen Verhältnissen, denen gegenüber ihre juristische Anomalie nicht habe
in Anschlag gebracht werden können. Wie viel Wahres daran ist, erhellt aus
der Darstellung in meinem röm. Erbr. S. 17f. S. 73 Note 2.
Zum Schlüsse bespricht der Verf. (§. 26—32 S. 123 ff.) diejenige Wir-
kung der Erbfolge, welche heute mit dem Ausdrucke der retrotraktiven Fik-
tion oder der rückwirkenden Kraft des Erbschaftsantritts auf dem Todesmo-
ment des Erblassers bezeichnet wird. Köppen hatte diesen Gegenstand be-
reits in seiner Habilitationsschrift (De vi, quam retro exerceat aditio hereditatis
commentatio. Jenae 1853) erörtert, bezieht sich jedoch nirgends auf diese
seine frühere Schrift. Auch in dieser Schrift hatte er wie in seiner Inaugu-
raldissertation die Natur der Erbschaft und der Erbfolge nach dem röm. Rechte
im Wesentlichen richtig bestimmt. Der Erbe nehme des Verstorbenen persona
familiaris in sich auf, die nicht erst im Momente des Todes des Erblassers
vermöge einer Fiktion zu existiren beginne, sondern schon bei seinen Leb-
zeiten „una totius personae pars“ [vgl. pag. 15 fg not. 2. pag. 48] wäre.
Durch den Erbschaftsantritt werde der Erbe identisch mit jener Person und
erwerbe dann diejenigen Rechte, welche im Momente des Todes des Erblas-
sers zur Erbschaft gehörten und die während der hereditas jacens erworben
seien. Dessbalb werde von dem heres voluntarius zwar nicht der That-
sache oder der Zeit nach, aber dem Rechte nach des Verstorbenen Person
von dessen Tode ab fortgesetzt, und so sei das „defuncto heredem succedere
ex mortis tempore“ zu verstehen. Wenn gar kein Erbe eintrete , dann habe
auch niemals eine familiaris persona des Verstorbenen nach dessen Tode be-
standen. Desshalb sei entweder überhaupt keine hereditas vorhanden gewe-
sen, oder dieselbe sei de jure vom Momente des Todes eine Person mit dem
Erben. Darum seien auch während der hereditas jacens der heres und die
hereditas nichts Anderes, als verschiedene Namen für dieselbe Persönlichkeit.
Und daraus ergebe sich, dass wenn die römischen Juristen lehrten: „qui postea
L. Jahrg. 9. Heft. 45