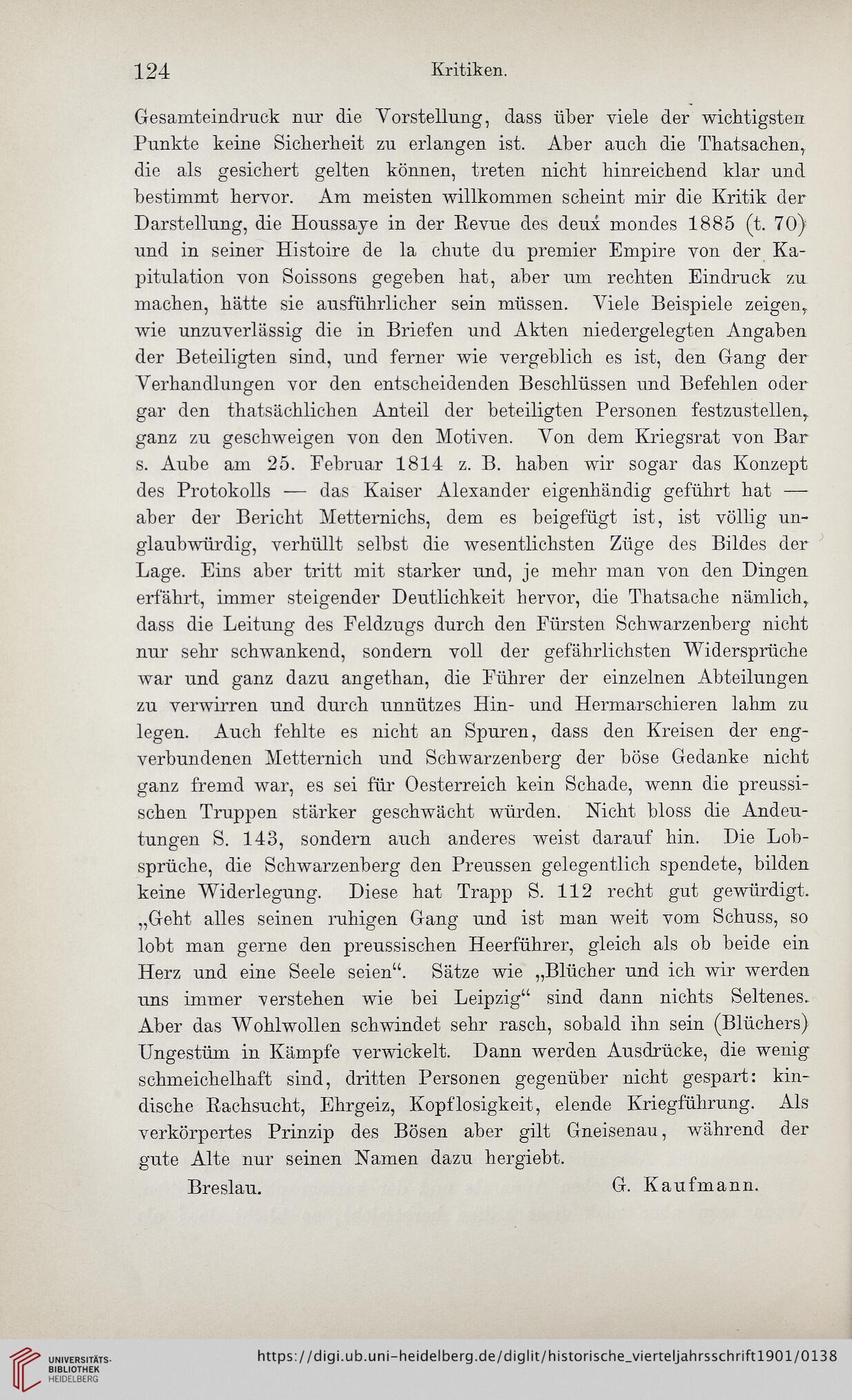124 Kritiken.
Gesamteindruck nur die Vorstellung, dass über viele der wichtigsten
Punkte keine Sicherheit zu erlangen ist. Aber auch die Thatsachen,
die als gesichert gelten können, treten nicht hinreichend klar und
bestimmt hervor. Am meisten willkommen scheint mir die Kritik der
Darstellung, die Houssaye in der Revue des deux mondes 1885 (t. 70)
und in seiner Histoire de la chute du premier Empire von der Ka-
pitulation von Soissons gegeben hat, aber um rechten Eindruck zu
machen, hätte sie ausführlicher sein müssen. Viele Beispiele zeigen,
wie unzuverlässig die in Briefen und Akten niedergelegten Angaben
der Beteiligten sind, und ferner wie vergeblich es ist, den Gang der
Verhandlungen vor den entscheidenden Beschlüssen und Befehlen oder
gar den thatsächlichen Anteil der beteiligten Personen festzustellen,
ganz zu geschweigen von den Motiven. Von dem Kriegsrat von Bar
s. Aube am 25. Februar 1814 z. B. haben wir sogar das Konzept
des Protokolls — das Kaiser Alexander eigenhändig geführt hat —
aber der Bericht Metternichs, dem es beigefügt ist, ist völlig un-
glaubwürdig, verhüllt selbst die wesentlichsten Züge des Bildes der
Lage. Eins aber tritt mit starker und, je mehr man von den Dingen
erfährt, immer steigender Deutlichkeit hervor, die Thatsache nämlich,
dass die Leitung des Feldzugs durch den Fürsten Schwarzenberg nicht
nur sehr schwankend, sondern voll der gefährlichsten Widersprüche
war und ganz dazu angethan, die Führer der einzelnen Abteilungen
zu verwirren und durch unnützes Hin- und Hermarschieren lahm zu
legen. Auch fehlte es nicht an Spuren, dass den Kreisen der eng-
verbundenen Metternich und Schwarzenberg der böse Gedanke nicht
ganz fremd war, es sei für Oesterreich kein Schade, wenn die preussi-
schen Truppen stärker geschwächt würden. Nicht bloss die Andeu-
tungen S. 143, sondern auch anderes weist darauf hin. Die Lob-
sprüche, die Schwarzenberg den Preussen gelegentlich spendete, bilden
keine Widerlegung. Diese hat Trapp S. 112 recht gut gewürdigt.
„Geht alles seinen ruhigen Gang und ist man weit vom Schuss, so
lobt man gerne den preussischen Heerführer, gleich als ob beide ein
Herz und eine Seele seien“. Sätze wie „Blücher und ich wir werden
uns immer verstehen wie bei Leipzig“ sind dann nichts Seltenes.
Aber das Wohlwollen schwindet sehr rasch, sobald ihn sein (Blüchers)
Ungestüm in Kämpfe verwickelt. Dann werden Ausdrücke, die wenig
schmeichelhaft sind, dritten Personen gegenüber nicht gespart: kin-
dische Rachsucht, Ehrgeiz, Kopflosigkeit, elende Kriegführung. Als
verkörpertes Prinzip des Bösen aber gilt Gneisenau, während der
gute Alte nur seinen Namen dazu hergiebt.
Breslau. G. Kaufmann.
Gesamteindruck nur die Vorstellung, dass über viele der wichtigsten
Punkte keine Sicherheit zu erlangen ist. Aber auch die Thatsachen,
die als gesichert gelten können, treten nicht hinreichend klar und
bestimmt hervor. Am meisten willkommen scheint mir die Kritik der
Darstellung, die Houssaye in der Revue des deux mondes 1885 (t. 70)
und in seiner Histoire de la chute du premier Empire von der Ka-
pitulation von Soissons gegeben hat, aber um rechten Eindruck zu
machen, hätte sie ausführlicher sein müssen. Viele Beispiele zeigen,
wie unzuverlässig die in Briefen und Akten niedergelegten Angaben
der Beteiligten sind, und ferner wie vergeblich es ist, den Gang der
Verhandlungen vor den entscheidenden Beschlüssen und Befehlen oder
gar den thatsächlichen Anteil der beteiligten Personen festzustellen,
ganz zu geschweigen von den Motiven. Von dem Kriegsrat von Bar
s. Aube am 25. Februar 1814 z. B. haben wir sogar das Konzept
des Protokolls — das Kaiser Alexander eigenhändig geführt hat —
aber der Bericht Metternichs, dem es beigefügt ist, ist völlig un-
glaubwürdig, verhüllt selbst die wesentlichsten Züge des Bildes der
Lage. Eins aber tritt mit starker und, je mehr man von den Dingen
erfährt, immer steigender Deutlichkeit hervor, die Thatsache nämlich,
dass die Leitung des Feldzugs durch den Fürsten Schwarzenberg nicht
nur sehr schwankend, sondern voll der gefährlichsten Widersprüche
war und ganz dazu angethan, die Führer der einzelnen Abteilungen
zu verwirren und durch unnützes Hin- und Hermarschieren lahm zu
legen. Auch fehlte es nicht an Spuren, dass den Kreisen der eng-
verbundenen Metternich und Schwarzenberg der böse Gedanke nicht
ganz fremd war, es sei für Oesterreich kein Schade, wenn die preussi-
schen Truppen stärker geschwächt würden. Nicht bloss die Andeu-
tungen S. 143, sondern auch anderes weist darauf hin. Die Lob-
sprüche, die Schwarzenberg den Preussen gelegentlich spendete, bilden
keine Widerlegung. Diese hat Trapp S. 112 recht gut gewürdigt.
„Geht alles seinen ruhigen Gang und ist man weit vom Schuss, so
lobt man gerne den preussischen Heerführer, gleich als ob beide ein
Herz und eine Seele seien“. Sätze wie „Blücher und ich wir werden
uns immer verstehen wie bei Leipzig“ sind dann nichts Seltenes.
Aber das Wohlwollen schwindet sehr rasch, sobald ihn sein (Blüchers)
Ungestüm in Kämpfe verwickelt. Dann werden Ausdrücke, die wenig
schmeichelhaft sind, dritten Personen gegenüber nicht gespart: kin-
dische Rachsucht, Ehrgeiz, Kopflosigkeit, elende Kriegführung. Als
verkörpertes Prinzip des Bösen aber gilt Gneisenau, während der
gute Alte nur seinen Namen dazu hergiebt.
Breslau. G. Kaufmann.