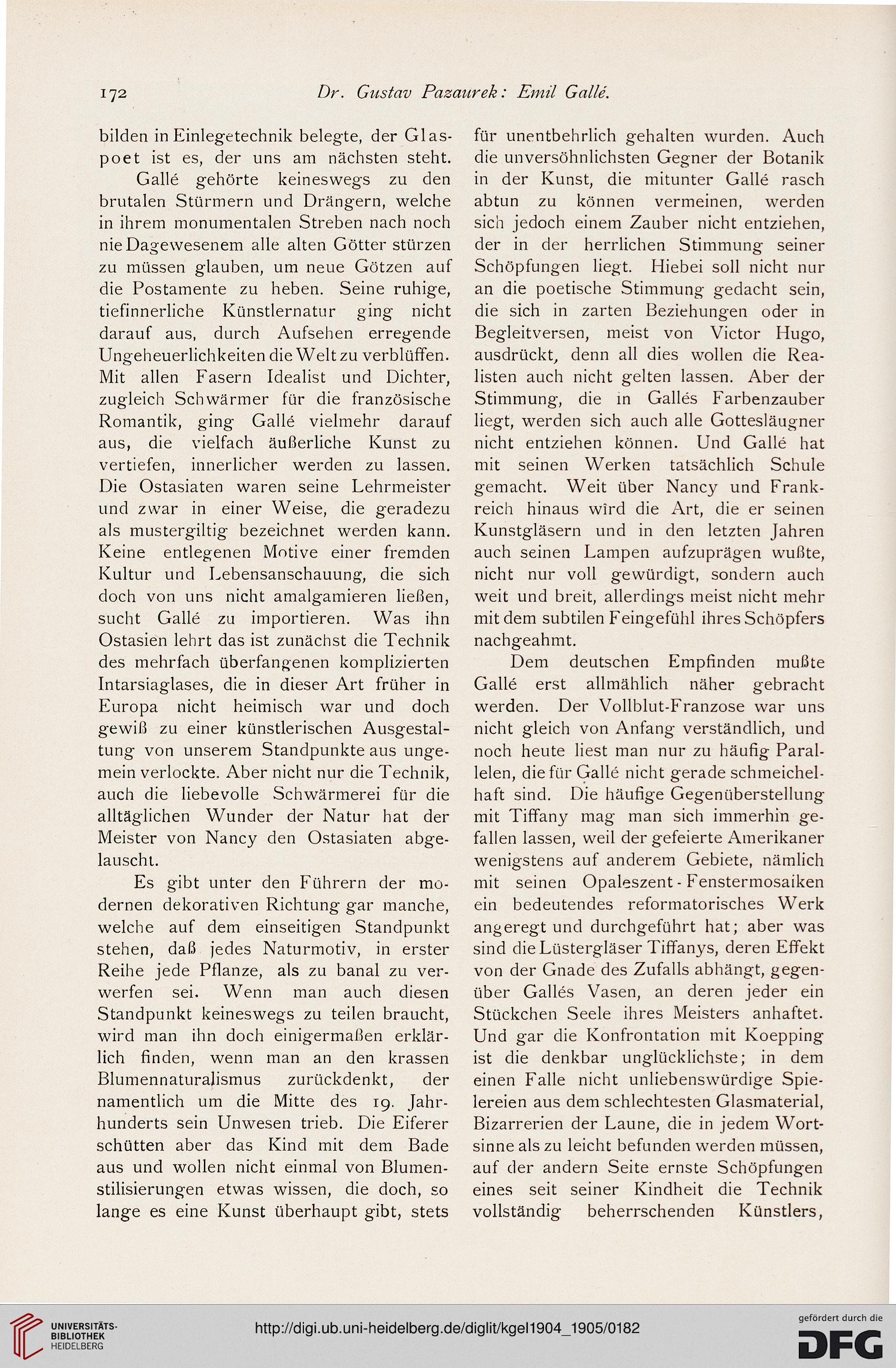172
Dr. Gustav Pazaurek: Emil Galle.
bilden in Einlegetechnik belegte, der Glas-
poet ist es, der uns am nächsten steht.
Galle gehörte keineswegs zu den
brutalen Stürmern und Drängern, welche
in ihrem monumentalen Streben nach noch
nie Dagewesenem alle alten Götter stürzen
zu müssen glauben, um neue Götzen auf
die Postamente zu heben. Seine ruhige,
tiefinnerliche Künstlernatur ging nicht
darauf aus, durch Aufseilen erregende
Ungeheuerlichkeiten die Welt zu verblüffen.
Mit allen Fasern Idealist und Dichter,
zugleich Schwärmer für die französische
Romantik, ging Galle vielmehr darauf
aus, die vielfach äußerliche Kunst zu
vertiefen, innerlicher werden zu lassen.
Die Ostasiaten waren seine Lehrmeister
und zwar in einer Weise, die geradezu
als mustergiltig bezeichnet werden kann.
Keine entlegenen Motive einer fremden
Kultur und Lebensanschauung, die sich
doch von uns nicht amalgamieren ließen,
sucht Galle zu importieren. Was ihn
Ostasien lehrt das ist zunächst die Technik
des mehrfach überfangenen komplizierten
Intarsiaglases, die in dieser Art früher in
Europa nicht heimisch war und doch
gewiß zu einer künstlerischen Ausgestal-
tung von unserem Standpunkte aus unge-
mein verlockte. Aber nicht nur die Technik,
auch die liebevolle Schwärmerei für die
alltäglichen Wunder der Natur hat der
Meister von Nancy den Ostasiaten abge-
lauscht.
Es gibt unter den Führern der mo-
dernen dekorativen Richtung gar manche,
welche auf dem einseitigen Standpunkt
stehen, daß jedes Naturmotiv, in erster
Reihe jede Pflanze, als zu banal zu ver-
werfen sei. Wenn man auch diesen
Standpunkt keineswegs zu teilen braucht,
wird man ihn doch einigermaßen erklär-
lich finden, wenn man an den krassen
Blumennaturalismus zurückdenkt, der
namentlich um die Mitte des 19. Jahr-
hunderts sein Unwesen trieb. Die Eiferer
schütten aber das Kind mit dem Bade
aus und wollen nicht einmal von Blumen-
stilisierungen etwas wissen, die doch, so
lange es eine Kunst überhaupt gibt, stets
für unentbehrlich gehalten wurden. Auch
die unversöhnlichsten Gegner der Botanik
in der Kunst, die mitunter Galle rasch
abtun zu können vermeinen, werden
sich jedoch einem Zauber nicht entziehen,
der in der herrlichen Stimmung seiner
Schöpfungen liegt. Hiebei soll nicht nur
an die poetische Stimmung gedacht sein,
die sich in zarten Beziehungen oder in
Begleitversen, meist von Victor Hugo,
ausdrückt, denn all dies wollen die Rea-
listen auch nicht gelten lassen. Aber der
Stimmung, die in Galles Farbenzauber
liegt, werden sich auch alle Gottesläugner
nicht entziehen können. Und Galle hat
mit seinen Werken tatsächlich Schule
gemacht. Weit über Nancy und Frank-
reich hinaus wird die Art, die er seinen
Kunstgläsern und in den letzten Jahren
auch seinen Lampen aufzuprägen wußte,
nicht nur voll gewürdigt, sondern auch
weit und breit, allerdings meist nicht mehr
mit dem subtilen Feingefühl ihres Schöpfers
nachgeahmt.
Dem deutschen Empfinden mußte
Galle erst allmählich näher gebracht
werden. Der Vollblut-Franzose war uns
nicht gleich von Anfang verständlich, und
noch heute liest man nur zu häufig Paral-
lelen, die für Galle nicht gerade schmeichel-
haft sind. Die häufige Gegenüberstellung
mit Tiffany mag man sich immerhin ge-
fallen lassen, weil der gefeierte Amerikaner
wenigstens auf anderem Gebiete, nämlich
mit seinen Opaleszent - Fenstermosaiken
ein bedeutendes reformatorisches Werk
angeregt und durchgeführt hat; aber was
sind die Lüstergläser Tiffanys, deren Effekt
von der Gnade des Zufalls abhängt, gegen-
über Galles Vasen, an deren jeder ein
Stückchen Seele ihres Meisters anhaftet.
Und gar die Konfrontation mit Koepping
ist die denkbar unglücklichste; in dem
einen Falle nicht unliebenswürdige Spie-
lereien aus dem schlechtesten Glasmaterial,
Bizarrerien der Laune, die in jedem Wort-
sinne als zu leicht befunden werden müssen,
auf der andern Seite ernste Schöpfungen
eines seit seiner Kindheit die Technik
vollständig beherrschenden Künstlers,
Dr. Gustav Pazaurek: Emil Galle.
bilden in Einlegetechnik belegte, der Glas-
poet ist es, der uns am nächsten steht.
Galle gehörte keineswegs zu den
brutalen Stürmern und Drängern, welche
in ihrem monumentalen Streben nach noch
nie Dagewesenem alle alten Götter stürzen
zu müssen glauben, um neue Götzen auf
die Postamente zu heben. Seine ruhige,
tiefinnerliche Künstlernatur ging nicht
darauf aus, durch Aufseilen erregende
Ungeheuerlichkeiten die Welt zu verblüffen.
Mit allen Fasern Idealist und Dichter,
zugleich Schwärmer für die französische
Romantik, ging Galle vielmehr darauf
aus, die vielfach äußerliche Kunst zu
vertiefen, innerlicher werden zu lassen.
Die Ostasiaten waren seine Lehrmeister
und zwar in einer Weise, die geradezu
als mustergiltig bezeichnet werden kann.
Keine entlegenen Motive einer fremden
Kultur und Lebensanschauung, die sich
doch von uns nicht amalgamieren ließen,
sucht Galle zu importieren. Was ihn
Ostasien lehrt das ist zunächst die Technik
des mehrfach überfangenen komplizierten
Intarsiaglases, die in dieser Art früher in
Europa nicht heimisch war und doch
gewiß zu einer künstlerischen Ausgestal-
tung von unserem Standpunkte aus unge-
mein verlockte. Aber nicht nur die Technik,
auch die liebevolle Schwärmerei für die
alltäglichen Wunder der Natur hat der
Meister von Nancy den Ostasiaten abge-
lauscht.
Es gibt unter den Führern der mo-
dernen dekorativen Richtung gar manche,
welche auf dem einseitigen Standpunkt
stehen, daß jedes Naturmotiv, in erster
Reihe jede Pflanze, als zu banal zu ver-
werfen sei. Wenn man auch diesen
Standpunkt keineswegs zu teilen braucht,
wird man ihn doch einigermaßen erklär-
lich finden, wenn man an den krassen
Blumennaturalismus zurückdenkt, der
namentlich um die Mitte des 19. Jahr-
hunderts sein Unwesen trieb. Die Eiferer
schütten aber das Kind mit dem Bade
aus und wollen nicht einmal von Blumen-
stilisierungen etwas wissen, die doch, so
lange es eine Kunst überhaupt gibt, stets
für unentbehrlich gehalten wurden. Auch
die unversöhnlichsten Gegner der Botanik
in der Kunst, die mitunter Galle rasch
abtun zu können vermeinen, werden
sich jedoch einem Zauber nicht entziehen,
der in der herrlichen Stimmung seiner
Schöpfungen liegt. Hiebei soll nicht nur
an die poetische Stimmung gedacht sein,
die sich in zarten Beziehungen oder in
Begleitversen, meist von Victor Hugo,
ausdrückt, denn all dies wollen die Rea-
listen auch nicht gelten lassen. Aber der
Stimmung, die in Galles Farbenzauber
liegt, werden sich auch alle Gottesläugner
nicht entziehen können. Und Galle hat
mit seinen Werken tatsächlich Schule
gemacht. Weit über Nancy und Frank-
reich hinaus wird die Art, die er seinen
Kunstgläsern und in den letzten Jahren
auch seinen Lampen aufzuprägen wußte,
nicht nur voll gewürdigt, sondern auch
weit und breit, allerdings meist nicht mehr
mit dem subtilen Feingefühl ihres Schöpfers
nachgeahmt.
Dem deutschen Empfinden mußte
Galle erst allmählich näher gebracht
werden. Der Vollblut-Franzose war uns
nicht gleich von Anfang verständlich, und
noch heute liest man nur zu häufig Paral-
lelen, die für Galle nicht gerade schmeichel-
haft sind. Die häufige Gegenüberstellung
mit Tiffany mag man sich immerhin ge-
fallen lassen, weil der gefeierte Amerikaner
wenigstens auf anderem Gebiete, nämlich
mit seinen Opaleszent - Fenstermosaiken
ein bedeutendes reformatorisches Werk
angeregt und durchgeführt hat; aber was
sind die Lüstergläser Tiffanys, deren Effekt
von der Gnade des Zufalls abhängt, gegen-
über Galles Vasen, an deren jeder ein
Stückchen Seele ihres Meisters anhaftet.
Und gar die Konfrontation mit Koepping
ist die denkbar unglücklichste; in dem
einen Falle nicht unliebenswürdige Spie-
lereien aus dem schlechtesten Glasmaterial,
Bizarrerien der Laune, die in jedem Wort-
sinne als zu leicht befunden werden müssen,
auf der andern Seite ernste Schöpfungen
eines seit seiner Kindheit die Technik
vollständig beherrschenden Künstlers,