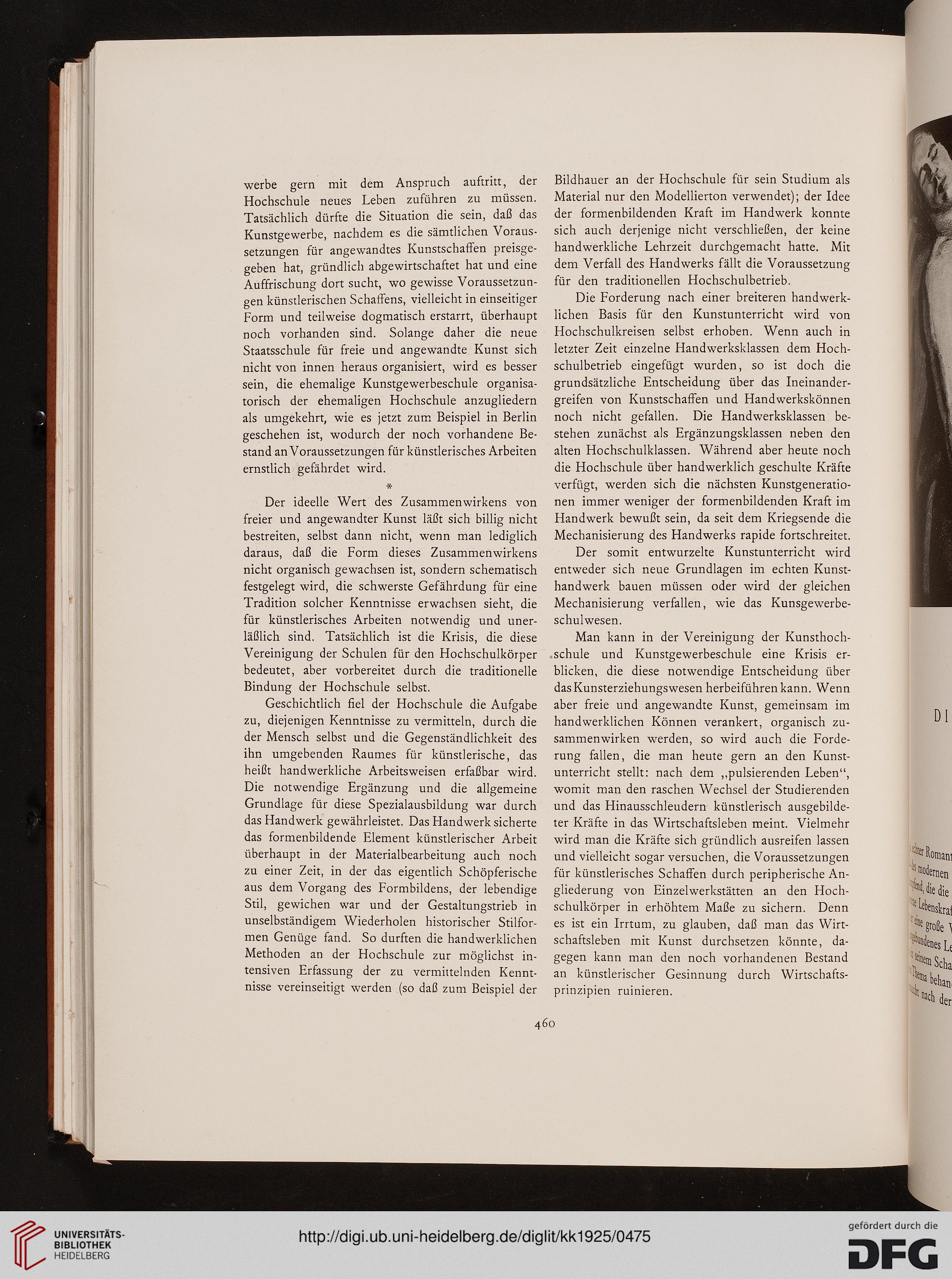werbe gern mit dem Anspruch auftritt, der
Hochschule neues Leben zuführen zu müssen.
Tatsächlich dürfte die Situation die sein, daß das
Kunstgewerbe, nachdem es die sämtlichen Voraus-
setzungen für angewandtes Kunstschaffen preisge-
geben hat, gründlich abgewirtschaftet hat und eine
Auffrischung dort sucht, wo gewisse Voraussetzun-
gen künstlerischen Schaffens, vielleicht in einseitiger
Form und teilweise dogmatisch erstarrt, überhaupt
noch vorhanden sind. Solange daher die neue
Staatsschule für freie und angewandte Kunst sich
nicht von innen heraus organisiert, wird es besser
sein, die ehemalige Kunstgewerbeschule organisa-
torisch der ehemaligen Hochschule anzugliedern
als umgekehrt, wie es jetzt zum Beispiel in Berlin
geschehen ist, wodurch der noch vorhandene Be-
stand an Voraussetzungen für künstlerisches Arbeiten
ernstlich gefährdet wird.
*
Der ideelle Wert des Zusammenwirkens von
freier und angewandter Kunst läßt sich billig nicht
bestreiten, selbst dann nicht, wenn man lediglich
daraus, daß die Form dieses Zusammenwirkens
nicht organisch gewachsen ist, sondern schematisch
festgelegt wird, die schwerste Gefährdung für eine
Tradition solcher Kenntnisse erwachsen sieht, die
für künstlerisches Arbeiten notwendig und uner-
läßlich sind. Tatsächlich ist die Krisis, die diese
Vereinigung der Schulen für den Hochschulkörper
bedeutet, aber vorbereitet durch die traditionelle
Bindung der Hochschule selbst.
Geschichtlich fiel der Hochschule die Aufgabe
zu, diejenigen Kenntnisse zu vermitteln, durch die
der Mensch selbst und die Gegenständlichkeit des
ihn umgebenden Raumes für künstlerische, das
heißt handwerkliche Arbeitsweisen erfaßbar wird.
Die notwendige Ergänzung und die allgemeine
Grundlage für diese Spezialausbildung war durch
das Handwerk gewährleistet. Das Handwerk sicherte
das formenbildende Element künstlerischer Arbeit
überhaupt in der Materialbearbeitung auch noch
zu einer Zeit, in der das eigentlich Schöpferische
aus dem Vorgang des Formbildens, der lebendige
Stil, gewichen war und der Gestaltungstrieb in
unselbständigem Wiederholen historischer Stilfor-
men Genüge fand. So durften die handwerklichen
Methoden an der Hochschule zur möglichst in-
tensiven Erfassung der zu vermittelnden Kennt-
nisse vereinseitigt werden (so daß zum Beispiel der
Bildhauer an der Hochschule für sein Studium als
Material nur den Modellierton verwendet); der Idee
der formenbildenden Kraft im Handwerk konnte
sich auch derjenige nicht verschließen, der keine
handwerkliche Lehrzeit durchgemacht hatte. Mit
dem Verfall des Handwerks fällt die Voraussetzung
für den traditionellen Hochschulbetrieb.
Die Forderung nach einer breiteren handwerk-
lichen Basis für den Kunstunterricht wird von
Hochschulkreisen selbst erhoben. Wenn auch in
letzter Zeit einzelne Handwerksklassen dem Hoch-
schulbetrieb eingefügt wurden, so ist doch die
grundsätzliche Entscheidung über das Ineinander-
greifen von Kunstschaffen und Handwerkskönnen
noch nicht gefallen. Die Handwerksklassen be-
stehen zunächst als Ergänzungsklassen neben den
alten Hochschulklassen. Während aber heute noch
die Hochschule über handwerklich geschulte Kräfte
verfügt, werden sich die nächsten Kunstgeneratio-
nen immer weniger der formenbildenden Kraft im
Handwerk bewußt sein, da seit dem Kriegsende die
Mechanisierung des Handwerks rapide fortschreitet.
Der somit entwurzelte Kunstunterricht wird
entweder sich neue Grundlagen im echten Kunst-
handwerk bauen müssen oder wird der gleichen
Mechanisierung verfallen, wie das Kunsgewerbe-
schulwesen.
Man kann in der Vereinigung der Kunsthoch-
schule und Kunstgewerbeschule eine Krisis er-
blicken, die diese notwendige Entscheidung über
das Kunsterziehungswesen herbeiführen kann. Wenn
aber freie und angewandte Kunst, gemeinsam im
handwerklichen Können verankert, organisch zu-
sammenwirken werden, so wird auch die Forde-
rung fallen, die man heute gern an den Kunst-
unterricht stellt: nach dem ,,pulsierenden Leben",
womit man den raschen Wechsel der Studierenden
und das Hinausschleudern künstlerisch ausgebilde-
ter Kräfte in das Wirtschaftsleben meint. Vielmehr
wird man die Kräfte sich gründlich ausreifen lassen
und vielleicht sogar versuchen, die Voraussetzungen
für künstlerisches Schaffen durch peripherische An-
gliederung von Einzelwerkstätten an den Floch-
schulkörper in erhöhtem Maße zu sichern. Denn
es ist ein Irrtum, zu glauben, daß man das Wirt-
schaftsleben mit Kunst durchsetzen könnte, da-
gegen kann man den noch vorhandenen Bestand
an künstlerischer Gesinnung durch Wirtschafts-
prinzipien ruinieren.
^Roma
460