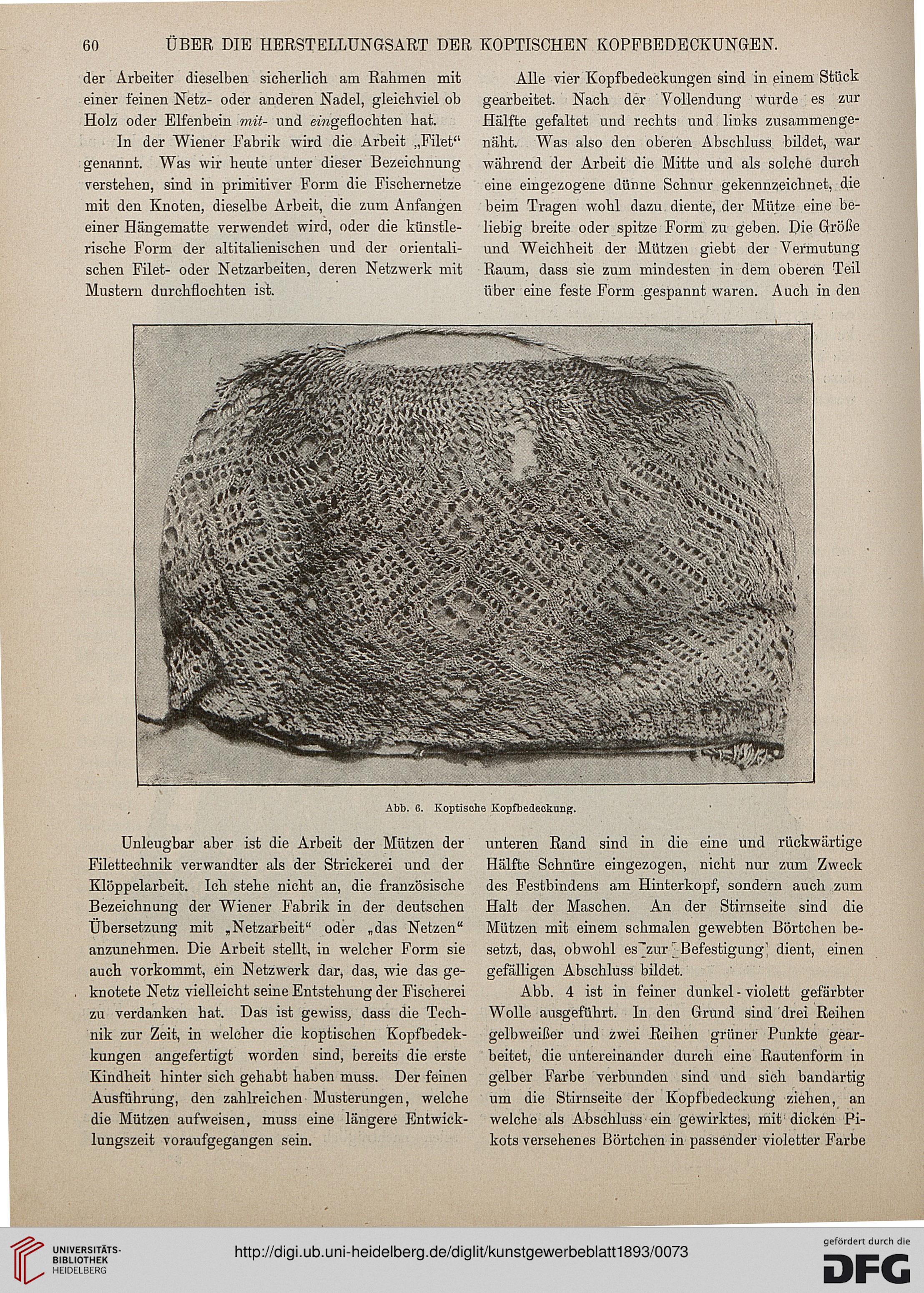60
ÜBER DIE HERSTELLUNGSART DER KOPTISCHEN KOPPBEDECKUNGEN.
der Arbeiter dieselben sicberlicb am Rahmen mit
einer feinen Netz- oder anderen Nadel, gleichviel ob
Holz oder Elfenbein 'mit- und emgeflochten hat.
In der "Wiener Fabrik wird die Arbeit „Filet"
genannt. Was wir heute unter dieser Bezeichnung
verstehen, sind in primitiver Form die Fischernetze
mit den Knoten, dieselbe Arbeit, die zum Anfangen
einer Hängematte verwendet wird, oder die künstle-
rische Form der altitalienischen und der orientali-
schen Filet- oder Netzarbeiten, deren Netzwerk mit
Mustern durchflochten ist.
Alle vier Kopfbedeckungen sind in einem Stück
gearbeitet. Nach der Vollendung wurde es zur
Hälfte gefaltet und rechts und links zusammenge-
näht. Was also den oberen Abschluss bildet, war
während der Arbeit die Mitte und als solche durch
eine eingezogene dünne Schnur gekennzeichnet, die
beim Tragen wohl dazu diente, der Mütze eine be-
liebig breite oder spitze Form zu geben. Die Größe
und Weichheit der Mützen giebt der Vermutung
Raum, dass sie zum mindesten in dem oberen Teil
über eine feste Form gespannt waren. Auch in den
__ii *f il'irtttl'^ Villi« i imiiini.....|„__
Abb. 6. Koptische Kopfbedeckung.
Unleugbar aber ist die Arbeit der Mützen der
Filettechnik verwandter als der Strickerei und der
Klöppelarbeit. Ich stehe nicht an, die französische
Bezeichnung der Wiener Fabrik in der deutschen
Übersetzung mit „Netzarbeit" oder „das Netzen"
anzunehmen. Die Arbeit stellt, in welcher Form sie
auch vorkommt, ein Netzwerk dar, das, wie das ge-
knotete Netz vielleicht seine Entstehung der Fischerei
zu verdanken hat. Das ist gewiss, dass die Tech-
nik zur Zeit, in welcher die koptischen Kopfbedek-
kungen angefertigt worden sind, bereits die erste
Kindheit hinter sich gehabt haben muss. Der feinen
Ausführung, den zahlreichen Musterungen, welche
die Mützen aufweisen, muss eine längere Entwick-
lungszeit voraufgegangen sein.
unteren Rand sind in die eine und rückwärtige
Hälfte Schnüre eingezogen, nicht nur zum Zweck
des Festbindens am Hinterkopf, sondern auch zum
Halt der Maschen. An der Stirnseite sind die
Mützen mit einem schmalen gewebten Börtchen be-
setzt, das, obwohl es~zur'^Befestigung' dient, einen
gefälligen Abschluss bildet.
Abb. 4 ist in feiner dunkel - violett gefärbter
Wolle ausgeführt. In den Grund sind drei Reihen
gelbweißer und zwei Reihen grüner Punkte gear-
beitet, die untereinander durch eine Rautenform in
gelber Farbe verbunden sind und sich bandartig
um die Stirnseite der Kopfbedeckung ziehen, an
welche als Abschluss ein gewirktes, mit dicken Pi-
kots versehenes Börtchen in passender violetter Farbe
ÜBER DIE HERSTELLUNGSART DER KOPTISCHEN KOPPBEDECKUNGEN.
der Arbeiter dieselben sicberlicb am Rahmen mit
einer feinen Netz- oder anderen Nadel, gleichviel ob
Holz oder Elfenbein 'mit- und emgeflochten hat.
In der "Wiener Fabrik wird die Arbeit „Filet"
genannt. Was wir heute unter dieser Bezeichnung
verstehen, sind in primitiver Form die Fischernetze
mit den Knoten, dieselbe Arbeit, die zum Anfangen
einer Hängematte verwendet wird, oder die künstle-
rische Form der altitalienischen und der orientali-
schen Filet- oder Netzarbeiten, deren Netzwerk mit
Mustern durchflochten ist.
Alle vier Kopfbedeckungen sind in einem Stück
gearbeitet. Nach der Vollendung wurde es zur
Hälfte gefaltet und rechts und links zusammenge-
näht. Was also den oberen Abschluss bildet, war
während der Arbeit die Mitte und als solche durch
eine eingezogene dünne Schnur gekennzeichnet, die
beim Tragen wohl dazu diente, der Mütze eine be-
liebig breite oder spitze Form zu geben. Die Größe
und Weichheit der Mützen giebt der Vermutung
Raum, dass sie zum mindesten in dem oberen Teil
über eine feste Form gespannt waren. Auch in den
__ii *f il'irtttl'^ Villi« i imiiini.....|„__
Abb. 6. Koptische Kopfbedeckung.
Unleugbar aber ist die Arbeit der Mützen der
Filettechnik verwandter als der Strickerei und der
Klöppelarbeit. Ich stehe nicht an, die französische
Bezeichnung der Wiener Fabrik in der deutschen
Übersetzung mit „Netzarbeit" oder „das Netzen"
anzunehmen. Die Arbeit stellt, in welcher Form sie
auch vorkommt, ein Netzwerk dar, das, wie das ge-
knotete Netz vielleicht seine Entstehung der Fischerei
zu verdanken hat. Das ist gewiss, dass die Tech-
nik zur Zeit, in welcher die koptischen Kopfbedek-
kungen angefertigt worden sind, bereits die erste
Kindheit hinter sich gehabt haben muss. Der feinen
Ausführung, den zahlreichen Musterungen, welche
die Mützen aufweisen, muss eine längere Entwick-
lungszeit voraufgegangen sein.
unteren Rand sind in die eine und rückwärtige
Hälfte Schnüre eingezogen, nicht nur zum Zweck
des Festbindens am Hinterkopf, sondern auch zum
Halt der Maschen. An der Stirnseite sind die
Mützen mit einem schmalen gewebten Börtchen be-
setzt, das, obwohl es~zur'^Befestigung' dient, einen
gefälligen Abschluss bildet.
Abb. 4 ist in feiner dunkel - violett gefärbter
Wolle ausgeführt. In den Grund sind drei Reihen
gelbweißer und zwei Reihen grüner Punkte gear-
beitet, die untereinander durch eine Rautenform in
gelber Farbe verbunden sind und sich bandartig
um die Stirnseite der Kopfbedeckung ziehen, an
welche als Abschluss ein gewirktes, mit dicken Pi-
kots versehenes Börtchen in passender violetter Farbe