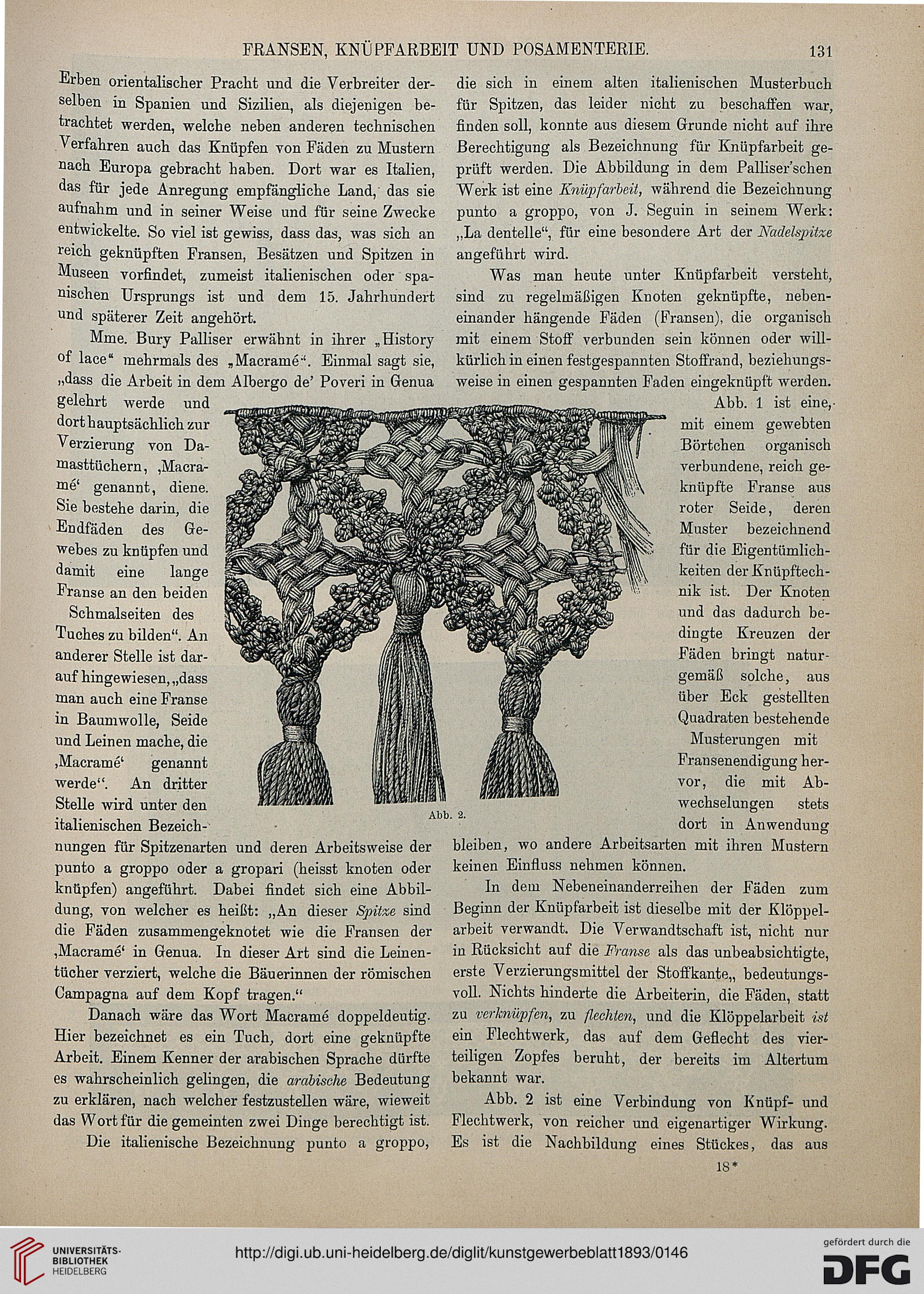FRANSEN, KNÜPFARBEIT UND POSAMENTERIE.
131
Erben orientalischer Pracht und die Verbreiter der-
selben in Spanien und Sizilien, als diejenigen be-
trachtet werden, welche neben anderen technischen
Verfahren auch das Knüpfen von Fäden zu Mustern
nach Europa gebracht haben. Dort war es Italien,
das für jede Anregung empfängliche Land, das sie
aufnahm und in seiner Weise und für seine Zwecke
entwickelte. So viel ist gewiss, dass das, was sieh an
reich geknüpften Fransen, Besätzen und Spitzen in
Museen vorfindet, zumeist italienischen oder spa-
nischen Ursprungs ist und dem 15. Jahrhundert
und späterer Zeit angehört.
Mme. Bury Palliser erwähnt in ihrer „History
of lace" mehrmals des „Macrarne-'. Einmal sagt sie,
„dass die Arbeit in dem Albergo de' Poveri in Genua
gelehrt werde und
dort hauptsächlich zur
Verzierung von Da-
masttüchern, ,Macra-
me' genannt, diene.
Sie bestehe darin, die
Endfäden des Ge-
webes zu knüpfen und
damit eine lange
Franse an den beiden
Schmalseiten des
Tuches zu bilden". An
anderer Stelle ist dar-
auf hingewiesen, „dass
man auch eine Franse
in Baumwolle, Seide
und Leinen mache, die
,Macrame' genannt
werde". An dritter
Stelle wird unter den
italienischen Bezeich-
nungen für Spitzenarten und deren Arbeitsweise der
punto a groppo oder a gropari (heisst knoten oder
knüpfen) angeführt. Dabei findet sich eine Abbil-
dung, von welcher es heißt: „An dieser Spitze sind
die Fäden zusammengeknotet wie die Fransen der
,Macrame' in Genua. In dieser Art sind die Leinen-
tücher verziert, welche die Bäuerinnen der römischen
Campagna auf dem Kopf tragen."
Danach wäre das Wort Macrame doppeldeutig.
Hier bezeichnet es ein Tuch, dort eine geknüpfte
Arbeit. Einem Kenner der arabischen Sprache dürfte
es wahrscheinlich gelingen, die arabische Bedeutung
zu erklären, nach welcher festzustellen wäre, wieweit
das Wort für die gemeinten zwei Dinge berechtigt ist.
Die italienische Bezeichnung punto a groppo,
Abb. 2.
die sich in einem alten italienischen Musterbuch
für Spitzen, das leider nicht zu beschaffen war,
finden soll, konnte aus diesem Grunde nicht auf ihre
Berechtigung als Bezeichnung für Knüpfarbeit ge-
prüft werden. Die Abbildung in dem Palliser'schen
Werk ist eine Knüpfarbeit, während die Bezeichnung
punto a groppo, von J. Seguin in seinem Werk:
„La dentelle", für eine besondere Art der Nadelspitze
angeführt wird.
Was man heute unter Knüpfarbeit versteht,
sind zu regelmäßigen Knoten geknüpfte, neben-
einander hängende Fäden (Fransen), die organisch
mit einem Stoff verbunden sein können oder will-
kürlich in einen festgespannten Stoffrand, beziehungs-
weise in einen gespannten Faden eingeknüpft werden.
Abb. 1 ist eine,-
mit einem gewebten
Börtchen organisch
verbundene, reich ge-
knüpfte Franse aus
roter Seide, deren
Muster bezeichnend
für die Eigentümlich-
keiten der Knüpftech-
nik ist. Der Knoten
und das dadurch be-
dingte Kreuzen der
Fäden bringt natur-
gemäß solche, aus
über Eck gestellten
Quadraten bestehende
Musterungen mit
Fransenendigung her-
vor, die mit Ab-
wechselungen stets
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ dort in Anwendung
bleiben, wo andere Arbeitsarten mit ihren Mustern
keinen Einfluss nehmen können.
In dem Nebeneinanderreihen der Fäden zum
Beginn der Knüpfarbeit ist dieselbe mit der Klöppel-
arbeit verwandt. Die Verwandtschaft ist, nicht nur
in Rücksicht auf die Franse als das unbeabsichtigte,
erste Verzierungsmittel der Stoffkante,, bedeutungs-
voll. Nichts hinderte die Arbeiterin, die Fäden, statt
zu verknüpfen, zu flechten, und die Klöppelarbeit ist
ein Flechtwerk, das auf dem Geflecht des vier-
teiligen Zopfes beruht, der bereits im Altertum
bekannt war.
Abb. 2 ist eine Verbindung von Knüpf- und
Flechtwerk, von reicher und eigenartiger Wirkung.
Es ist die Nachbildung eines Stückes, das aus
IS*
131
Erben orientalischer Pracht und die Verbreiter der-
selben in Spanien und Sizilien, als diejenigen be-
trachtet werden, welche neben anderen technischen
Verfahren auch das Knüpfen von Fäden zu Mustern
nach Europa gebracht haben. Dort war es Italien,
das für jede Anregung empfängliche Land, das sie
aufnahm und in seiner Weise und für seine Zwecke
entwickelte. So viel ist gewiss, dass das, was sieh an
reich geknüpften Fransen, Besätzen und Spitzen in
Museen vorfindet, zumeist italienischen oder spa-
nischen Ursprungs ist und dem 15. Jahrhundert
und späterer Zeit angehört.
Mme. Bury Palliser erwähnt in ihrer „History
of lace" mehrmals des „Macrarne-'. Einmal sagt sie,
„dass die Arbeit in dem Albergo de' Poveri in Genua
gelehrt werde und
dort hauptsächlich zur
Verzierung von Da-
masttüchern, ,Macra-
me' genannt, diene.
Sie bestehe darin, die
Endfäden des Ge-
webes zu knüpfen und
damit eine lange
Franse an den beiden
Schmalseiten des
Tuches zu bilden". An
anderer Stelle ist dar-
auf hingewiesen, „dass
man auch eine Franse
in Baumwolle, Seide
und Leinen mache, die
,Macrame' genannt
werde". An dritter
Stelle wird unter den
italienischen Bezeich-
nungen für Spitzenarten und deren Arbeitsweise der
punto a groppo oder a gropari (heisst knoten oder
knüpfen) angeführt. Dabei findet sich eine Abbil-
dung, von welcher es heißt: „An dieser Spitze sind
die Fäden zusammengeknotet wie die Fransen der
,Macrame' in Genua. In dieser Art sind die Leinen-
tücher verziert, welche die Bäuerinnen der römischen
Campagna auf dem Kopf tragen."
Danach wäre das Wort Macrame doppeldeutig.
Hier bezeichnet es ein Tuch, dort eine geknüpfte
Arbeit. Einem Kenner der arabischen Sprache dürfte
es wahrscheinlich gelingen, die arabische Bedeutung
zu erklären, nach welcher festzustellen wäre, wieweit
das Wort für die gemeinten zwei Dinge berechtigt ist.
Die italienische Bezeichnung punto a groppo,
Abb. 2.
die sich in einem alten italienischen Musterbuch
für Spitzen, das leider nicht zu beschaffen war,
finden soll, konnte aus diesem Grunde nicht auf ihre
Berechtigung als Bezeichnung für Knüpfarbeit ge-
prüft werden. Die Abbildung in dem Palliser'schen
Werk ist eine Knüpfarbeit, während die Bezeichnung
punto a groppo, von J. Seguin in seinem Werk:
„La dentelle", für eine besondere Art der Nadelspitze
angeführt wird.
Was man heute unter Knüpfarbeit versteht,
sind zu regelmäßigen Knoten geknüpfte, neben-
einander hängende Fäden (Fransen), die organisch
mit einem Stoff verbunden sein können oder will-
kürlich in einen festgespannten Stoffrand, beziehungs-
weise in einen gespannten Faden eingeknüpft werden.
Abb. 1 ist eine,-
mit einem gewebten
Börtchen organisch
verbundene, reich ge-
knüpfte Franse aus
roter Seide, deren
Muster bezeichnend
für die Eigentümlich-
keiten der Knüpftech-
nik ist. Der Knoten
und das dadurch be-
dingte Kreuzen der
Fäden bringt natur-
gemäß solche, aus
über Eck gestellten
Quadraten bestehende
Musterungen mit
Fransenendigung her-
vor, die mit Ab-
wechselungen stets
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ dort in Anwendung
bleiben, wo andere Arbeitsarten mit ihren Mustern
keinen Einfluss nehmen können.
In dem Nebeneinanderreihen der Fäden zum
Beginn der Knüpfarbeit ist dieselbe mit der Klöppel-
arbeit verwandt. Die Verwandtschaft ist, nicht nur
in Rücksicht auf die Franse als das unbeabsichtigte,
erste Verzierungsmittel der Stoffkante,, bedeutungs-
voll. Nichts hinderte die Arbeiterin, die Fäden, statt
zu verknüpfen, zu flechten, und die Klöppelarbeit ist
ein Flechtwerk, das auf dem Geflecht des vier-
teiligen Zopfes beruht, der bereits im Altertum
bekannt war.
Abb. 2 ist eine Verbindung von Knüpf- und
Flechtwerk, von reicher und eigenartiger Wirkung.
Es ist die Nachbildung eines Stückes, das aus
IS*