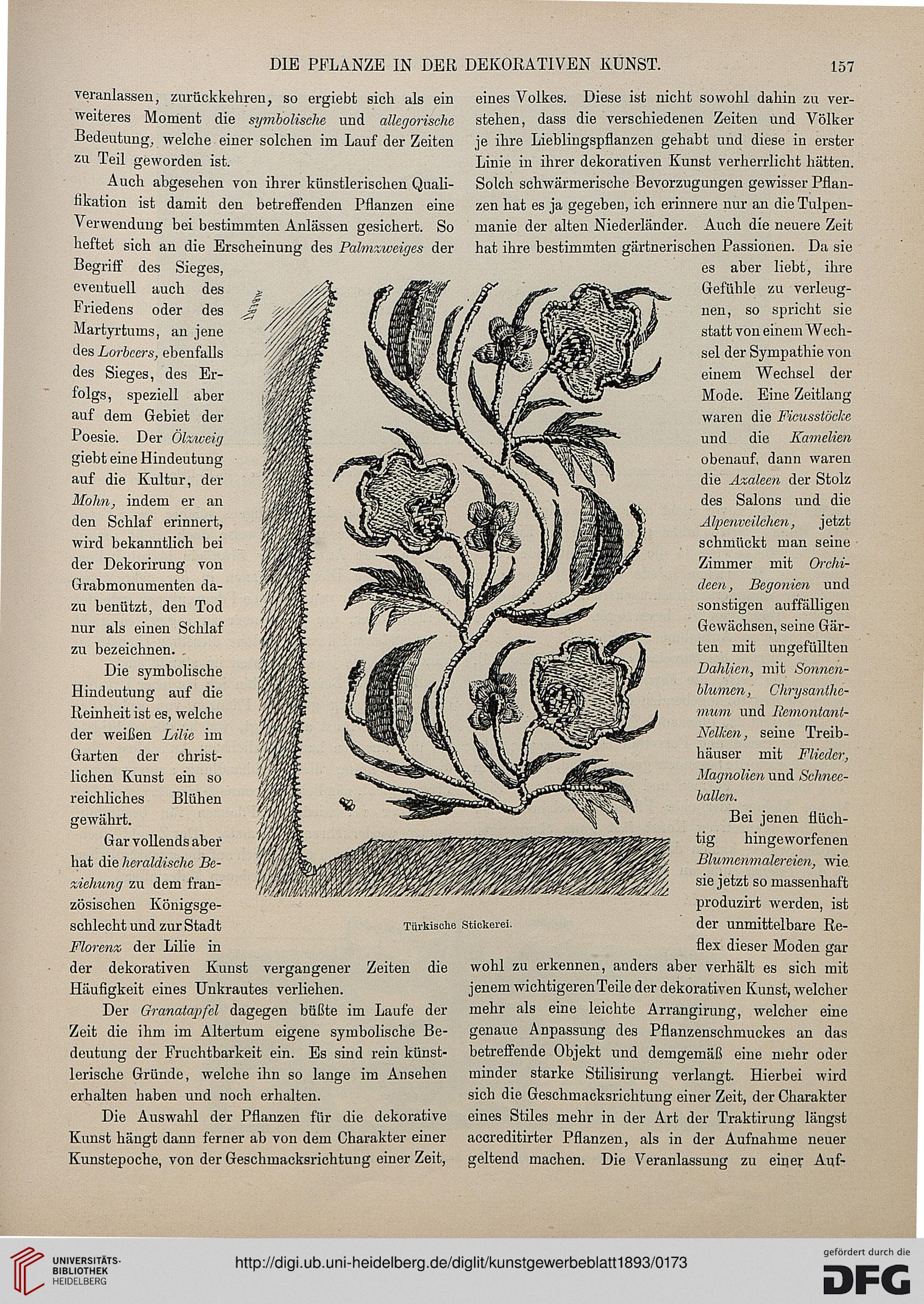DIE PFLANZE IN DER DEKORATIVEN KUNST.
157
veranlassen, zurückkehren, so ergiebt sich als ein
weiteres Moment die symbolisclie und allegorische
Bedeutung, welche einer solchen im Lauf der Zeiten
zu Teil geworden ist.
Auch abgesehen von ihrer künstlerischen Quali-
fikation ist damit den betreffenden Pflanzen eine
Verwendung bei bestimmten Anlässen gesichert. So
heftet sich an die Erscheinung des Palmzweiges der
Begriff des Sieges,
eventuell auch des
Friedens oder des
Martyrturns, an jene
des Lorbeers, ebenfalls
des Sieges, des Er-
folgs, speziell aber
auf dem Gebiet der
Poesie. Der Ölzweig
giebt eine Hindeutung
auf die Kultur, der
Mohn, indem er an
den Schlaf erinnert,
wird bekanntlich bei
der Dekorirung von
Grahmonumenten da-
zu benützt, den Tod
nur als einen Schlaf
zu bezeichnen. .
Die symbolische
Hindeutung auf die
Reinheit ist es, welche
der weißen Lilie im
Garten der christ-
lichen Kunst ein so
reichliches Blühen
gewährt.
Gar vollends aber
hat die heraldisclie Be-
ziehung zu dem fran-
zösischen Königsge-
schlecht und zur Stadt
Florenz der Lilie in
der dekorativen Kunst vergangener
Häufigkeit eines Unkrautes verliehen.
Der Granatapfel dagegen büßte im Laufe der
Zeit die ihm im Altertum eigene symbolische Be-
deutung der Fruchtbarkeit ein. Es sind rein künst-
lerische Gründe, welche ihn so lange im Ansehen
erhalten haben und noch erhalten.
Die Auswahl der Pflanzen für die dekorative
Kunst hängt dann ferner ab von dem Charakter einer
Kunstepoche, von der Geschmacksrichtung einer Zeit,
Türkische Stickerei.
Zeiten die
eines Volkes. Diese ist nicht sowohl dahin zu ver-
stehen, dass die verschiedenen Zeiten und Völker
je ihre Lieblingspflanzen gehabt und diese in erster
Linie in ihrer dekorativen Kunst verherrlicht hätten.
Solch schwärmerische Bevorzugungen gewisser Pflan-
zen hat es ja gegeben, ich erinnere nur an die Tulpen-
manie der alten Niederländer. Auch die neuere Zeit
hat ihre bestimmten gärtnerischen Passionen. Da sie
es aber liebt, ihre
Gefühle zu verleug-
nen, so spricht sie
statt von einem "Wech-
sel der Sympathie von
einem Wechsel der
Mode. Eine Zeitlang
waren die Ficusstöcke
und die Kamelien
obenauf, dann waren
die Azaleen der Stolz
des Salons und die
Alpenveilchen, jetzt
schmückt man seine
Zimmer mit Orchi-
deen, Begonien und
sonstigen auffälligen
Gewächsen, seine Gär-
ten mit ungefüllten
Dahlien, mit Sonnen-
blumen, Chrysanthe-
mum und liemontant-
Nelken, seine Treib-
häuser mit Flieder,
Magnolien und Schnee-
bällen.
Bei jenen flüch-
tig hingeworfenen
Blumenmalereien, wie
sie jetzt so massenhaft
produzirt werden, ist
der unmittelbare Re-
flex dieser Moden gar
wohl zu erkennen, anders aber verhält es sich mit
jenem wichtigeren Teile der dekorativen Kunst, welcher
mehr als eine leichte Arrangirung, welcher eine
genaue Anpassung des Pflanzenschmuckes an das
betreffende Objekt und demgemäß eine mehr oder
minder starke Stilisirung verlangt. Hierbei wird
sich die Geschmacksrichtung einer Zeit, der Charakter
eines Stiles mehr in der Art der Traktirung längst
accreditirter Pflanzen, als in der Aufnahme neuer
geltend machen.
Die Veranlassung zu einer Auf-
157
veranlassen, zurückkehren, so ergiebt sich als ein
weiteres Moment die symbolisclie und allegorische
Bedeutung, welche einer solchen im Lauf der Zeiten
zu Teil geworden ist.
Auch abgesehen von ihrer künstlerischen Quali-
fikation ist damit den betreffenden Pflanzen eine
Verwendung bei bestimmten Anlässen gesichert. So
heftet sich an die Erscheinung des Palmzweiges der
Begriff des Sieges,
eventuell auch des
Friedens oder des
Martyrturns, an jene
des Lorbeers, ebenfalls
des Sieges, des Er-
folgs, speziell aber
auf dem Gebiet der
Poesie. Der Ölzweig
giebt eine Hindeutung
auf die Kultur, der
Mohn, indem er an
den Schlaf erinnert,
wird bekanntlich bei
der Dekorirung von
Grahmonumenten da-
zu benützt, den Tod
nur als einen Schlaf
zu bezeichnen. .
Die symbolische
Hindeutung auf die
Reinheit ist es, welche
der weißen Lilie im
Garten der christ-
lichen Kunst ein so
reichliches Blühen
gewährt.
Gar vollends aber
hat die heraldisclie Be-
ziehung zu dem fran-
zösischen Königsge-
schlecht und zur Stadt
Florenz der Lilie in
der dekorativen Kunst vergangener
Häufigkeit eines Unkrautes verliehen.
Der Granatapfel dagegen büßte im Laufe der
Zeit die ihm im Altertum eigene symbolische Be-
deutung der Fruchtbarkeit ein. Es sind rein künst-
lerische Gründe, welche ihn so lange im Ansehen
erhalten haben und noch erhalten.
Die Auswahl der Pflanzen für die dekorative
Kunst hängt dann ferner ab von dem Charakter einer
Kunstepoche, von der Geschmacksrichtung einer Zeit,
Türkische Stickerei.
Zeiten die
eines Volkes. Diese ist nicht sowohl dahin zu ver-
stehen, dass die verschiedenen Zeiten und Völker
je ihre Lieblingspflanzen gehabt und diese in erster
Linie in ihrer dekorativen Kunst verherrlicht hätten.
Solch schwärmerische Bevorzugungen gewisser Pflan-
zen hat es ja gegeben, ich erinnere nur an die Tulpen-
manie der alten Niederländer. Auch die neuere Zeit
hat ihre bestimmten gärtnerischen Passionen. Da sie
es aber liebt, ihre
Gefühle zu verleug-
nen, so spricht sie
statt von einem "Wech-
sel der Sympathie von
einem Wechsel der
Mode. Eine Zeitlang
waren die Ficusstöcke
und die Kamelien
obenauf, dann waren
die Azaleen der Stolz
des Salons und die
Alpenveilchen, jetzt
schmückt man seine
Zimmer mit Orchi-
deen, Begonien und
sonstigen auffälligen
Gewächsen, seine Gär-
ten mit ungefüllten
Dahlien, mit Sonnen-
blumen, Chrysanthe-
mum und liemontant-
Nelken, seine Treib-
häuser mit Flieder,
Magnolien und Schnee-
bällen.
Bei jenen flüch-
tig hingeworfenen
Blumenmalereien, wie
sie jetzt so massenhaft
produzirt werden, ist
der unmittelbare Re-
flex dieser Moden gar
wohl zu erkennen, anders aber verhält es sich mit
jenem wichtigeren Teile der dekorativen Kunst, welcher
mehr als eine leichte Arrangirung, welcher eine
genaue Anpassung des Pflanzenschmuckes an das
betreffende Objekt und demgemäß eine mehr oder
minder starke Stilisirung verlangt. Hierbei wird
sich die Geschmacksrichtung einer Zeit, der Charakter
eines Stiles mehr in der Art der Traktirung längst
accreditirter Pflanzen, als in der Aufnahme neuer
geltend machen.
Die Veranlassung zu einer Auf-