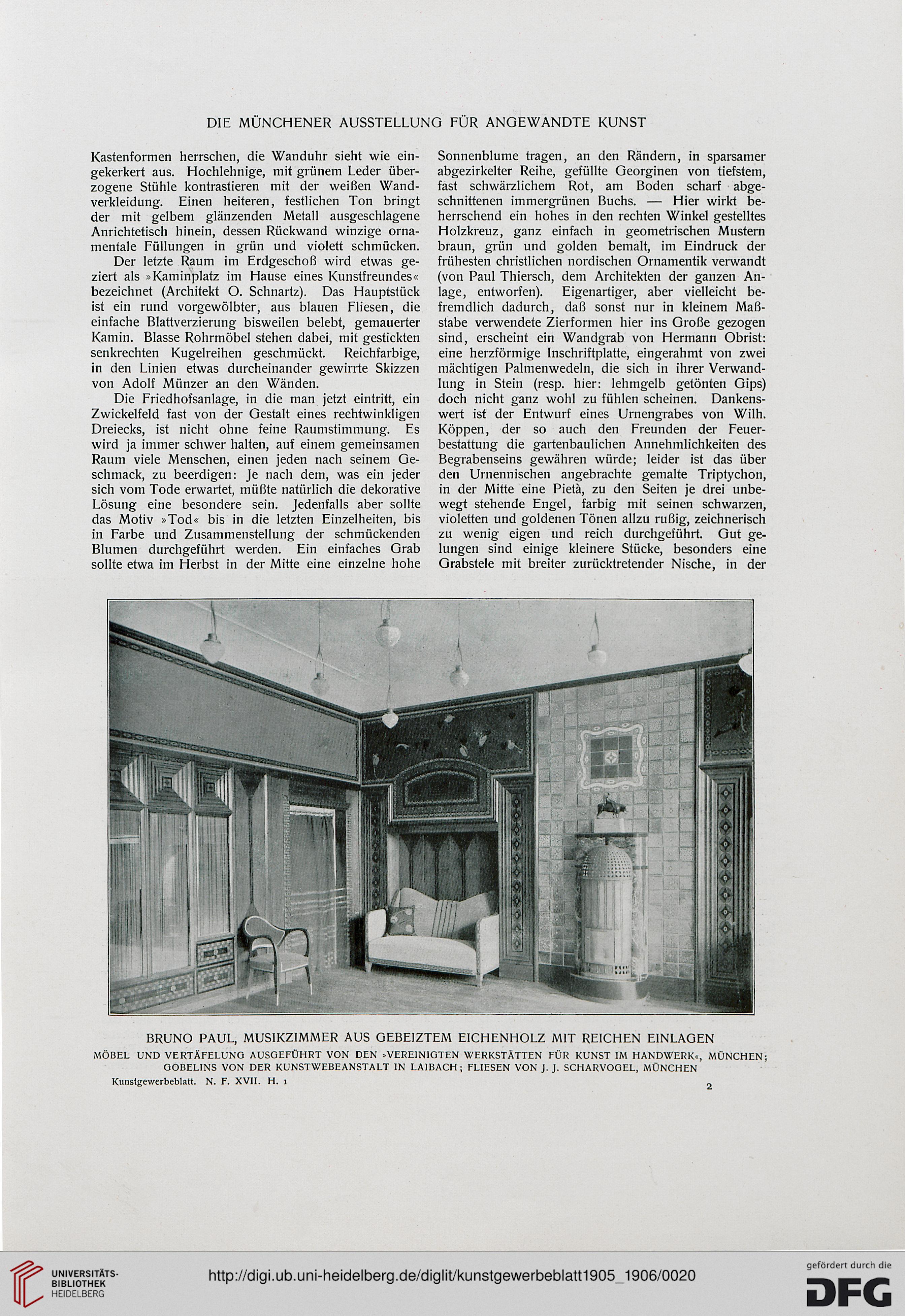DIE MÜNCHENER AUSSTELLUNG FÜR ANGEWANDTE KUNST
Kastenformen herrschen, die Wanduhr sieht wie ein-
gekerkert aus. Hochlehnige, mit grünem Leder über-
zogene Stühle kontrastieren mit der weißen Wand-
verkleidung. Einen heiteren, festlichen Ton bringt
der mit gelbem glänzenden Metall ausgeschlagene
Anrichtetisch hinein, dessen Rückwand winzige orna-
mentale Füllungen in grün und violett schmücken.
Der letzte Raum im Erdgeschoß wird etwas ge-
ziert als »Kaminplatz im Hause eines Kunstfreundes«
bezeichnet (Architekt O. Schnartz). Das Hauptstück
ist ein rund vorgewölbter, aus blauen Fliesen, die
einfache Blattverzierung bisweilen belebt, gemauerter
Kamin. Blasse Rohrmöbel stehen dabei, mit gestickten
senkrechten Kugelreihen geschmückt. Reichfarbige,
in den Linien etwas durcheinander gewirrte Skizzen
von Adolf Münzer an den Wänden.
Die Friedhofsanlage, in die man jetzt eintritt, ein
Zwickelfeld fast von der Gestalt eines rechtwinkligen
Dreiecks, ist nicht ohne feine Raumstimmung. Es
wird ja immer schwer halten, auf einem gemeinsamen
Raum viele Menschen, einen jeden nach seinem Ge-
schmack, zu beerdigen: Je nach dem, was ein jeder
sich vom Tode erwartet, müßte natürlich die dekorative
Lösung eine besondere sein. Jedenfalls aber sollte
das Motiv »Tod« bis in die letzten Einzelheiten, bis
in Farbe und Zusammenstellung der schmückenden
Blumen durchgeführt werden. Ein einfaches Grab
sollte etwa im Herbst in der Mitte eine einzelne hohe
Sonnenblume tragen, an den Rändern, in sparsamer
abgezirkelter Reihe, gefüllte Georginen von tiefstem,
fast schwärzlichem Rot, am Boden scharf abge-
schnittenen immergrünen Buchs. — Hier wirkt be-
herrschend ein hohes in den rechten Winkel gestelltes
Holzkreuz, ganz einfach in geometrischen Mustern
braun, grün und golden bemalt, im Eindruck der
frühesten christlichen nordischen Ornamentik verwandt
(von Paul Thiersch, dem Architekten der ganzen An-
lage, entworfen). Eigenartiger, aber vielleicht be-
fremdlich dadurch, daß sonst nur in kleinem Maß-
stabe verwendete Zierformen hier ins Große gezogen
sind, erscheint ein Wandgrab von Hermann Obrist:
eine herzförmige Inschriftplatte, eingerahmt von zwei
mächtigen Palmenwedeln, die sich in ihrer Verwand-
lung in Stein (resp. hier: lehmgelb getönten Gips)
doch nicht ganz wohl zu fühlen scheinen. Dankens-
wert ist der Entwurf eines Urnengrabes von Wilh.
Koppen, der so auch den Freunden der Feuer-
bestattung die gartenbaulichen Annehmlichkeiten des
Begrabenseins gewähren würde; leider ist das über
den Urnennischen angebrachte gemalte Triptychon,
in der Mitte eine Pietä, zu den Seiten je drei unbe-
wegt stehende Engel, farbig mit seinen schwarzen,
violetten und goldenen Tönen allzu rußig, zeichnerisch
zu wenig eigen und reich durchgeführt. Gut ge-
lungen sind einige kleinere Stücke, besonders eine
Grabstele mit breiter zurücktretender Nische, in der
BRUNO PAUL, MUSIKZIMMER AUS GEBEIZTEM EICHENHOLZ MIT REICHEN EINLAGEN
MÖBEL UND VERTÄFELUNO AUSGEFÜHRT VON DEN »VEREINIGTEN WERKSTÄTTEN FÜR KUNST IM HANDWERK«, MÜNCHEN;
GOBELINS VON DER KUNSTWEBEANSTALT IN LAIBACH; FLIESEN VON J. J. SCHARVOGEL, MÜNCHEN
Kunstgewerbeblatt. N. F. XVII. H. 1
Kastenformen herrschen, die Wanduhr sieht wie ein-
gekerkert aus. Hochlehnige, mit grünem Leder über-
zogene Stühle kontrastieren mit der weißen Wand-
verkleidung. Einen heiteren, festlichen Ton bringt
der mit gelbem glänzenden Metall ausgeschlagene
Anrichtetisch hinein, dessen Rückwand winzige orna-
mentale Füllungen in grün und violett schmücken.
Der letzte Raum im Erdgeschoß wird etwas ge-
ziert als »Kaminplatz im Hause eines Kunstfreundes«
bezeichnet (Architekt O. Schnartz). Das Hauptstück
ist ein rund vorgewölbter, aus blauen Fliesen, die
einfache Blattverzierung bisweilen belebt, gemauerter
Kamin. Blasse Rohrmöbel stehen dabei, mit gestickten
senkrechten Kugelreihen geschmückt. Reichfarbige,
in den Linien etwas durcheinander gewirrte Skizzen
von Adolf Münzer an den Wänden.
Die Friedhofsanlage, in die man jetzt eintritt, ein
Zwickelfeld fast von der Gestalt eines rechtwinkligen
Dreiecks, ist nicht ohne feine Raumstimmung. Es
wird ja immer schwer halten, auf einem gemeinsamen
Raum viele Menschen, einen jeden nach seinem Ge-
schmack, zu beerdigen: Je nach dem, was ein jeder
sich vom Tode erwartet, müßte natürlich die dekorative
Lösung eine besondere sein. Jedenfalls aber sollte
das Motiv »Tod« bis in die letzten Einzelheiten, bis
in Farbe und Zusammenstellung der schmückenden
Blumen durchgeführt werden. Ein einfaches Grab
sollte etwa im Herbst in der Mitte eine einzelne hohe
Sonnenblume tragen, an den Rändern, in sparsamer
abgezirkelter Reihe, gefüllte Georginen von tiefstem,
fast schwärzlichem Rot, am Boden scharf abge-
schnittenen immergrünen Buchs. — Hier wirkt be-
herrschend ein hohes in den rechten Winkel gestelltes
Holzkreuz, ganz einfach in geometrischen Mustern
braun, grün und golden bemalt, im Eindruck der
frühesten christlichen nordischen Ornamentik verwandt
(von Paul Thiersch, dem Architekten der ganzen An-
lage, entworfen). Eigenartiger, aber vielleicht be-
fremdlich dadurch, daß sonst nur in kleinem Maß-
stabe verwendete Zierformen hier ins Große gezogen
sind, erscheint ein Wandgrab von Hermann Obrist:
eine herzförmige Inschriftplatte, eingerahmt von zwei
mächtigen Palmenwedeln, die sich in ihrer Verwand-
lung in Stein (resp. hier: lehmgelb getönten Gips)
doch nicht ganz wohl zu fühlen scheinen. Dankens-
wert ist der Entwurf eines Urnengrabes von Wilh.
Koppen, der so auch den Freunden der Feuer-
bestattung die gartenbaulichen Annehmlichkeiten des
Begrabenseins gewähren würde; leider ist das über
den Urnennischen angebrachte gemalte Triptychon,
in der Mitte eine Pietä, zu den Seiten je drei unbe-
wegt stehende Engel, farbig mit seinen schwarzen,
violetten und goldenen Tönen allzu rußig, zeichnerisch
zu wenig eigen und reich durchgeführt. Gut ge-
lungen sind einige kleinere Stücke, besonders eine
Grabstele mit breiter zurücktretender Nische, in der
BRUNO PAUL, MUSIKZIMMER AUS GEBEIZTEM EICHENHOLZ MIT REICHEN EINLAGEN
MÖBEL UND VERTÄFELUNO AUSGEFÜHRT VON DEN »VEREINIGTEN WERKSTÄTTEN FÜR KUNST IM HANDWERK«, MÜNCHEN;
GOBELINS VON DER KUNSTWEBEANSTALT IN LAIBACH; FLIESEN VON J. J. SCHARVOGEL, MÜNCHEN
Kunstgewerbeblatt. N. F. XVII. H. 1