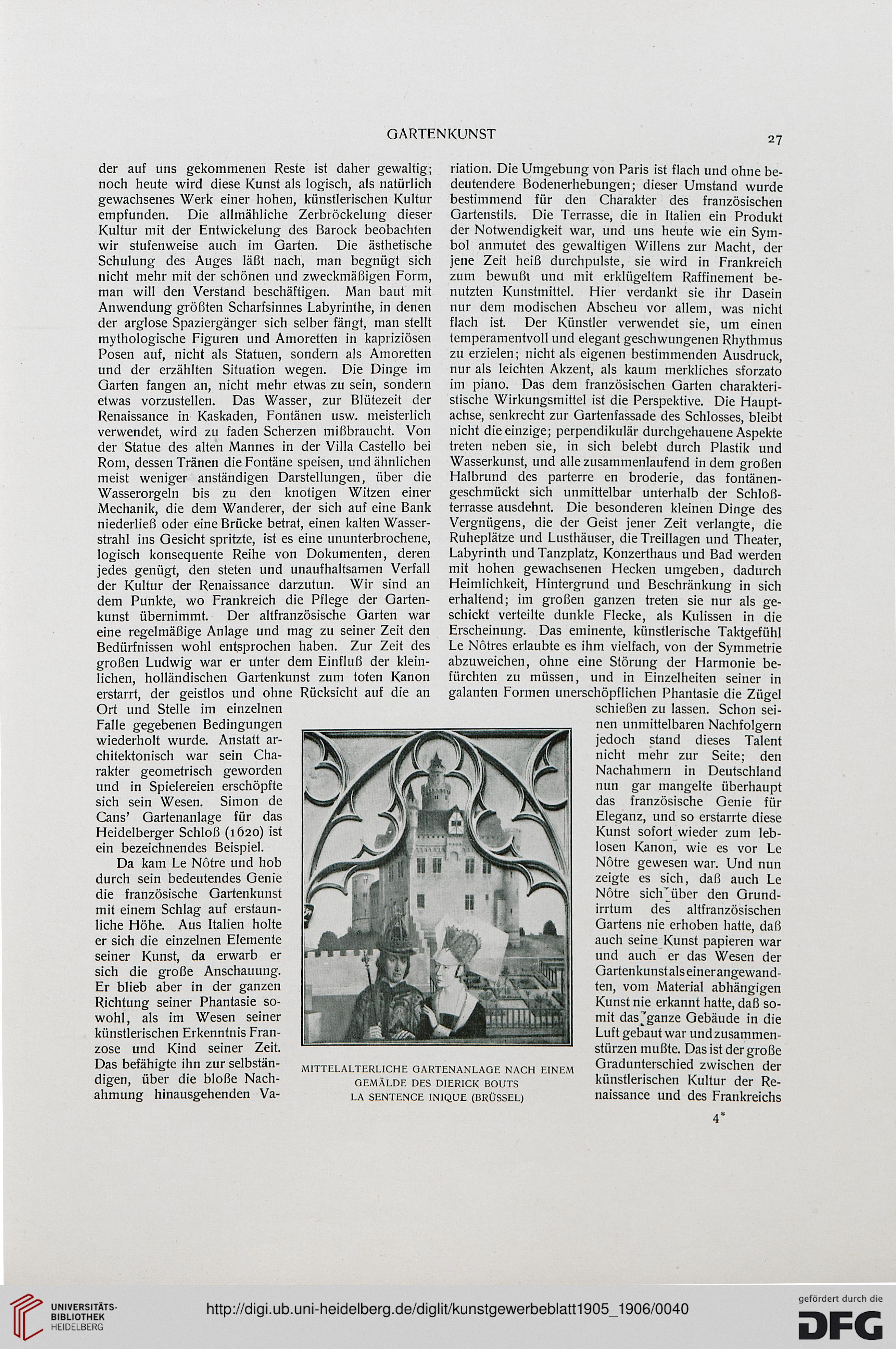GARTENKUNST
27
der auf uns gekommenen Reste ist daher gewaltig;
noch heute wird diese Kunst als logisch, als natürlich
gewachsenes Werk einer hohen, künstlerischen Kultur
empfunden. Die allmähliche ZerbrÖckelung dieser
Kultur mit der Entwickelung des Barock beobachten
wir stufenweise auch im Garten. Die ästhetische
Schulung des Auges läßt nach, man begnügt sich
nicht mehr mit der schönen und zweckmäßigen Form,
man will den Verstand beschäftigen. Man baut mit
Anwendung größten Scharfsinnes Labyrinthe, in denen
der arglose Spaziergänger sich selber fängt, man stellt
mythologische Figuren und Amoretten in kapriziösen
Posen auf, nicht als Statuen, sondern als Amoretten
und der erzählten Situation wegen. Die Dinge im
Garten fangen an, nicht mehr etwas zu sein, sondern
etwas vorzustellen. Das Wasser, zur Blütezeit der
Renaissance in Kaskaden, Fontänen usw. meisterlich
verwendet, wird zu faden Scherzen mißbraucht. Von
der Statue des alten Mannes in der Villa Castello bei
Rom, dessen Tränen die Fontäne speisen, und ähnlichen
meist weniger anständigen Darstellungen, über die
Wasserorgeln bis zu den knotigen Witzen einer
Mechanik, die dem Wanderer, der sich auf eine Bank
niederließ oder eine Brücke betrat, einen kalten Wasser-
strahl ins Gesicht spritzte, ist es eine ununterbrochene,
logisch konsequente Reihe von Dokumenten, deren
jedes genügt, den steten und unaufhaltsamen Verfall
der Kultur der Renaissance darzutun. Wir sind an
dem Punkte, wo Frankreich die Pflege der Garten-
kunst übernimmt. Der altfranzösische Garten war
eine regelmäßige Anlage und mag zu seiner Zeit den
Bedürfnissen wohl entsprochen haben. Zur Zeit des
großen Ludwig war er unter dem Einfluß der klein-
lichen, holländischen Gartenkunst zum toten Kanon
erstarrt, der geistlos und ohne Rücksicht auf die an
Ort und Stelle im einzelnen
Falle gegebenen Bedingungen
wiederholt wurde. Anstatt ar-
chitektonisch war sein Cha-
rakter geometrisch geworden
und in Spielereien erschöpfte
sich sein Wesen. Simon de
Cans' Gartenanlage für das
Heidelberger Schloß (1620) ist
ein bezeichnendes Beispiel.
Da kam Le Nötre und hob
durch sein bedeutendes Genie
die französische Gartenkunst
mit einem Schlag auf erstaun-
liche Höhe. Aus Italien holte
er sich die einzelnen Elemente
seiner Kunst, da erwarb er
sich die große Anschauung.
Er blieb aber in der ganzen
Richtung seiner Phantasie so-
wohl, als im Wesen seiner
künstlerischen Erkenntnis Fran-
zose und Kind seiner Zeit.
Das befähigte ihn zur selbstän-
digen, über die bloße Nach-
ahmung hinausgehenden Va-
MITTELALTERLICHE GARTENANLAGE NACH EINEM
GEMÄLDE DES DIERICK BOUTS
LA SENTENCE INIQUE (BRÜSSEL)
riation. Die Umgebung von Paris ist flach und ohne be-
deutendere Bodenerhebungen; dieser Umstand wurde
bestimmend für den Charakter des französischen
Gartenstils. Die Terrasse, die in Italien ein Produkt
der Notwendigkeit war, und uns heute wie ein Sym-
bol anmutet des gewaltigen Willens zur Macht, der
jene Zeit heiß durchpulste, sie wird in Frankreich
zum bewußt und mit erklügeltem Raffinement be-
nutzten Kunstmittel. Hier verdankt sie ihr Dasein
nur dem modischen Abscheu vor allem, was nicht
flach ist. Der Künstler verwendet sie, um einen
temperamentvoll und elegant geschwungenen Rhythmus
zu erzielen; nicht als eigenen bestimmenden Ausdruck,
nur als leichten Akzent, als kaum merkliches sforzato
im piano. Das dem französischen Garten charakteri-
stische Wirkungsmittel ist die Perspektive. Die Haupt-
achse, senkrecht zur Gartenfassade des Schlosses, bleibt
nicht die einzige; perpendikulär durchgehauene Aspekte
treten neben sie, in sich belebt durch Plastik und
Wasserkunst, und alle zusammenlaufend indem großen
Halbrund des parterre en broderie, das fontänen-
geschmückt sich unmittelbar unterhalb der Schloß-
terrasse ausdehnt. Die besonderen kleinen Dinge des
Vergnügens, die der Geist jener Zeit verlangte, die
Ruheplätze und Lusthäuser, die Treillagen und Theater,
Labyrinth und Tanzplatz, Konzerthaus und Bad werden
mit hohen gewachsenen Hecken umgeben, dadurch
Heimlichkeit, Hintergrund und Beschränkung in sich
erhaltend; im großen ganzen treten sie nur als ge-
schickt verteilte dunkle Flecke, als Kulissen in die
Erscheinung. Das eminente, künstlerische Taktgefühl
Le Nötres erlaubte es ihm vielfach, von der Symmetrie
abzuweichen, ohne eine Störung der Harmonie be-
fürchten zu müssen, und in Einzelheiten seiner in
galanten Formen unerschöpflichen Phantasie die Zügel
schießen zu lassen. Schon sei-
nen unmittelbaren Nachfolgern
jedoch stand dieses Talent
nicht mehr zur Seite; den
Nachahmern in Deutschland
nun gar mangelte überhaupt
das französische Genie für
Eleganz, und so erstarrte diese
Kunst sofort wieder zum leb-
losen Kanon, wie es vor Le
Nötre gewesen war. Und nun
zeigte es sich, daß auch Le
Nötre sich/über den Grund-
irrtum des altfranzösischen
Gartens nie erhoben hatte, daß
auch seine Kunst papieren war
und auch er das Wesen der
Gartenkunst alseinerangewand-
ten, vom Material abhängigen
Kunst nie erkannt hatte, daß so-
mit das'ganze Gebäude in die
Luft gebaut war und zusammen-
stürzen mußte. Das ist der große
Gradunterschied zwischen der
künstlerischen Kultur der Re-
naissance und des Frankreichs
27
der auf uns gekommenen Reste ist daher gewaltig;
noch heute wird diese Kunst als logisch, als natürlich
gewachsenes Werk einer hohen, künstlerischen Kultur
empfunden. Die allmähliche ZerbrÖckelung dieser
Kultur mit der Entwickelung des Barock beobachten
wir stufenweise auch im Garten. Die ästhetische
Schulung des Auges läßt nach, man begnügt sich
nicht mehr mit der schönen und zweckmäßigen Form,
man will den Verstand beschäftigen. Man baut mit
Anwendung größten Scharfsinnes Labyrinthe, in denen
der arglose Spaziergänger sich selber fängt, man stellt
mythologische Figuren und Amoretten in kapriziösen
Posen auf, nicht als Statuen, sondern als Amoretten
und der erzählten Situation wegen. Die Dinge im
Garten fangen an, nicht mehr etwas zu sein, sondern
etwas vorzustellen. Das Wasser, zur Blütezeit der
Renaissance in Kaskaden, Fontänen usw. meisterlich
verwendet, wird zu faden Scherzen mißbraucht. Von
der Statue des alten Mannes in der Villa Castello bei
Rom, dessen Tränen die Fontäne speisen, und ähnlichen
meist weniger anständigen Darstellungen, über die
Wasserorgeln bis zu den knotigen Witzen einer
Mechanik, die dem Wanderer, der sich auf eine Bank
niederließ oder eine Brücke betrat, einen kalten Wasser-
strahl ins Gesicht spritzte, ist es eine ununterbrochene,
logisch konsequente Reihe von Dokumenten, deren
jedes genügt, den steten und unaufhaltsamen Verfall
der Kultur der Renaissance darzutun. Wir sind an
dem Punkte, wo Frankreich die Pflege der Garten-
kunst übernimmt. Der altfranzösische Garten war
eine regelmäßige Anlage und mag zu seiner Zeit den
Bedürfnissen wohl entsprochen haben. Zur Zeit des
großen Ludwig war er unter dem Einfluß der klein-
lichen, holländischen Gartenkunst zum toten Kanon
erstarrt, der geistlos und ohne Rücksicht auf die an
Ort und Stelle im einzelnen
Falle gegebenen Bedingungen
wiederholt wurde. Anstatt ar-
chitektonisch war sein Cha-
rakter geometrisch geworden
und in Spielereien erschöpfte
sich sein Wesen. Simon de
Cans' Gartenanlage für das
Heidelberger Schloß (1620) ist
ein bezeichnendes Beispiel.
Da kam Le Nötre und hob
durch sein bedeutendes Genie
die französische Gartenkunst
mit einem Schlag auf erstaun-
liche Höhe. Aus Italien holte
er sich die einzelnen Elemente
seiner Kunst, da erwarb er
sich die große Anschauung.
Er blieb aber in der ganzen
Richtung seiner Phantasie so-
wohl, als im Wesen seiner
künstlerischen Erkenntnis Fran-
zose und Kind seiner Zeit.
Das befähigte ihn zur selbstän-
digen, über die bloße Nach-
ahmung hinausgehenden Va-
MITTELALTERLICHE GARTENANLAGE NACH EINEM
GEMÄLDE DES DIERICK BOUTS
LA SENTENCE INIQUE (BRÜSSEL)
riation. Die Umgebung von Paris ist flach und ohne be-
deutendere Bodenerhebungen; dieser Umstand wurde
bestimmend für den Charakter des französischen
Gartenstils. Die Terrasse, die in Italien ein Produkt
der Notwendigkeit war, und uns heute wie ein Sym-
bol anmutet des gewaltigen Willens zur Macht, der
jene Zeit heiß durchpulste, sie wird in Frankreich
zum bewußt und mit erklügeltem Raffinement be-
nutzten Kunstmittel. Hier verdankt sie ihr Dasein
nur dem modischen Abscheu vor allem, was nicht
flach ist. Der Künstler verwendet sie, um einen
temperamentvoll und elegant geschwungenen Rhythmus
zu erzielen; nicht als eigenen bestimmenden Ausdruck,
nur als leichten Akzent, als kaum merkliches sforzato
im piano. Das dem französischen Garten charakteri-
stische Wirkungsmittel ist die Perspektive. Die Haupt-
achse, senkrecht zur Gartenfassade des Schlosses, bleibt
nicht die einzige; perpendikulär durchgehauene Aspekte
treten neben sie, in sich belebt durch Plastik und
Wasserkunst, und alle zusammenlaufend indem großen
Halbrund des parterre en broderie, das fontänen-
geschmückt sich unmittelbar unterhalb der Schloß-
terrasse ausdehnt. Die besonderen kleinen Dinge des
Vergnügens, die der Geist jener Zeit verlangte, die
Ruheplätze und Lusthäuser, die Treillagen und Theater,
Labyrinth und Tanzplatz, Konzerthaus und Bad werden
mit hohen gewachsenen Hecken umgeben, dadurch
Heimlichkeit, Hintergrund und Beschränkung in sich
erhaltend; im großen ganzen treten sie nur als ge-
schickt verteilte dunkle Flecke, als Kulissen in die
Erscheinung. Das eminente, künstlerische Taktgefühl
Le Nötres erlaubte es ihm vielfach, von der Symmetrie
abzuweichen, ohne eine Störung der Harmonie be-
fürchten zu müssen, und in Einzelheiten seiner in
galanten Formen unerschöpflichen Phantasie die Zügel
schießen zu lassen. Schon sei-
nen unmittelbaren Nachfolgern
jedoch stand dieses Talent
nicht mehr zur Seite; den
Nachahmern in Deutschland
nun gar mangelte überhaupt
das französische Genie für
Eleganz, und so erstarrte diese
Kunst sofort wieder zum leb-
losen Kanon, wie es vor Le
Nötre gewesen war. Und nun
zeigte es sich, daß auch Le
Nötre sich/über den Grund-
irrtum des altfranzösischen
Gartens nie erhoben hatte, daß
auch seine Kunst papieren war
und auch er das Wesen der
Gartenkunst alseinerangewand-
ten, vom Material abhängigen
Kunst nie erkannt hatte, daß so-
mit das'ganze Gebäude in die
Luft gebaut war und zusammen-
stürzen mußte. Das ist der große
Gradunterschied zwischen der
künstlerischen Kultur der Re-
naissance und des Frankreichs