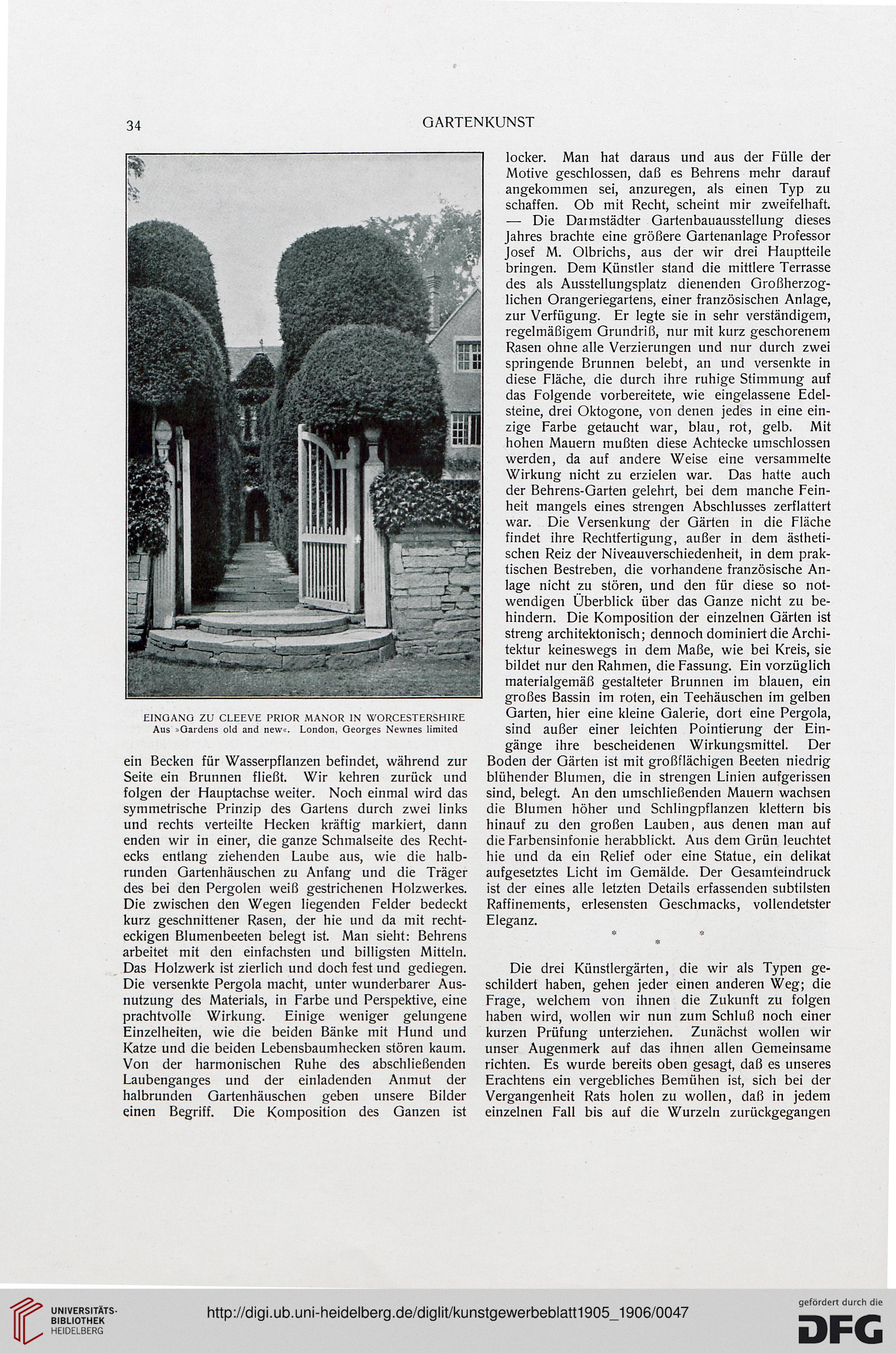34
GARTENKUNST
EINGANG ZU CLEEVE PRIOR MANOR IN WORCESTERSHIRE
Aus »Gardens old and new«. London, Georges Newnes limited
ein Becken für Wasserpflanzen befindet, während zur
Seite ein Brunnen fließt. Wir kehren zurück und
folgen der Hauptachse weiter. Noch einmal wird das
symmetrische Prinzip des Gartens durch zwei links
und rechts verteilte Hecken kräftig markiert, dann
enden wir in einer, die ganze Schmalseite des Recht-
ecks entlang ziehenden Laube aus, wie die halb-
runden Gartenhäuschen zu Anfang und die Träger
des bei den Pergolen weiß gestrichenen Holzwerkes.
Die zwischen den Wegen liegenden Felder bedeckt
kurz geschnittener Rasen, der hie und da mit recht-
eckigen Blumenbeeten belegt ist. Man sieht: Behrens
arbeitet mit den einfachsten und billigsten Mitteln.
Das Holzwerk ist zierlich und doch fest und gediegen.
Die versenkte Pergola macht, unter wunderbarer Aus-
nutzung des Materials, in Farbe und Perspektive, eine
prachtvolle Wirkung. Einige weniger gelungene
Einzelheiten, wie die beiden Bänke mit Hund und
Katze und die beiden Lebensbaumhecken stören kaum.
Von der harmonischen Ruhe des abschließenden
Laubenganges und der einladenden Anmut der
halbrunden Gartenhäuschen geben unsere Bilder
einen Begriff. Die Komposition des Ganzen ist
locker. Man hat daraus und aus der Fülle der
Motive geschlossen, daß es Behrens mehr darauf
angekommen sei, anzuregen, als einen Typ zu
schaffen. Ob mit Recht, scheint mir zweifelhaft.
— Die Darmstädter Gartenbauausstellung dieses
Jahres brachte eine größere Gartenanlage Professor
Josef M. Olbrichs, aus der wir drei Hauptteile
bringen. Dem Künstler stand die mittlere Terrasse
des als Ausstellungsplatz dienenden Großherzog-
lichen Orangeriegartens, einer französischen Anlage,
zur Verfügung. Er legte sie in sehr verständigem,
regelmäßigem Grundriß, nur mit kurz geschorenem
Rasen ohne alle Verzierungen und nur durch zwei
springende Brunnen belebt, an und versenkte in
diese Fläche, die durch ihre ruhige Stimmung auf
das Folgende vorbereitete, wie eingelassene Edel-
steine, drei Oktogone, von denen jedes in eine ein-
zige Farbe getaucht war, blau, rot, gelb. Mit
hohen Mauern mußten diese Achtecke umschlossen
werden, da auf andere Weise eine versammelte
Wirkung nicht zu erzielen war. Das hatte auch
der Behrens-Garten gelehrt, bei dem manche Fein-
heit mangels eines strengen Abschlusses zerflattert
war. Die Versenkung der Gärten in die Fläche
findet ihre Rechtfertigung, außer in dem ästheti-
schen Reiz der Niveauverschiedenheit, in dem prak-
tischen Bestreben, die vorhandene französische An-
lage nicht zu stören, und den für diese so not-
wendigen Überblick über das Ganze nicht zu be-
hindern. Die Komposition der einzelnen Gärten ist
streng architektonisch; dennoch dominiert die Archi-
tektur keineswegs in dem Maße, wie bei Kreis, sie
bildet nur den Rahmen, die Fassung. Ein vorzüglich
materialgemäß gestalteter Brunnen im blauen, ein
großes Bassin im roten, ein Teehäuschen im gelben
Garten, hier eine kleine Galerie, dort eine Pergola,
sind außer einer leichten Pointierung der Ein-
gänge ihre bescheidenen Wirkungsmittel. Der
Boden der Gärten ist mit großflächigen Beeten niedrig
blühender Blumen, die in strengen Linien aufgerissen
sind, belegt. An den umschließenden Mauern wachsen
die Blumen höher und Schlingpflanzen klettern bis
hinauf zu den großen Lauben, aus denen man auf
die Farbensinfonie herabblickt. Aus dem Grün leuchtet
hie und da ein Relief oder eine Statue, ein delikat
aufgesetztes Licht im Gemälde. Der Gesamteindruck
ist der eines alle letzten Details erfassenden subtilsten
Raffinements, erlesensten Geschmacks, vollendetster
Eleganz.
Die drei Künstlergärten, die wir als Typen ge-
schildert haben, gehen jeder einen anderen Weg; die
Frage, welchem von ihnen die Zukunft zu folgen
haben wird, wollen wir nun zum Schluß noch einer
kurzen Prüfung unterziehen. Zunächst wollen wir
unser Augenmerk auf das ihnen allen Gemeinsame
richten. Es wurde bereits oben gesagt, daß es unseres
Erachtens ein vergebliches Bemühen ist, sich bei der
Vergangenheit Rats holen zu wollen, daß in jedem
einzelnen Fall bis auf die Wurzeln zurückgegangen
GARTENKUNST
EINGANG ZU CLEEVE PRIOR MANOR IN WORCESTERSHIRE
Aus »Gardens old and new«. London, Georges Newnes limited
ein Becken für Wasserpflanzen befindet, während zur
Seite ein Brunnen fließt. Wir kehren zurück und
folgen der Hauptachse weiter. Noch einmal wird das
symmetrische Prinzip des Gartens durch zwei links
und rechts verteilte Hecken kräftig markiert, dann
enden wir in einer, die ganze Schmalseite des Recht-
ecks entlang ziehenden Laube aus, wie die halb-
runden Gartenhäuschen zu Anfang und die Träger
des bei den Pergolen weiß gestrichenen Holzwerkes.
Die zwischen den Wegen liegenden Felder bedeckt
kurz geschnittener Rasen, der hie und da mit recht-
eckigen Blumenbeeten belegt ist. Man sieht: Behrens
arbeitet mit den einfachsten und billigsten Mitteln.
Das Holzwerk ist zierlich und doch fest und gediegen.
Die versenkte Pergola macht, unter wunderbarer Aus-
nutzung des Materials, in Farbe und Perspektive, eine
prachtvolle Wirkung. Einige weniger gelungene
Einzelheiten, wie die beiden Bänke mit Hund und
Katze und die beiden Lebensbaumhecken stören kaum.
Von der harmonischen Ruhe des abschließenden
Laubenganges und der einladenden Anmut der
halbrunden Gartenhäuschen geben unsere Bilder
einen Begriff. Die Komposition des Ganzen ist
locker. Man hat daraus und aus der Fülle der
Motive geschlossen, daß es Behrens mehr darauf
angekommen sei, anzuregen, als einen Typ zu
schaffen. Ob mit Recht, scheint mir zweifelhaft.
— Die Darmstädter Gartenbauausstellung dieses
Jahres brachte eine größere Gartenanlage Professor
Josef M. Olbrichs, aus der wir drei Hauptteile
bringen. Dem Künstler stand die mittlere Terrasse
des als Ausstellungsplatz dienenden Großherzog-
lichen Orangeriegartens, einer französischen Anlage,
zur Verfügung. Er legte sie in sehr verständigem,
regelmäßigem Grundriß, nur mit kurz geschorenem
Rasen ohne alle Verzierungen und nur durch zwei
springende Brunnen belebt, an und versenkte in
diese Fläche, die durch ihre ruhige Stimmung auf
das Folgende vorbereitete, wie eingelassene Edel-
steine, drei Oktogone, von denen jedes in eine ein-
zige Farbe getaucht war, blau, rot, gelb. Mit
hohen Mauern mußten diese Achtecke umschlossen
werden, da auf andere Weise eine versammelte
Wirkung nicht zu erzielen war. Das hatte auch
der Behrens-Garten gelehrt, bei dem manche Fein-
heit mangels eines strengen Abschlusses zerflattert
war. Die Versenkung der Gärten in die Fläche
findet ihre Rechtfertigung, außer in dem ästheti-
schen Reiz der Niveauverschiedenheit, in dem prak-
tischen Bestreben, die vorhandene französische An-
lage nicht zu stören, und den für diese so not-
wendigen Überblick über das Ganze nicht zu be-
hindern. Die Komposition der einzelnen Gärten ist
streng architektonisch; dennoch dominiert die Archi-
tektur keineswegs in dem Maße, wie bei Kreis, sie
bildet nur den Rahmen, die Fassung. Ein vorzüglich
materialgemäß gestalteter Brunnen im blauen, ein
großes Bassin im roten, ein Teehäuschen im gelben
Garten, hier eine kleine Galerie, dort eine Pergola,
sind außer einer leichten Pointierung der Ein-
gänge ihre bescheidenen Wirkungsmittel. Der
Boden der Gärten ist mit großflächigen Beeten niedrig
blühender Blumen, die in strengen Linien aufgerissen
sind, belegt. An den umschließenden Mauern wachsen
die Blumen höher und Schlingpflanzen klettern bis
hinauf zu den großen Lauben, aus denen man auf
die Farbensinfonie herabblickt. Aus dem Grün leuchtet
hie und da ein Relief oder eine Statue, ein delikat
aufgesetztes Licht im Gemälde. Der Gesamteindruck
ist der eines alle letzten Details erfassenden subtilsten
Raffinements, erlesensten Geschmacks, vollendetster
Eleganz.
Die drei Künstlergärten, die wir als Typen ge-
schildert haben, gehen jeder einen anderen Weg; die
Frage, welchem von ihnen die Zukunft zu folgen
haben wird, wollen wir nun zum Schluß noch einer
kurzen Prüfung unterziehen. Zunächst wollen wir
unser Augenmerk auf das ihnen allen Gemeinsame
richten. Es wurde bereits oben gesagt, daß es unseres
Erachtens ein vergebliches Bemühen ist, sich bei der
Vergangenheit Rats holen zu wollen, daß in jedem
einzelnen Fall bis auf die Wurzeln zurückgegangen