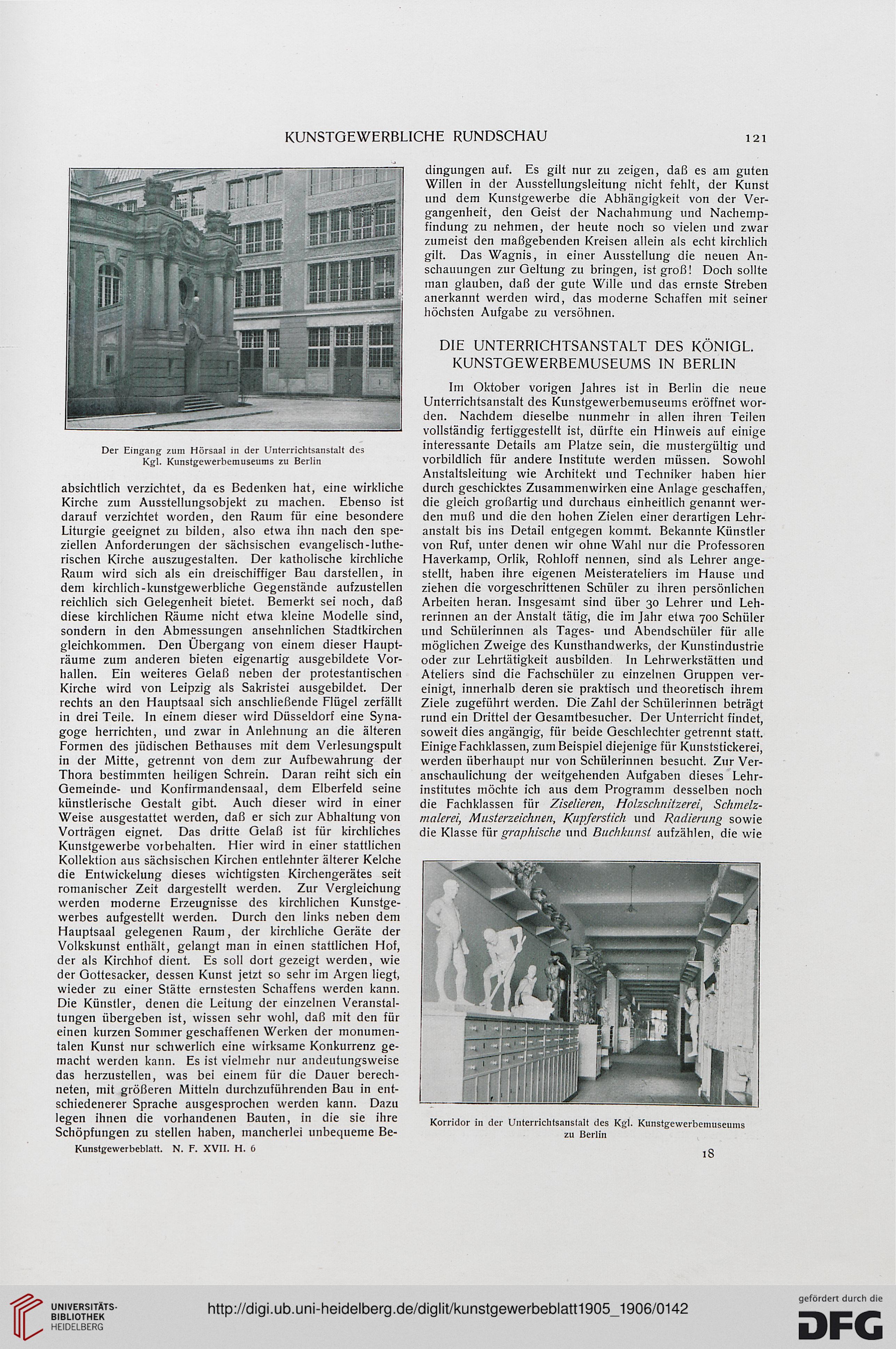KUNSTGEWERBLICHE RUNDSCHAU
121
Der Eingang zum Hörsaal in der Unterrichtsanstalt des
Kgl. Kunstgewerbemuseums zu Berlin
absichtlich verzichtet, da es Bedenken hat, eine wirkliche
Kirche zum Ausstellungsobjekt zu machen. Ebenso ist
darauf verzichtet worden, den Raum für eine besondere
Liturgie geeignet zu bilden, also etwa ihn nach den spe-
ziellen Anforderungen der sächsischen evangelisch-luthe-
rischen Kirche auszugestalten. Der katholische kirchliche
Raum wird sich als ein dreischiffiger Bau darstellen, in
dem kirchlich-kunstgewerbliche Gegenstände aufzustellen
reichlich sich Gelegenheit bietet. Bemerkt sei noch, daß
diese kirchlichen Räume nicht etwa kleine Modelle sind,
sondern in den Abmessungen ansehnlichen Stadtkirchen
gleichkommen. Den Übergang von einem dieser Haupt-
räume zum anderen bieten eigenartig ausgebildete Vor-
hallen. Ein weiteres Gelaß neben der protestantischen
Kirche wird von Leipzig als Sakristei ausgebildet. Der
rechts an den Hauptsaal sich anschließende Flügel zerfällt
in drei Teile. In einem dieser wird Düsseldorf eine Syna-
goge herrichten, und zwar in Anlehnung an die älteren
Formen des jüdischen Bethauses mit dem Verlesungspult
in der Mitte, getrennt von dem zur Aufbewahrung der
Thora bestimmten heiligen Schrein. Daran reiht sich ein
Gemeinde- und Konfirmandensaal, dem Elberfeld seine
künstlerische Gestalt gibt. Auch dieser wird in einer
Weise ausgestattet werden, daß er sich zur Abhaltung von
Vorträgen eignet. Das dritte Gelaß ist für kirchliches
Kunstgewerbe vorbehalten. Hier wird in einer stattlichen
Kollektion aus sächsischen Kirchen entlehnter älterer Kelche
die Entwickelung dieses wichtigsten Kirchengerätes seit
romanischer Zeit dargestellt werden. Zur Vergleichung
werden moderne Erzeugnisse des kirchlichen Kunstge-
werbes aufgestellt werden. Durch den links neben dem
Hauptsaal gelegenen Raum, der kirchliche Geräte der
Volkskunst enthält, gelangt man in einen stattlichen Hof,
der als Kirchhof dient. Es soll dort gezeigt werden, wie
der Gottesacker, dessen Kunst jetzt so sehr im Argen liegt,
wieder zu einer Stätte ernstesten Schaffens werden kann.
Die Künstler, denen die Leitung der einzelnen Veranstal-
tungen übergeben ist, wissen sehr wohl, daß mit den für
einen kurzen Sommer geschaffenen Werken der monumen-
talen Kunst nur schwerlich eine wirksame Konkurrenz ge-
macht werden kann. Es ist vielmehr nur andeutungsweise
das herzustellen, was bei einem für die Dauer berech-
neten, mit größeren Mitteln durchzuführenden Bau in ent-
schiedenerer Sprache ausgesprochen werden kann. Dazu
legen ihnen die vorhandenen Bauten, in die sie ihre
Schöpfungen zu stellen haben, mancherlei unbequeme Be-
Kunstgewerbeblatt. N. F. XVII. H. 6
dingungen auf. Es gilt nur zu zeigen, daß es am guten
Willen in der Ausstellungsleitung nicht fehlt, der Kunst
und dem Kunstgewerbe die Abhängigkeit von der Ver-
gangenheit, den Geist der Nachahmung und Nachemp-
findung zu nehmen, der heute noch so vielen und zwar
zumeist den maßgebenden Kreisen allein als echt kirchlich
gilt. Das Wagnis, in einer Ausstellung die neuen An-
schauungen zur Geltung zu bringen, ist groß! Doch sollte
man glauben, daß der gute Wille und das ernste Streben
anerkannt werden wird, das moderne Schaffen mit seiner
höchsten Aufgabe zu versöhnen.
DIE UNTERRICHTSANSTALT DES KÖNIGL.
KUNSTGEWERBEMUSEUMS IN BERLIN
Im Oktober vorigen Jahres ist in Berlin die neue
Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums eröffnet wor-
den. Nachdem dieselbe nunmehr in allen ihren Teilen
vollständig fertiggestellt ist, dürfte ein Hinweis auf einige
interessante Details am Platze sein, die mustergültig und
vorbildlich für andere Institute werden müssen. Sowohl
Anstaltsleitung wie Architekt und Techniker haben hier
durch geschicktes Zusammenwirken eine Anlage geschaffen,
die gleich großartig und durchaus einheitlich genannt wer-
den muß und die den hohen Zielen einer derartigen Lehr-
anstalt bis ins Detail entgegen kommt. Bekannte Künstler
von Ruf, unter denen wir ohne Wahl nur die Professoren
Haverkamp, Orlik, Rohloff nennen, sind als Lehrer ange-
stellt, haben ihre eigenen Meisterateliers im Hause und
ziehen die vorgeschrittenen Schüler zu ihren persönlichen
Arbeiten heran. Insgesamt sind über 30 Lehrer und Leh-
rerinnen an der Anstalt tätig, die im Jahr etwa 700 Schüler
und Schülerinnen als Tages- und Abendschüler für alle
möglichen Zweige des Kunsthandwerks, der Kunstindustrie
oder zur Lehrtätigkeit ausbilden. In Lehrwerkstätten und
Ateliers sind die Fachschüler zu einzelnen Gruppen ver-
einigt, innerhalb deren sie praktisch und theoretisch ihrem
Ziele zugeführt werden. Die Zahl der Schülerinnen beträgt
rund ein Drittel der Gesamtbesucher. Der Unterricht findet,
soweit dies angängig, für beide Geschlechter getrennt statt.
Einige Fachklassen, zum Beispiel diejenige für Kunststickerei,
werden überhaupt nur von Schülerinnen besucht. Zur Ver-
anschaulichung der weitgehenden Aufgaben dieses Lehr-
institutes möchte ich aus dem Programm desselben noch
die Fachklassen für Ziselieren, Holzschnitzerei, Schmelz-
malerei, Musterzeichnen, Kupferstich und Radierung sowie
die Klasse im graphische und Buchkunst aufzählen, die wie
Korridor in der Unterrichtsanslalt des Kgl. Kunstgewerbemuseums
zu Berlin
18
121
Der Eingang zum Hörsaal in der Unterrichtsanstalt des
Kgl. Kunstgewerbemuseums zu Berlin
absichtlich verzichtet, da es Bedenken hat, eine wirkliche
Kirche zum Ausstellungsobjekt zu machen. Ebenso ist
darauf verzichtet worden, den Raum für eine besondere
Liturgie geeignet zu bilden, also etwa ihn nach den spe-
ziellen Anforderungen der sächsischen evangelisch-luthe-
rischen Kirche auszugestalten. Der katholische kirchliche
Raum wird sich als ein dreischiffiger Bau darstellen, in
dem kirchlich-kunstgewerbliche Gegenstände aufzustellen
reichlich sich Gelegenheit bietet. Bemerkt sei noch, daß
diese kirchlichen Räume nicht etwa kleine Modelle sind,
sondern in den Abmessungen ansehnlichen Stadtkirchen
gleichkommen. Den Übergang von einem dieser Haupt-
räume zum anderen bieten eigenartig ausgebildete Vor-
hallen. Ein weiteres Gelaß neben der protestantischen
Kirche wird von Leipzig als Sakristei ausgebildet. Der
rechts an den Hauptsaal sich anschließende Flügel zerfällt
in drei Teile. In einem dieser wird Düsseldorf eine Syna-
goge herrichten, und zwar in Anlehnung an die älteren
Formen des jüdischen Bethauses mit dem Verlesungspult
in der Mitte, getrennt von dem zur Aufbewahrung der
Thora bestimmten heiligen Schrein. Daran reiht sich ein
Gemeinde- und Konfirmandensaal, dem Elberfeld seine
künstlerische Gestalt gibt. Auch dieser wird in einer
Weise ausgestattet werden, daß er sich zur Abhaltung von
Vorträgen eignet. Das dritte Gelaß ist für kirchliches
Kunstgewerbe vorbehalten. Hier wird in einer stattlichen
Kollektion aus sächsischen Kirchen entlehnter älterer Kelche
die Entwickelung dieses wichtigsten Kirchengerätes seit
romanischer Zeit dargestellt werden. Zur Vergleichung
werden moderne Erzeugnisse des kirchlichen Kunstge-
werbes aufgestellt werden. Durch den links neben dem
Hauptsaal gelegenen Raum, der kirchliche Geräte der
Volkskunst enthält, gelangt man in einen stattlichen Hof,
der als Kirchhof dient. Es soll dort gezeigt werden, wie
der Gottesacker, dessen Kunst jetzt so sehr im Argen liegt,
wieder zu einer Stätte ernstesten Schaffens werden kann.
Die Künstler, denen die Leitung der einzelnen Veranstal-
tungen übergeben ist, wissen sehr wohl, daß mit den für
einen kurzen Sommer geschaffenen Werken der monumen-
talen Kunst nur schwerlich eine wirksame Konkurrenz ge-
macht werden kann. Es ist vielmehr nur andeutungsweise
das herzustellen, was bei einem für die Dauer berech-
neten, mit größeren Mitteln durchzuführenden Bau in ent-
schiedenerer Sprache ausgesprochen werden kann. Dazu
legen ihnen die vorhandenen Bauten, in die sie ihre
Schöpfungen zu stellen haben, mancherlei unbequeme Be-
Kunstgewerbeblatt. N. F. XVII. H. 6
dingungen auf. Es gilt nur zu zeigen, daß es am guten
Willen in der Ausstellungsleitung nicht fehlt, der Kunst
und dem Kunstgewerbe die Abhängigkeit von der Ver-
gangenheit, den Geist der Nachahmung und Nachemp-
findung zu nehmen, der heute noch so vielen und zwar
zumeist den maßgebenden Kreisen allein als echt kirchlich
gilt. Das Wagnis, in einer Ausstellung die neuen An-
schauungen zur Geltung zu bringen, ist groß! Doch sollte
man glauben, daß der gute Wille und das ernste Streben
anerkannt werden wird, das moderne Schaffen mit seiner
höchsten Aufgabe zu versöhnen.
DIE UNTERRICHTSANSTALT DES KÖNIGL.
KUNSTGEWERBEMUSEUMS IN BERLIN
Im Oktober vorigen Jahres ist in Berlin die neue
Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums eröffnet wor-
den. Nachdem dieselbe nunmehr in allen ihren Teilen
vollständig fertiggestellt ist, dürfte ein Hinweis auf einige
interessante Details am Platze sein, die mustergültig und
vorbildlich für andere Institute werden müssen. Sowohl
Anstaltsleitung wie Architekt und Techniker haben hier
durch geschicktes Zusammenwirken eine Anlage geschaffen,
die gleich großartig und durchaus einheitlich genannt wer-
den muß und die den hohen Zielen einer derartigen Lehr-
anstalt bis ins Detail entgegen kommt. Bekannte Künstler
von Ruf, unter denen wir ohne Wahl nur die Professoren
Haverkamp, Orlik, Rohloff nennen, sind als Lehrer ange-
stellt, haben ihre eigenen Meisterateliers im Hause und
ziehen die vorgeschrittenen Schüler zu ihren persönlichen
Arbeiten heran. Insgesamt sind über 30 Lehrer und Leh-
rerinnen an der Anstalt tätig, die im Jahr etwa 700 Schüler
und Schülerinnen als Tages- und Abendschüler für alle
möglichen Zweige des Kunsthandwerks, der Kunstindustrie
oder zur Lehrtätigkeit ausbilden. In Lehrwerkstätten und
Ateliers sind die Fachschüler zu einzelnen Gruppen ver-
einigt, innerhalb deren sie praktisch und theoretisch ihrem
Ziele zugeführt werden. Die Zahl der Schülerinnen beträgt
rund ein Drittel der Gesamtbesucher. Der Unterricht findet,
soweit dies angängig, für beide Geschlechter getrennt statt.
Einige Fachklassen, zum Beispiel diejenige für Kunststickerei,
werden überhaupt nur von Schülerinnen besucht. Zur Ver-
anschaulichung der weitgehenden Aufgaben dieses Lehr-
institutes möchte ich aus dem Programm desselben noch
die Fachklassen für Ziselieren, Holzschnitzerei, Schmelz-
malerei, Musterzeichnen, Kupferstich und Radierung sowie
die Klasse im graphische und Buchkunst aufzählen, die wie
Korridor in der Unterrichtsanslalt des Kgl. Kunstgewerbemuseums
zu Berlin
18