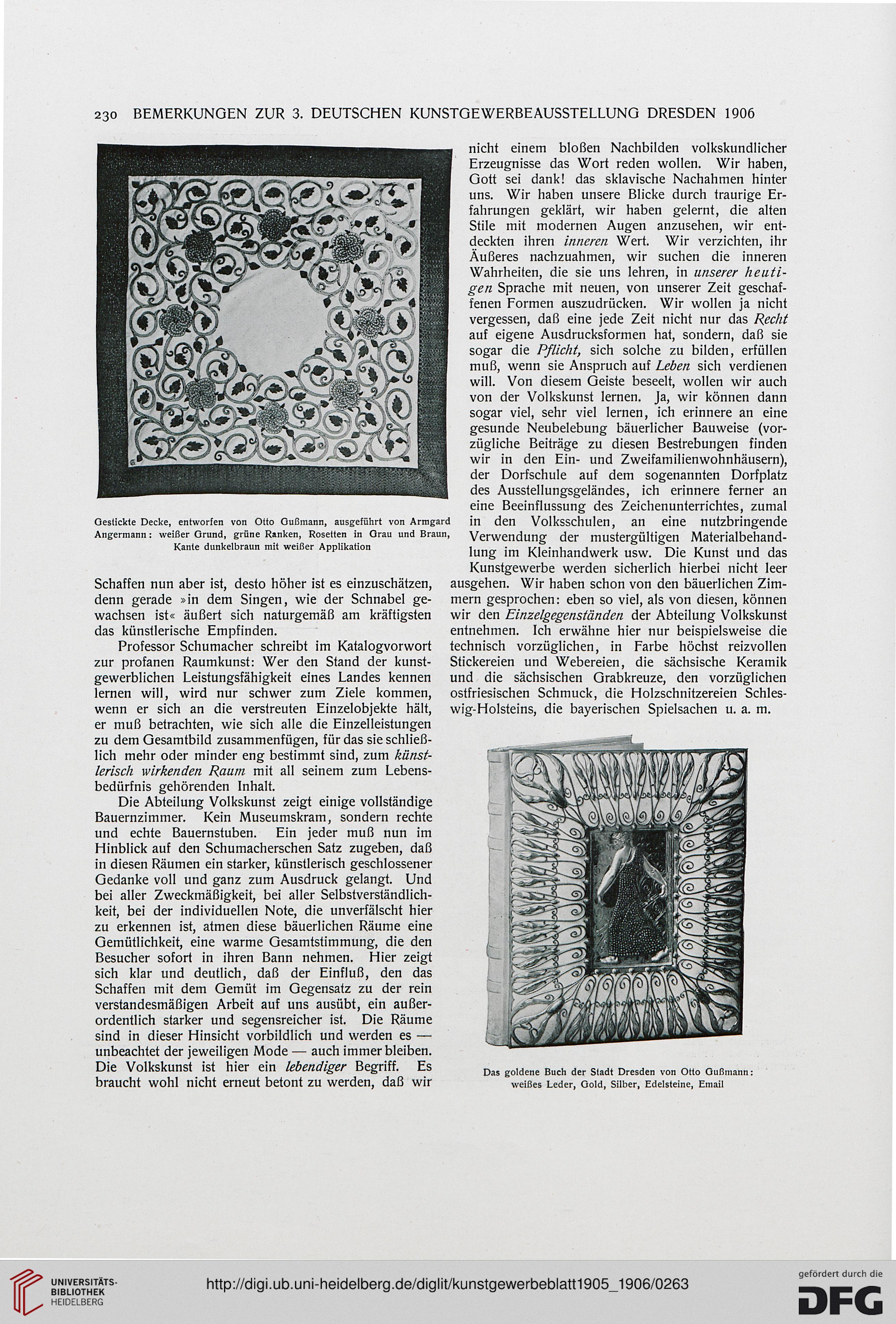230 BEMERKUNGEN ZUR 3. DEUTSCHEN KUNSTGEWERBE AUSSTELLUNG DRESDEN 1906
Geslickte Decke, entworfen von Otto Gußmann, ausgeführt von Armgard
Angermann: weißer Grund, grüne Ranken, Rosetten in Grau und Braun,
Kante dunkelbraun mit weißer Applikation
Schaffen nun aber ist, desto höher ist es einzuschätzen,
denn gerade »in dem Singen, wie der Schnabel ge-
wachsen ist« äußert sich naturgemäß am kräftigsten
das künstlerische Empfinden.
Professor Schumacher schreibt im Katalogvorwort
zur profanen Raumkunst: Wer den Stand der kunst-
gewerblichen Leistungsfähigkeit eines Landes kennen
lernen will, wird nur schwer zum Ziele kommen,
wenn er sich an die verstreuten Einzelobjekte hält,
er muß betrachten, wie sich alle die Einzelleistungen
zu dem Gesamtbild zusammenfügen, für das sie schließ-
lich mehr oder minder eng bestimmt sind, zum künst-
lerisch wirkenden Raum mit all seinem zum Lebens-
bedürfnis gehörenden Inhalt.
Die Abteilung Volkskunst zeigt einige vollständige
Bauernzimmer. Kein Museumskram, sondern rechte
und echte Bauernstuben. Ein jeder muß nun im
Hinblick auf den Schumacherschen Satz zugeben, daß
in diesen Räumen ein starker, künstlerisch geschlossener
Gedanke voll und ganz zum Ausdruck gelangt. Und
bei aller Zweckmäßigkeit, bei aller Selbstverständlich-
keit, bei der individuellen Note, die unverfälscht hier
zu erkennen ist, atmen diese bäuerlichen Räume eine
Gemütlichkeit, eine warme Gesamtstimmung, die den
Besucher sofort in ihren Bann nehmen. Hier zeigt
sich klar und deutlich, daß der Einfluß, den das
Schaffen mit dem Gemüt im Gegensatz zu der rein
verstandesmäßigen Arbeit auf uns ausübt, ein außer-
ordentlich starker und segensreicher ist. Die Räume
sind in dieser Hinsicht vorbildlich und werden es —
unbeachtet der jeweiligen Mode — auch immer bleiben.
Die Volkskunst ist hier ein lebendiger Begriff. Es
braucht wohl nicht erneut betont zu werden, daß wir
nicht einem bloßen Nachbilden volkskundlicher
Erzeugnisse das Wort reden wollen. Wir haben,
Gott sei dank! das sklavische Nachahmen hinter
uns. Wir haben unsere Blicke durch traurige Er-
fahrungen geklärt, wir haben gelernt, die alten
Stile mit modernen Augen anzusehen, wir ent-
deckten ihren inneren Wert. Wir verzichten, ihr
Äußeres nachzuahmen, wir suchen die inneren
Wahrheiten, die sie uns lehren, in unserer heuti-
gen Sprache mit neuen, von unserer Zeit geschaf-
fenen Formen auszudrücken. Wir wollen ja nicht
vergessen, daß eine jede Zeit nicht nur das Recht
auf eigene Ausdrucksformen hat, sondern, daß sie
sogar die Pflicht, sich solche zu bilden, erfüllen
muß, wenn sie Anspruch auf Leben sich verdienen
will. Von diesem Geiste beseelt, wollen wir auch
von der Volkskunst lernen. Ja, wir können dann
sogar viel, sehr viel lernen, ich erinnere an eine
gesunde Neubelebung bäuerlicher Bauweise (vor-
zügliche Beiträge zu diesen Bestrebungen finden
wir in den Ein- und Zweifamilienwohnhäusern),
der Dorfschule auf dem sogenannten Dorfplatz
des Ausstellungsgeländes, ich erinnere ferner an
eine Beeinflussung des Zeichenunterrichtes, zumal
in den Volksschulen, an eine nutzbringende
Verwendung der mustergültigen Materialbehand-
lung im Kleinhandwerk usw. Die Kunst und das
Kunstgewerbe werden sicherlich hierbei nicht leer
ausgehen. Wir haben schon von den bäuerlichen Zim-
mern gesprochen: eben so viel, als von diesen, können
wir den Einzelgegenständen der Abteilung Volkskunst
entnehmen. Ich erwähne hier nur beispielsweise die
technisch vorzüglichen, in Farbe höchst reizvollen
Stickereien und Webereien, die sächsische Keramik
und die sächsischen Grabkreuze, den vorzüglichen
ostfriesischen Schmuck, die Holzschnitzereien Schles-
wig-Holsteins, die bayerischen Spielsachen u. a. m.
Das goldene Buch der Stadt Dresden von Otto Gußmann:
weißes Leder, Gold, Silber, Edelsteine, Email
Geslickte Decke, entworfen von Otto Gußmann, ausgeführt von Armgard
Angermann: weißer Grund, grüne Ranken, Rosetten in Grau und Braun,
Kante dunkelbraun mit weißer Applikation
Schaffen nun aber ist, desto höher ist es einzuschätzen,
denn gerade »in dem Singen, wie der Schnabel ge-
wachsen ist« äußert sich naturgemäß am kräftigsten
das künstlerische Empfinden.
Professor Schumacher schreibt im Katalogvorwort
zur profanen Raumkunst: Wer den Stand der kunst-
gewerblichen Leistungsfähigkeit eines Landes kennen
lernen will, wird nur schwer zum Ziele kommen,
wenn er sich an die verstreuten Einzelobjekte hält,
er muß betrachten, wie sich alle die Einzelleistungen
zu dem Gesamtbild zusammenfügen, für das sie schließ-
lich mehr oder minder eng bestimmt sind, zum künst-
lerisch wirkenden Raum mit all seinem zum Lebens-
bedürfnis gehörenden Inhalt.
Die Abteilung Volkskunst zeigt einige vollständige
Bauernzimmer. Kein Museumskram, sondern rechte
und echte Bauernstuben. Ein jeder muß nun im
Hinblick auf den Schumacherschen Satz zugeben, daß
in diesen Räumen ein starker, künstlerisch geschlossener
Gedanke voll und ganz zum Ausdruck gelangt. Und
bei aller Zweckmäßigkeit, bei aller Selbstverständlich-
keit, bei der individuellen Note, die unverfälscht hier
zu erkennen ist, atmen diese bäuerlichen Räume eine
Gemütlichkeit, eine warme Gesamtstimmung, die den
Besucher sofort in ihren Bann nehmen. Hier zeigt
sich klar und deutlich, daß der Einfluß, den das
Schaffen mit dem Gemüt im Gegensatz zu der rein
verstandesmäßigen Arbeit auf uns ausübt, ein außer-
ordentlich starker und segensreicher ist. Die Räume
sind in dieser Hinsicht vorbildlich und werden es —
unbeachtet der jeweiligen Mode — auch immer bleiben.
Die Volkskunst ist hier ein lebendiger Begriff. Es
braucht wohl nicht erneut betont zu werden, daß wir
nicht einem bloßen Nachbilden volkskundlicher
Erzeugnisse das Wort reden wollen. Wir haben,
Gott sei dank! das sklavische Nachahmen hinter
uns. Wir haben unsere Blicke durch traurige Er-
fahrungen geklärt, wir haben gelernt, die alten
Stile mit modernen Augen anzusehen, wir ent-
deckten ihren inneren Wert. Wir verzichten, ihr
Äußeres nachzuahmen, wir suchen die inneren
Wahrheiten, die sie uns lehren, in unserer heuti-
gen Sprache mit neuen, von unserer Zeit geschaf-
fenen Formen auszudrücken. Wir wollen ja nicht
vergessen, daß eine jede Zeit nicht nur das Recht
auf eigene Ausdrucksformen hat, sondern, daß sie
sogar die Pflicht, sich solche zu bilden, erfüllen
muß, wenn sie Anspruch auf Leben sich verdienen
will. Von diesem Geiste beseelt, wollen wir auch
von der Volkskunst lernen. Ja, wir können dann
sogar viel, sehr viel lernen, ich erinnere an eine
gesunde Neubelebung bäuerlicher Bauweise (vor-
zügliche Beiträge zu diesen Bestrebungen finden
wir in den Ein- und Zweifamilienwohnhäusern),
der Dorfschule auf dem sogenannten Dorfplatz
des Ausstellungsgeländes, ich erinnere ferner an
eine Beeinflussung des Zeichenunterrichtes, zumal
in den Volksschulen, an eine nutzbringende
Verwendung der mustergültigen Materialbehand-
lung im Kleinhandwerk usw. Die Kunst und das
Kunstgewerbe werden sicherlich hierbei nicht leer
ausgehen. Wir haben schon von den bäuerlichen Zim-
mern gesprochen: eben so viel, als von diesen, können
wir den Einzelgegenständen der Abteilung Volkskunst
entnehmen. Ich erwähne hier nur beispielsweise die
technisch vorzüglichen, in Farbe höchst reizvollen
Stickereien und Webereien, die sächsische Keramik
und die sächsischen Grabkreuze, den vorzüglichen
ostfriesischen Schmuck, die Holzschnitzereien Schles-
wig-Holsteins, die bayerischen Spielsachen u. a. m.
Das goldene Buch der Stadt Dresden von Otto Gußmann:
weißes Leder, Gold, Silber, Edelsteine, Email