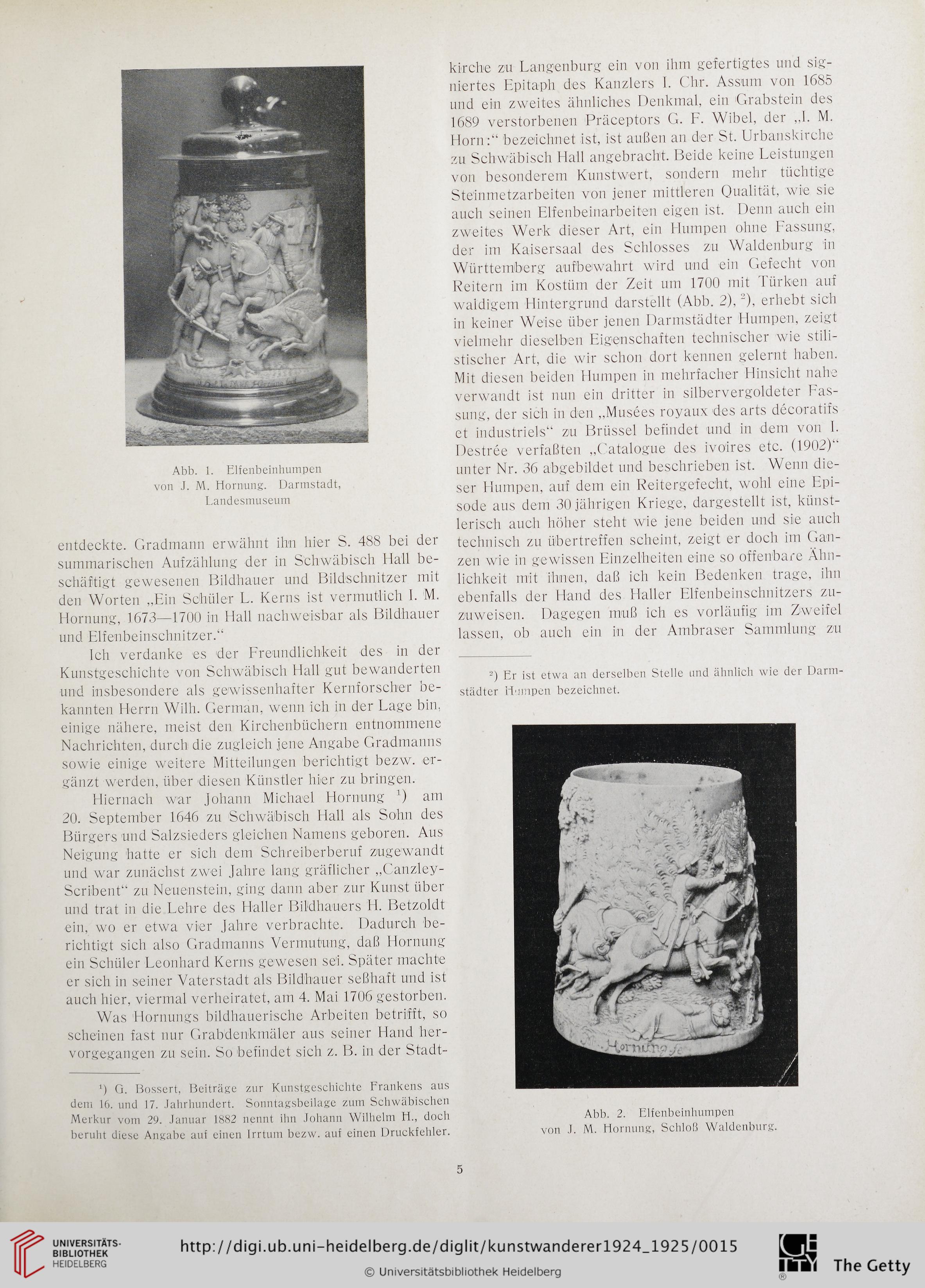Abb. 1. Elfenbeinhumpen
von .1. M. Hornung. Darmstadt,
Landesmuseum
entdeckte. Gradmann erwähnt ihn hier S. 488 bei der
summarischen Aufzählung der in Schwäbisch Hall be-
schäftigt gewesenen Bildhauer und Bildschnitzer mit
den Worten „Ein Schüler L. Kerns ist vermutlich I. M.
Hornung, 1673—1700 in Hall nachweisbar als Bildhauer
und Elfenbeinschnitzer.“
Ich verdanke es 'der Freundlichkeit des in der
Kunstgeschichte von Schwäbisch Hall gut bewanderten
und insbesondere als gewissenhafter Kernforscher be-
kannten Herrn Wilh. German, wenn ich in der Lage bin,
einige nähere, meist den Kirchenbüchern entnommene
Nachrichten, durch die zugleich jene Angabe Gradmanns
sowie einige weitere Mitteilungen berichtigt bezw. er-
gänzt werden, iiber diesen Künstler hier zu bringen.
Hiernach war johann Michael Hornung x) am
20. September 1646 zu Schwäbisch Hall als Sohn des
Bürgers und Salzsieders gleichen Namens geboren. Aus
Neigung hatte er sich dem Schreiberberuf zugewandt
und war zunächst zwei Jahre lang gräflicher „Canzley-
Scribent“ zu Neuenstein, ging dann aber zur Kunst iiber
und trat in die Lehre des Haller BiMhauers H. Betzoldt
ein, wo er etwa vier Jahre verbrachte. Dadurch be-
richtigt sich also Gradmanns Vermutung, daß Hornung
ein Schüler Leonhard Kerns gewesen se'i. Später machte
er sich in seiner Vaterstadt äls Bildhauer seßhaft und ist
auch hier, viermal verheiratet, am 4. Mai 1706 gestorben.
Was Hornungs bildhauerische Arbeiten betrifft, so
scheinen fast nur Grabdenkmäler aus seiner Hand her-
vorgegangen zu sein. So befindet sich z. B. in der Stadt-
0 G. Bosscrt, Bciträge zur Kunstgeschichte Frankens aus
dem 16. und 17. Jahrhundert. Sonntagsbeilage zum Schwäbischen
Merkur vom 29. Januar 1882 nennt ihn Johann Wilhelm H., doch
beruht diese Angabe auf einen Irrtum bezw. auf einen Druckfehler.
kirche zu Langenburg ein von ihm gefertigtes und sig-
niertes Epitaph des Kanzlers I. Chr. Assum von 1685
und ein zweites ähnliches Denkmal, ein Grabstein des
1689 verstorbenen Präceptors G. F. Wibel, der „I. M.
Horn:“ bezeichnet ist, ist außen an der St. Urbanskirche
zu Schwäbisch Hall angebrach't. Beide keine Leistungen
von besonderem Kunstwert, sondern mehr tüchtige
Steinmetzarbeiten von jener mittleren Qualität, wie sie
auch seinen Elfenbeinarbeiten eigen ist. Denn aucli ein
zweites Werk dieser Art, ein Humpen ohne Fassung,
der im Kaisersaal des Schlosses zu Waldenburg in
Württemberg aufbewahrt wird und ein Gefecht von
Reitern im Kostüm der Zeit um 1700 mit Türken auf
waldigem Hintergrund darstellt (Abb. 2),2), erhebt sich
in keiner Weise über jenen Darmstädter Humpen, zeigt
vielmehr dieselben Eigenschaften technischer wie stili-
stischer Art, die wir schon dort kennen gelernt haben.
Mit diesen beiden Humpen in mehrfacher Hinsicht nahe
verwandt ist nun ein dritter in silbervergoldeter Eas-
sung, der sicli in den „Musees royauxdes arts decoratifs
et industriels“ zu Brüssel befiudet und in dem von I.
Destree verfaßten „Catalogue des ivoires etc. (1902)“
unter Nr. 36 abgebildet und beschrieben ist. Wenn die-
ser Humpen, auf dem ein Reitergefecht, wohl eine Epi-
sode aus dem 30 jährigen Kriege, dargestellt ist, künst-
lerisch aucli höher steht wie jene beiden und sie aucli
technisch zu übertreffen scheint, zeigt er doch im Gan-
zen wie in gewissen Einzelheiten eine so offenbare Ähn-
lichkeit mit ihnen, daß ich kein Bedenken trage, ihn
ebenfalls der Hand des Haller Elfenbeinschnitzers zu-
zuweisen. Dagegen muß ich es vorläufig im Zweifel
lassen, ob auch ein in der Ambraser Sammlung zu
2) Er ist etwa an derselben Stelle und ähnlich wie der Darm-
städter Hnmpen bezeichnet.
Abb. 2. Elfenbeinhumpcn
von .1. M. Hormmg, Schloß Waldcnburg.
5