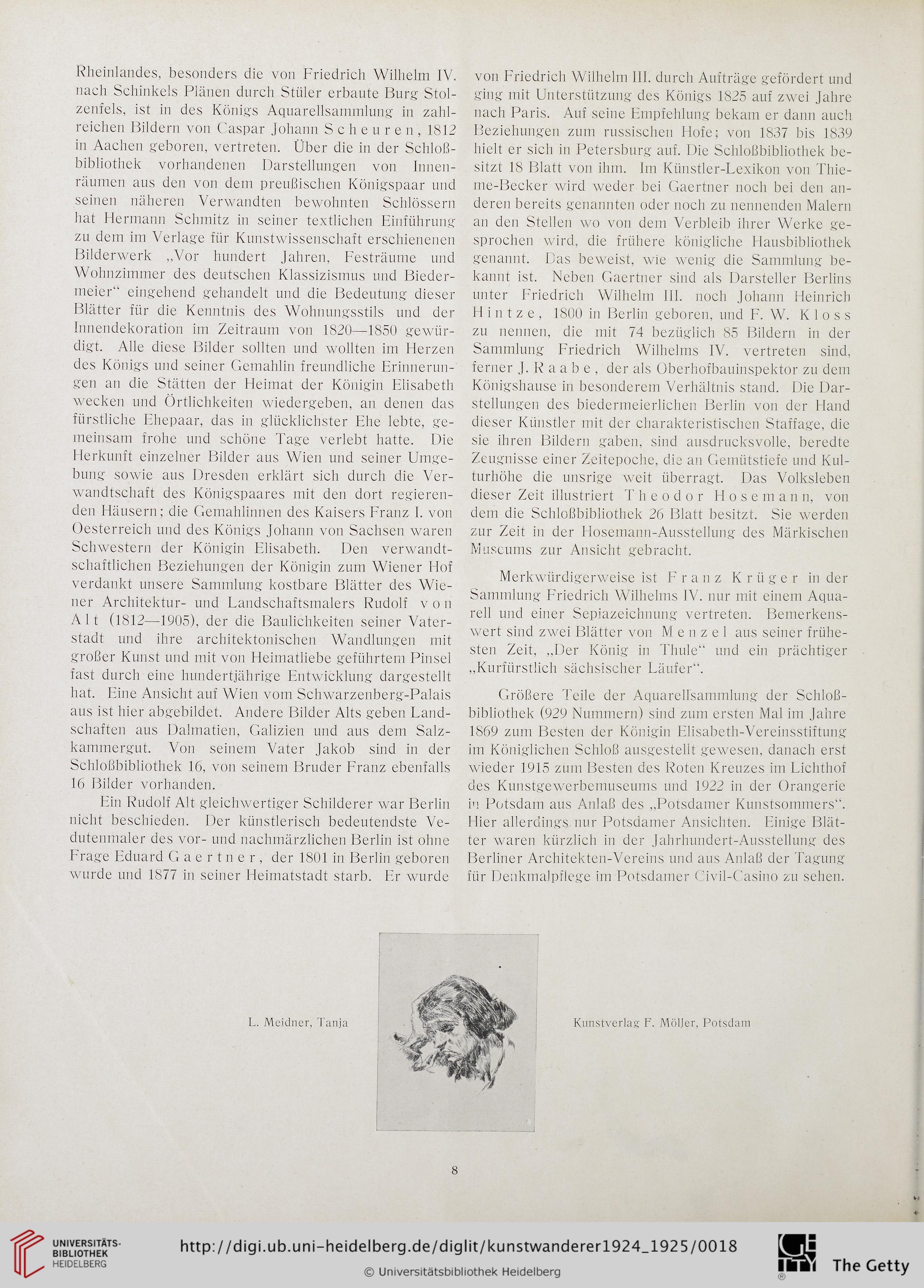Rheinlandes, besonders die von Friedrich Wilhelm IV.
nach Schinkels Plänen durch Stiiler erbaute Burg Stol-
zenfels, ist in des Königs Aquarellsammlung in zahl-
reichen Bildern von Caspar Johann S c h e u r e n , 1812
in Aachen geboren, vertreten. Über die in der Schloß-
bibliothek vorhandenen Darstellungen von Innen-
räumen aus den von dem preußischen Königspaar und
seinen näheren Verwandten bewohnten Schlössern
hat Hermann Schmitz in seiner textlichen Einfiihrung
zu dem im Verlage fiir Kunstwissenschaft erschienenen
Bilderwerk ,,Vor hundert Jahren, Festräume und
Wohnzimmer des deutschen Klassizismus und Bieder-
meier“ eingehend gehandelt und die Bedeutung dieser
Blätter fiir die Kenntnis des Wohnungsstils und der
Innendekoration im Zeitraum von 1820—1850 gewür-
digt. Alle diese Bilder sollten und wollten im Herzen
des Königs und seiner Gemahlin freundliche Erinnerun-
gen an die Stätten der Heimat der Königin Elisabeth
wecken und Örtlichkeiten wiedergeben, an denen das
fürstliche Ehepaar, das in glücklichster Ehe lebte, ge-
meinsam frohe und schöne Tage verlebt hatte. Die
Herkunft einzelner Bilder aus Wien und seiner Umge-
bung sowie aus Dresden erklärt sicli durch die Ver-
wandtschaft des Königspaares mit den dort regieren-
den Häusern; die Gemahlinnen des Kaisers Franz I. von
Oesterreich und des Königs Johann von Sachsen waren
Schwestern der Königin Elisabeth. Den verwandt-
schaftliclien Beziehungen der Königin zum Wiener Hof
verdankt unsere Sammlung kostbare Blätter des Wie-
ner Architektur- und Landschaftsmalers Rudolf v o n
Alt (1812—1905), der die Baulichkeiten seiner Vater-
stadt und ihre architektonischen Wandlungen mit
großer Kunst und mit von Heimatliebe geführtem Pinsel
fast durch eine hundertjährige Entwicklung dargestellt
hat. Eine Ansicht auf Wien vom Schwarzenberg-Palais
aus ist hier abgebildet. Audere Bilder Alts geben Land-
schaften aus Dahnatien, Galizien und aus dem Salz-
kammergut. Von seinem Vater Jakob sind in der
Schloßbibliothek 16, von seinem Bruder Franz ebenfalls
16 Bilder vorhanden.
Ein Rudolf Alt gleichwertiger Schilderer war Berliu
niclit beschieden. Der künstlerisch bedeutendste Ve-
dutenmaler des vor- und nachmärzlichen Berlin ist ohne
Frage Eduard G a e r t n e r , der 1801 in Berlin geboren
wurde und 1877 in seiner Heimatstadt starb. Er wurde
von Friedrich Wilhelm 111. durch Aufträge gefördert und
ging mit Unterstützung des Königs 1825 auf zwei Jahre
nach Paris. Auf seine Empfehlung bekam er dann auch
Beziehungen zum russischen Hofe; von 1837 bis 1839
hielt er sich in Petersburg auf. Die Schloßbibliothek be-
sitzt 18 Blatt von ihm. Im Künstler-Lexikon von Thie-
me-Becker wird weder bei Gaertner noch bei den an-
deren bereits genannten oder noch zu nennenden Malern
an den Stellen wo von dem Verbleib ihrer Werke ge-
sprochen wird, die frühere königliche Hausbibliothek
genannt. Das beweist, wie wenig die Sammlung be-
kannt ist. Neben Gaertner sind als Darsteller Berlins
unter Friedrich Wilhelm III. noch Johann Heinrich
H i n t z e , 1800 in Berlin geboren, und F. W. K 1 o s s
zu nennen, die mit 74 bezüglich 85 Bildern in der
Sammlung Friedrich Wilhelms IV. vertreten sind,
ferner J. R a a b e , der als Oberhofbauinspektor zu dem
Königshause in besonderem Verhältnis stand. Die Dar-
stellungen des biedermeierlichen Berlin von der Hand
dieser Künstler mit der charakteristischen Staffage, die
sie ihren Bildern gaben, sind ausdrucksvolle, beredte
Zeugnisse einer Zeitepoche, die an Gemütstiefe und Kul-
turhöhe die unsrige weit überragt. Das Volksleben
dieser Zeit illustriert T h e o d o r H o s e m a n n, von
dem die Schloßbibliothek 26 Blatt besitzt. Sie werden
zur Zeit in der FIosemann-Ausstellung des Märkischen
Museums zur Ansicht gebracht.
Merkwürdigerweise ist F r a n z K r ü g e r in der
Sammlung Friedrich Wilhelms IV. nur mit einem Aqua-
rell und einer Sepiazeichnung vertreten. Bemerkens-
wert sind zwei Blätter von M e n z e 1 aus seiner frühe-
sten Zeit, „Der König in Thule“ und ein prächtiger
„Kurfürstlich sächsischer Läufer“.
C.rößere Teile der Aquarellsammlung der Schloß-
bibliothek (929 Nummern) sind zum ersten Mal im Jahre
1869 zum Besten der Königin Elisabeth-Vereinsstiftung
im Königlichen Schloß ausgestellt gewesen, danach erst
wieder 1915 zum Besten des Roten Kreuzes im Lichthof
des Kunstgewerbemuseums und 1922 in der Orangerie
in Potsdam aus Anlaß des „Potsdamer Kunstsommers“.
Flier allerdings nur Potsdamer Ansichten. Einige Blät-
ter waren kürzlich in der Jahrhundert-Ausstellung des
Berliner Architekten-Vereins und aus Anlaß der Tagung
für Denkmalpflege im Potsdamer Civil-Casino zu sehen.
L. Meidner, Tanja
Kunstverlag F. Möljer, Potsdam
8
nach Schinkels Plänen durch Stiiler erbaute Burg Stol-
zenfels, ist in des Königs Aquarellsammlung in zahl-
reichen Bildern von Caspar Johann S c h e u r e n , 1812
in Aachen geboren, vertreten. Über die in der Schloß-
bibliothek vorhandenen Darstellungen von Innen-
räumen aus den von dem preußischen Königspaar und
seinen näheren Verwandten bewohnten Schlössern
hat Hermann Schmitz in seiner textlichen Einfiihrung
zu dem im Verlage fiir Kunstwissenschaft erschienenen
Bilderwerk ,,Vor hundert Jahren, Festräume und
Wohnzimmer des deutschen Klassizismus und Bieder-
meier“ eingehend gehandelt und die Bedeutung dieser
Blätter fiir die Kenntnis des Wohnungsstils und der
Innendekoration im Zeitraum von 1820—1850 gewür-
digt. Alle diese Bilder sollten und wollten im Herzen
des Königs und seiner Gemahlin freundliche Erinnerun-
gen an die Stätten der Heimat der Königin Elisabeth
wecken und Örtlichkeiten wiedergeben, an denen das
fürstliche Ehepaar, das in glücklichster Ehe lebte, ge-
meinsam frohe und schöne Tage verlebt hatte. Die
Herkunft einzelner Bilder aus Wien und seiner Umge-
bung sowie aus Dresden erklärt sicli durch die Ver-
wandtschaft des Königspaares mit den dort regieren-
den Häusern; die Gemahlinnen des Kaisers Franz I. von
Oesterreich und des Königs Johann von Sachsen waren
Schwestern der Königin Elisabeth. Den verwandt-
schaftliclien Beziehungen der Königin zum Wiener Hof
verdankt unsere Sammlung kostbare Blätter des Wie-
ner Architektur- und Landschaftsmalers Rudolf v o n
Alt (1812—1905), der die Baulichkeiten seiner Vater-
stadt und ihre architektonischen Wandlungen mit
großer Kunst und mit von Heimatliebe geführtem Pinsel
fast durch eine hundertjährige Entwicklung dargestellt
hat. Eine Ansicht auf Wien vom Schwarzenberg-Palais
aus ist hier abgebildet. Audere Bilder Alts geben Land-
schaften aus Dahnatien, Galizien und aus dem Salz-
kammergut. Von seinem Vater Jakob sind in der
Schloßbibliothek 16, von seinem Bruder Franz ebenfalls
16 Bilder vorhanden.
Ein Rudolf Alt gleichwertiger Schilderer war Berliu
niclit beschieden. Der künstlerisch bedeutendste Ve-
dutenmaler des vor- und nachmärzlichen Berlin ist ohne
Frage Eduard G a e r t n e r , der 1801 in Berlin geboren
wurde und 1877 in seiner Heimatstadt starb. Er wurde
von Friedrich Wilhelm 111. durch Aufträge gefördert und
ging mit Unterstützung des Königs 1825 auf zwei Jahre
nach Paris. Auf seine Empfehlung bekam er dann auch
Beziehungen zum russischen Hofe; von 1837 bis 1839
hielt er sich in Petersburg auf. Die Schloßbibliothek be-
sitzt 18 Blatt von ihm. Im Künstler-Lexikon von Thie-
me-Becker wird weder bei Gaertner noch bei den an-
deren bereits genannten oder noch zu nennenden Malern
an den Stellen wo von dem Verbleib ihrer Werke ge-
sprochen wird, die frühere königliche Hausbibliothek
genannt. Das beweist, wie wenig die Sammlung be-
kannt ist. Neben Gaertner sind als Darsteller Berlins
unter Friedrich Wilhelm III. noch Johann Heinrich
H i n t z e , 1800 in Berlin geboren, und F. W. K 1 o s s
zu nennen, die mit 74 bezüglich 85 Bildern in der
Sammlung Friedrich Wilhelms IV. vertreten sind,
ferner J. R a a b e , der als Oberhofbauinspektor zu dem
Königshause in besonderem Verhältnis stand. Die Dar-
stellungen des biedermeierlichen Berlin von der Hand
dieser Künstler mit der charakteristischen Staffage, die
sie ihren Bildern gaben, sind ausdrucksvolle, beredte
Zeugnisse einer Zeitepoche, die an Gemütstiefe und Kul-
turhöhe die unsrige weit überragt. Das Volksleben
dieser Zeit illustriert T h e o d o r H o s e m a n n, von
dem die Schloßbibliothek 26 Blatt besitzt. Sie werden
zur Zeit in der FIosemann-Ausstellung des Märkischen
Museums zur Ansicht gebracht.
Merkwürdigerweise ist F r a n z K r ü g e r in der
Sammlung Friedrich Wilhelms IV. nur mit einem Aqua-
rell und einer Sepiazeichnung vertreten. Bemerkens-
wert sind zwei Blätter von M e n z e 1 aus seiner frühe-
sten Zeit, „Der König in Thule“ und ein prächtiger
„Kurfürstlich sächsischer Läufer“.
C.rößere Teile der Aquarellsammlung der Schloß-
bibliothek (929 Nummern) sind zum ersten Mal im Jahre
1869 zum Besten der Königin Elisabeth-Vereinsstiftung
im Königlichen Schloß ausgestellt gewesen, danach erst
wieder 1915 zum Besten des Roten Kreuzes im Lichthof
des Kunstgewerbemuseums und 1922 in der Orangerie
in Potsdam aus Anlaß des „Potsdamer Kunstsommers“.
Flier allerdings nur Potsdamer Ansichten. Einige Blät-
ter waren kürzlich in der Jahrhundert-Ausstellung des
Berliner Architekten-Vereins und aus Anlaß der Tagung
für Denkmalpflege im Potsdamer Civil-Casino zu sehen.
L. Meidner, Tanja
Kunstverlag F. Möljer, Potsdam
8