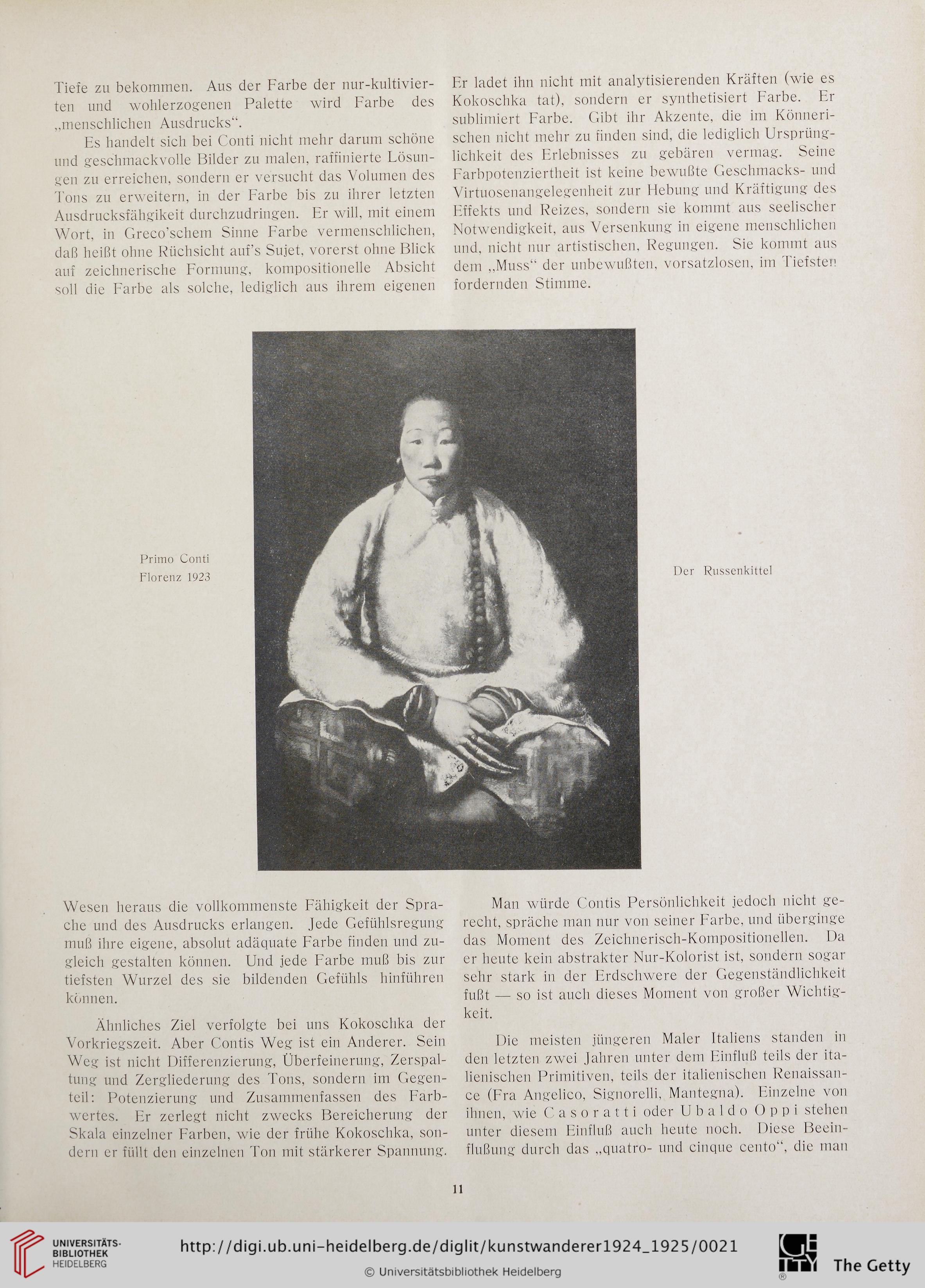Donath, Adolph [Editor]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 6./7.1924/25
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.25879#0021
DOI issue:
1./2. Septemberheft
DOI article:Landau, Rom: Neue italienische Malerei: Primo Conti
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.25879#0021
Tiefe zu bekommen. Aus der Farbe der nur-kultivier-
ten und wohlerzogenen Palette wird Farbe des
„menschlichen Ausdrucks“.
Es handelt sich bei Conti nicht mehr darum schöne
und geschmackvolle Bilder zu malen, raffinierte Lösun-
gen zu erreichen, sondern er versucht das Volumen des
l'ons zu erweitern, in der Farbe bis zu ihrer letzten
Ausdrucksfähgikeit durchzudringen. Er will, mit einem
Wort, in Greco’schem Sinne Farbe vermenschlichen,
daß heißt ohne Rüchsicht auf’s Sujet, vorerst ohne Blick
auf zeichnerische Formung, kompositionelle Absicht
soll die Farbe als solche, lediglich aus ihrem eigenen
Er ladet ihn nicht mit analytisierenden Kräften (wie es
Kokoschka tat), sondern er synthetisiert Farbe. Er
sublimiert Farbe. Gibt ihr Akzente, die im Könneri-
schen nicht mehr zu finden sind, die lediglich Ursprüng-
lichkeit des Erlebnisses zu gebäreu vermag. Seine
Farbpotenziertheit ist keine bewußte Geschmacks- und
Virtuosenangelegenheit zur Hebung und Kräftigung des
Effekts und Reizes, sondern sie komint aus seelischer
Notwendigkeit, aus Verseukung in eigene menschlichen
und, nicht nur artistischeu, Regungen. Sie kommt aus
dem „Muss“ der unbewußten, vorsatzlosen, im Tiefsteri
fordernden Stimrne.
Primo Conti
Florenz 1923
Der Rnssenkittel
Wesen heraus die vollkommenste Fähigkeit der Spra-
che und des Ausdrucks erlangen. Jede Gefüiilsregung
muß ihre eigene, absolut adäquate Farbe finden und zu-
gleich gestalten können. Und jede Farbe muß bis zur
tiefsten Wurzel des sie bildenden Gefühls hinführen
konnen.
Ähnliches Ziel verfolgte bei uns Kokoschka der
Vorkriegszeit. Aber Contis Weg ist ein Anderer. Sein
Weg ist nicht Differenzierung, Überfeinerung, Zerspal-
tung und Zergliederung des Tons, sondern im Gegen-
teil: Potenzierung und Zusammenfassen des Farb-
wertes. Er zerlegt nicht zwecks Bereicherung der
Skala einzelner Farben, wie der frühe Kokoschka, son-
dern er fiillt den einzelnen Ton mit stärkerer Spannung.
Man würde Contis Persönlichkeit jedoch nicht ge-
recjht, spräche man nur von seiner Farbe. und überginge
das Moment des Zeichnerisch-Kompositionellen. Da
er heute kein abstrakter Nur-Kolorist ist, sondern sogar
sehr stark in der Erdschwere der Gegenständlichkeit
fußt — so ist aucli dieses Moment von großer Wichtig-
keit.
Die meisten jüngeren Maler Italiens standen in
den letzten zwei Jahren unter dem Einfluß teils der ita-
lienischen Primitiven, teils der italienischen Renaissan-
ce (Fra Angelico, Signorelli, Mantegna). Einzelne von
ihnen, wie C a s o r a 11 i oder U b a 1 d o 0 p p i stehen
unter diesem Einfluß auch heute noch. Diese Beein-
flußung durch das „quatro- und cinque cento“, die man
ll
ten und wohlerzogenen Palette wird Farbe des
„menschlichen Ausdrucks“.
Es handelt sich bei Conti nicht mehr darum schöne
und geschmackvolle Bilder zu malen, raffinierte Lösun-
gen zu erreichen, sondern er versucht das Volumen des
l'ons zu erweitern, in der Farbe bis zu ihrer letzten
Ausdrucksfähgikeit durchzudringen. Er will, mit einem
Wort, in Greco’schem Sinne Farbe vermenschlichen,
daß heißt ohne Rüchsicht auf’s Sujet, vorerst ohne Blick
auf zeichnerische Formung, kompositionelle Absicht
soll die Farbe als solche, lediglich aus ihrem eigenen
Er ladet ihn nicht mit analytisierenden Kräften (wie es
Kokoschka tat), sondern er synthetisiert Farbe. Er
sublimiert Farbe. Gibt ihr Akzente, die im Könneri-
schen nicht mehr zu finden sind, die lediglich Ursprüng-
lichkeit des Erlebnisses zu gebäreu vermag. Seine
Farbpotenziertheit ist keine bewußte Geschmacks- und
Virtuosenangelegenheit zur Hebung und Kräftigung des
Effekts und Reizes, sondern sie komint aus seelischer
Notwendigkeit, aus Verseukung in eigene menschlichen
und, nicht nur artistischeu, Regungen. Sie kommt aus
dem „Muss“ der unbewußten, vorsatzlosen, im Tiefsteri
fordernden Stimrne.
Primo Conti
Florenz 1923
Der Rnssenkittel
Wesen heraus die vollkommenste Fähigkeit der Spra-
che und des Ausdrucks erlangen. Jede Gefüiilsregung
muß ihre eigene, absolut adäquate Farbe finden und zu-
gleich gestalten können. Und jede Farbe muß bis zur
tiefsten Wurzel des sie bildenden Gefühls hinführen
konnen.
Ähnliches Ziel verfolgte bei uns Kokoschka der
Vorkriegszeit. Aber Contis Weg ist ein Anderer. Sein
Weg ist nicht Differenzierung, Überfeinerung, Zerspal-
tung und Zergliederung des Tons, sondern im Gegen-
teil: Potenzierung und Zusammenfassen des Farb-
wertes. Er zerlegt nicht zwecks Bereicherung der
Skala einzelner Farben, wie der frühe Kokoschka, son-
dern er fiillt den einzelnen Ton mit stärkerer Spannung.
Man würde Contis Persönlichkeit jedoch nicht ge-
recjht, spräche man nur von seiner Farbe. und überginge
das Moment des Zeichnerisch-Kompositionellen. Da
er heute kein abstrakter Nur-Kolorist ist, sondern sogar
sehr stark in der Erdschwere der Gegenständlichkeit
fußt — so ist aucli dieses Moment von großer Wichtig-
keit.
Die meisten jüngeren Maler Italiens standen in
den letzten zwei Jahren unter dem Einfluß teils der ita-
lienischen Primitiven, teils der italienischen Renaissan-
ce (Fra Angelico, Signorelli, Mantegna). Einzelne von
ihnen, wie C a s o r a 11 i oder U b a 1 d o 0 p p i stehen
unter diesem Einfluß auch heute noch. Diese Beein-
flußung durch das „quatro- und cinque cento“, die man
ll