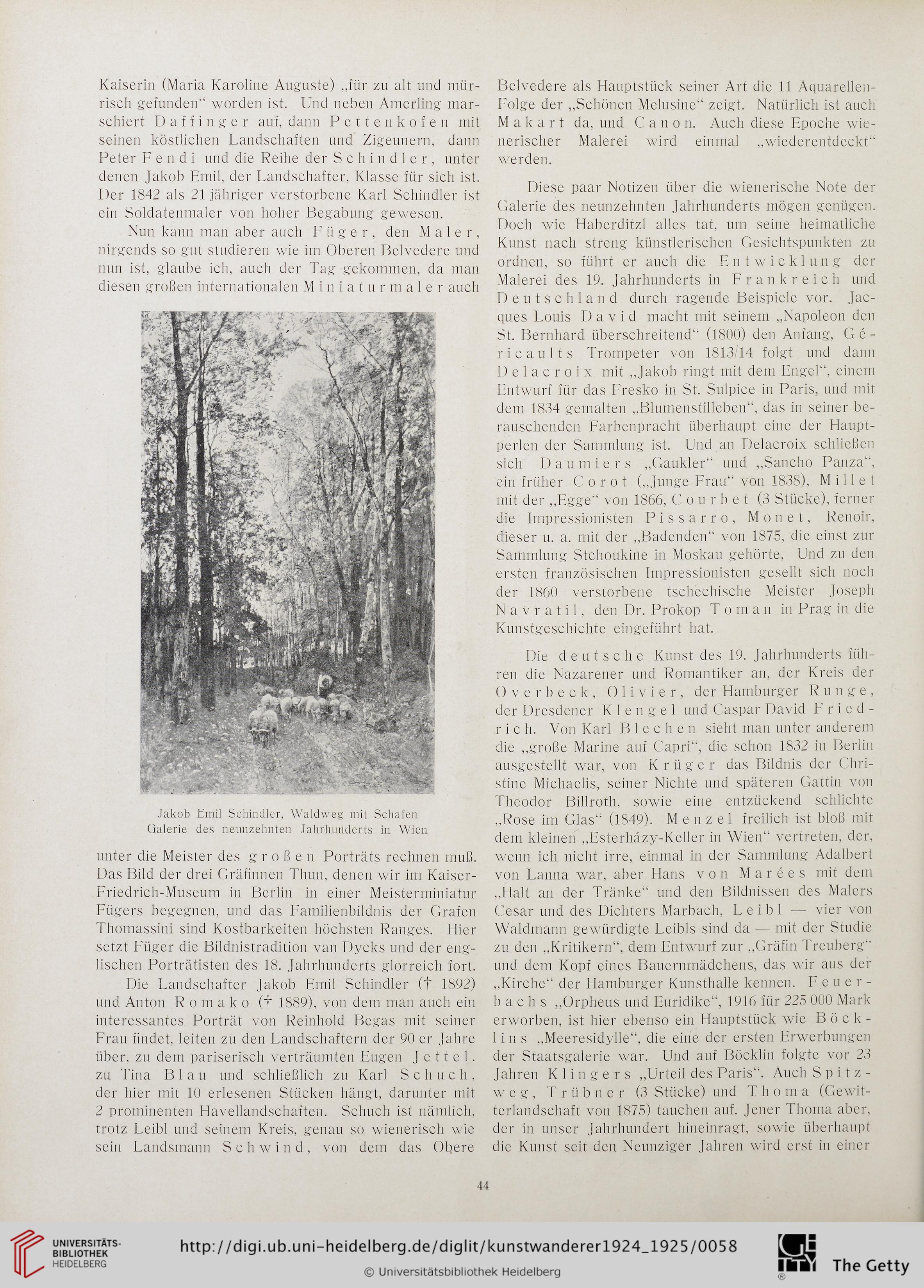Kaiserin (Maria Karoline Auguste) „für zu alt und mür-
risch gefunden“ worden ist. Und nehen Amerling mar-
schiert D a f f i n g e r auf, dann Pettenkofen mit
seinen köstlichen Landschaften und Zigeunern, dann
Peter F e n d i und die Reihe der S c h i n d 1 e r , unter
denen Jakob Emil, der Landschafter, Klasse für sich ist.
Der 1842 als 21 jähriger verstorbene Karl Schindler ist
ein Soldatenmaler von hoher Begabung gewesen.
Nun kann man aber auch F ü g e r , den M a 1 e r,
nirgends so gut studieren wie im Oberen Belvedere und
nun ist, glaube ich, auch der Tag gekommen, da man
diesen großen internationalen M i n i a t u r m a 1 e r auch
.lakob Emil Schindler, Waldweg mit Schafen
Galerie des neunzehnten Jahrhunderts in Wien
unter die Meister des g r o ß e n Porträts rechnen muß.
Das Bild der drei Gräfinnen Thun, denen wir im Kaiser-
Friedrich-Museum in Berlin in einer Meisterminiatur
Fügers begegnen, und das Familienbildnis der Grafeit
riiomassini sind Kostbarkeiten höchsten Ranges. Hier
setzt Füger die Bildnistradition van Dycks und der eng-
lischen Porträtisten des 18. Jahrhunderts glorreich fort.
Die Landschafter Jakob Emil Schindler (t 1892)
und Anton R o m a k o (f 1889), von dem man auch ein
interessantes Porträt von Reinhold Begas mit seiner
Frau findet, leiten zu den Landschaftern der 90 er Jahre
über, zu dem pariserisch verträumten Eugen J e 11 e 1.
zu Tina Blau und schließlich zu Karl Schuch,
der hier mit 10 erlesenen Stücken hängt, darunter mit
2 prominenten Havellandschaften. Schuch ist nämlich,
trotz Leibl und seinem Kreis, genau so wienerisch wie
sein Landsmann S c h w i n d , von dem das Obere
Belvedere als Hauptstück seiner Art die 11 Aquarellen-
Folge der „Schönen Melusine“ zeigt. Natürlich ist auch
M a k a r t da, und Cano n. Auch diese Epoche wie-
nerischer Malerei wird einmal „wiederentdeckt“
werden.
Diese paar Notizen über die wienerische Note der
Galerie des neunzehnten Jahrhunderts mögen genügen.
Doch wie Haberditzl alles tat, um seine heimatliche
Kunst nach streng künstlerischen Gesichtspunkten zu
ordnen, so führt er aucli die Entwicklung der
Malerei des 19. Jahrhunderts in Frankreich und
Deutschland durch ragende Beispiele vor. Jac-
ques Louis D a v i d macht mit seinem „Napoleon den
St. Bernhard überschreitend“ (1800) den Anfang, G e -
r i c a u 11 s Trompeter von 1813/14 folgt und dann
D e 1 a c r o i x mit „Jakob ringt mit dem Engel“, einem
Entwurf für das Fresko in St. Sulpice in Paris, und mit
dem 1834 gemalten „Blumenstilleben“, das in seiner be-
rauschenden Farbenpracht überhaupt eine der Haupt-
perlen der Sammlung ist. Und an Delacroix schließen
sich Daumiers „Gaukler“ und „Sancho Panza“,
ein früher C o r o t („Junge Frau“ von 1838), M i 11 e t
mit der „Egge“ von 1866, C o u r b e t (3 Stücke), ferner
die Impressionisten Pissarro, Monet, Renoir,
dieser u. a. mit der „Badenden“ von 1875, die einst zur
Sammlung Stchoukine in Moskau gehörte, Und zu den
ersten französischen Impressionisten gesellt sich noch
der 1860 verstorbene tschechische Meister Joseplr
N a v r a t i 1, den Dr. Prokop T o m a n in Prag in die
Kunstgeschichte eingeführt hat.
Die deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts füh-
ren die Nazarener und Romantiker an, der Kreis der
Overbeck, O 1 i v i e r , der Hamburger R u n g e ,
der Dresdener K 1 e n g e 1 und Caspar David F r i e d -
r i c h. Von Karl B 1 e c h e n sieht man unter anderem
die „große Marine auf Capri“, die schon 1832 in Berlin
ausgestellt war, von K r ü g e r das Bildnis der Chri-
stine Michaelis, seiner Nichte und späteren Gattin von
Theodor Billroth, sowie eine entzückend schlichte
„Rose im Glas“ (1849). Menzel freilich ist bloß mit
dem kleinen „Esterhäzy-Keller in Wien“ vertreten, der,
wenn ich nicht irre, einmal in der Sammlung Adalbert
von Lanna war, aber Hans von Marees mit dem
„Halt an der Tränke“ und den Bildnissen des Malers
Cesar und des Dichters Marbach, L e i b 1 — vier von
Waldmann gewürdigte Leibls sind da — mit der Studie
zu den „Kritikern“, dem Entwurf zur „Gräfin Treuberg“
und dem Kopf eines Bauernmädchens, das wir aus der
„Kirche“ der Hamburger Kunsthalle kennen. F e u e r -
b a c h s „Orpheus und Euridike“, 1916 für 225 000 Mark
erworben, ist hier ebenso ein Hauptsttick wie B ö c k -
1 i n s „Meeresidylle“, die eirie der ersten Erwerbungen
der Staatsgalerie war. Und auf Böcklin folgte vor 23
Jahren K 1 i n g e r s „Urteil des Paris“. Auch S p i t z -
w e g , T r ü b n e r (3 Stücke) und T h o m a (Gewit-
terlandschaft von 1875) tauchen auf. Jener Thoma aber,
der in unser Jahrhundert hineinragt, sowie überhaupt
die Kunst seit den Neunziger Jahren wird erst in einer
44
risch gefunden“ worden ist. Und nehen Amerling mar-
schiert D a f f i n g e r auf, dann Pettenkofen mit
seinen köstlichen Landschaften und Zigeunern, dann
Peter F e n d i und die Reihe der S c h i n d 1 e r , unter
denen Jakob Emil, der Landschafter, Klasse für sich ist.
Der 1842 als 21 jähriger verstorbene Karl Schindler ist
ein Soldatenmaler von hoher Begabung gewesen.
Nun kann man aber auch F ü g e r , den M a 1 e r,
nirgends so gut studieren wie im Oberen Belvedere und
nun ist, glaube ich, auch der Tag gekommen, da man
diesen großen internationalen M i n i a t u r m a 1 e r auch
.lakob Emil Schindler, Waldweg mit Schafen
Galerie des neunzehnten Jahrhunderts in Wien
unter die Meister des g r o ß e n Porträts rechnen muß.
Das Bild der drei Gräfinnen Thun, denen wir im Kaiser-
Friedrich-Museum in Berlin in einer Meisterminiatur
Fügers begegnen, und das Familienbildnis der Grafeit
riiomassini sind Kostbarkeiten höchsten Ranges. Hier
setzt Füger die Bildnistradition van Dycks und der eng-
lischen Porträtisten des 18. Jahrhunderts glorreich fort.
Die Landschafter Jakob Emil Schindler (t 1892)
und Anton R o m a k o (f 1889), von dem man auch ein
interessantes Porträt von Reinhold Begas mit seiner
Frau findet, leiten zu den Landschaftern der 90 er Jahre
über, zu dem pariserisch verträumten Eugen J e 11 e 1.
zu Tina Blau und schließlich zu Karl Schuch,
der hier mit 10 erlesenen Stücken hängt, darunter mit
2 prominenten Havellandschaften. Schuch ist nämlich,
trotz Leibl und seinem Kreis, genau so wienerisch wie
sein Landsmann S c h w i n d , von dem das Obere
Belvedere als Hauptstück seiner Art die 11 Aquarellen-
Folge der „Schönen Melusine“ zeigt. Natürlich ist auch
M a k a r t da, und Cano n. Auch diese Epoche wie-
nerischer Malerei wird einmal „wiederentdeckt“
werden.
Diese paar Notizen über die wienerische Note der
Galerie des neunzehnten Jahrhunderts mögen genügen.
Doch wie Haberditzl alles tat, um seine heimatliche
Kunst nach streng künstlerischen Gesichtspunkten zu
ordnen, so führt er aucli die Entwicklung der
Malerei des 19. Jahrhunderts in Frankreich und
Deutschland durch ragende Beispiele vor. Jac-
ques Louis D a v i d macht mit seinem „Napoleon den
St. Bernhard überschreitend“ (1800) den Anfang, G e -
r i c a u 11 s Trompeter von 1813/14 folgt und dann
D e 1 a c r o i x mit „Jakob ringt mit dem Engel“, einem
Entwurf für das Fresko in St. Sulpice in Paris, und mit
dem 1834 gemalten „Blumenstilleben“, das in seiner be-
rauschenden Farbenpracht überhaupt eine der Haupt-
perlen der Sammlung ist. Und an Delacroix schließen
sich Daumiers „Gaukler“ und „Sancho Panza“,
ein früher C o r o t („Junge Frau“ von 1838), M i 11 e t
mit der „Egge“ von 1866, C o u r b e t (3 Stücke), ferner
die Impressionisten Pissarro, Monet, Renoir,
dieser u. a. mit der „Badenden“ von 1875, die einst zur
Sammlung Stchoukine in Moskau gehörte, Und zu den
ersten französischen Impressionisten gesellt sich noch
der 1860 verstorbene tschechische Meister Joseplr
N a v r a t i 1, den Dr. Prokop T o m a n in Prag in die
Kunstgeschichte eingeführt hat.
Die deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts füh-
ren die Nazarener und Romantiker an, der Kreis der
Overbeck, O 1 i v i e r , der Hamburger R u n g e ,
der Dresdener K 1 e n g e 1 und Caspar David F r i e d -
r i c h. Von Karl B 1 e c h e n sieht man unter anderem
die „große Marine auf Capri“, die schon 1832 in Berlin
ausgestellt war, von K r ü g e r das Bildnis der Chri-
stine Michaelis, seiner Nichte und späteren Gattin von
Theodor Billroth, sowie eine entzückend schlichte
„Rose im Glas“ (1849). Menzel freilich ist bloß mit
dem kleinen „Esterhäzy-Keller in Wien“ vertreten, der,
wenn ich nicht irre, einmal in der Sammlung Adalbert
von Lanna war, aber Hans von Marees mit dem
„Halt an der Tränke“ und den Bildnissen des Malers
Cesar und des Dichters Marbach, L e i b 1 — vier von
Waldmann gewürdigte Leibls sind da — mit der Studie
zu den „Kritikern“, dem Entwurf zur „Gräfin Treuberg“
und dem Kopf eines Bauernmädchens, das wir aus der
„Kirche“ der Hamburger Kunsthalle kennen. F e u e r -
b a c h s „Orpheus und Euridike“, 1916 für 225 000 Mark
erworben, ist hier ebenso ein Hauptsttick wie B ö c k -
1 i n s „Meeresidylle“, die eirie der ersten Erwerbungen
der Staatsgalerie war. Und auf Böcklin folgte vor 23
Jahren K 1 i n g e r s „Urteil des Paris“. Auch S p i t z -
w e g , T r ü b n e r (3 Stücke) und T h o m a (Gewit-
terlandschaft von 1875) tauchen auf. Jener Thoma aber,
der in unser Jahrhundert hineinragt, sowie überhaupt
die Kunst seit den Neunziger Jahren wird erst in einer
44