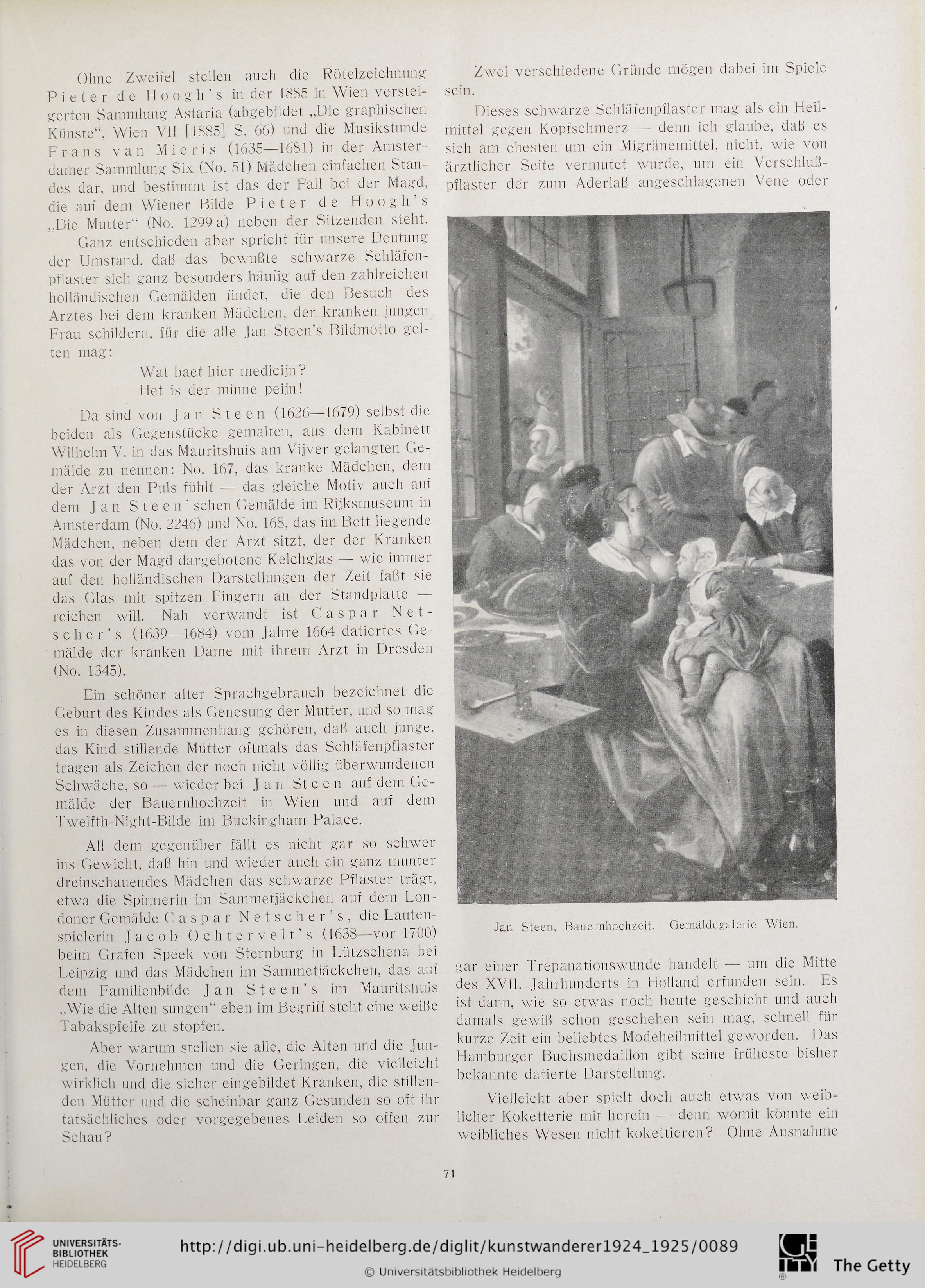Ohne Zweifel stellen auch die Rötelzeichnung
P i e t e r d e Hoogh’s in der 1885 in Wien verstei-
gerten Sammlung Astaria (abgebildet „Die graphischen
Künste“, Wien VII [1885] S. 66) und die Musikstun.de
Frans van Mieris (1635—1681) in der Amster-
damer Sammlung Six (No. 51) Mädchen einfachen Stan-
des dar, und bestimmt ist das der Fall bei der Magd,
die auf dem Wiener Bilde P i e t e r d e H o o g h ' s
,,Die Mutter“ (No. 1299 a) neben der Sitzenden steht.
Ganz entschieden aber spricht für unsere Deutung
der Umstand, daß das bewußte schwarze Schläfen-
pflaster sich ganz besonders häufig auf den zahlreicheu
holländischen Gemälden findet, die den Besuch des
Arztes bei dem kranken Mädchen, der kranken jungen
Frau schildern, für die alle Jan Steen’s Bildmotto gel-
ten mag:
Wat baet hier medicijn?
Het is der minne peijn!
Da sind von J a n S t e e n (1626—1679) selbst die
beiden als Gegenstücke gemalten, aus dem Kabinett
Wilhelm V. in das Mauritshuis am Vijver gelangten Ge-
mälde zu nennen: No. 167, das kranke Mädchen, dem
der Arzt den Puls fühlt — das gleiche Motiv aucli auf
dem J a n S t e e n ’ schen Gemälde im Rijksmuseum in
Amsterdam (No. 2246) und No. 168, das im Bett liegende
Mädchen, neben dem der Arzt sitzt, der der Kranken
das von der Magd dargebotene Kelchglas — wie immer
auf den holländischen Darstellungen der Zeit faßt sie
das Glas mit spitzen Fingern an der Standplatte —
reichen will. Nah verwandt ist C a s p a r N e t -
scher’s (1639—1684) vom Jahre 1664 datiertes Ge-
mälde der kranken Dame mit ihrem Arzt in Dresden
(No. 1345).
Ein schöner alter Sprachgebrauch bezeiclmet die
Geburt des Kindes als Genesung der Mutter, und so mag
es in diesen Zusammenhang gehören, daß auch junge,
das Kind stillende Miitter oftmals das Schläfenpflaster
tragen als Zeichen der noch nicht völlig überwundenen
Schwäche, so — wieder bei J a n St e e n auf dem Ge-
mälde der Bauernhochzeit in Wien und auf dem
Twelfth-Night-Bilde im Buckingham Palace.
All dem gegenüber fällt es nicht gar so schwer
ins Gewicht, daß hin und wieder auch eiu ganz munter
dreinschauendes Mädchen das schwarze Pflaster trägt,
etwa die Spinnerin im Sammetjäckchen auf dem Lon-
doner Gemälde C a s p a r N e t s c h e r ’ s , die Lauten-
spielerin Jacob Ochtervelt’s (1638—vor 1700)
beim Grafen Speek von Sternburg in Liitzschena hei
Leipzig und das Mädchen im Sammetjäckchen, das auf
dem Familienbilde Jan Steen’s im Mauritshuis
„Wie die Alten sungen“ eben im Begriff steht eine weiße
Tabakspfeife zu stopfen.
Aber warum stellen sie alle, die Alten und die Jun-
gen, die Vornehmen und die Geringen, die vielleicht
wirklich und die sicher eingebildet Kranken, die stillen-
den Mütter und die scheinbar ganz Gesunden so oft ihr
tatsäcliliches oder vorgegebenes Leiden so offen zur
Schau?
Zwei verschiedene Gründe mögen dabei im Spiele
sein.
Dieses schwarze Schläfenpflaster mag als ein Heil-
mittel gegen Kopfschmerz — denn ich glaube, daß es
sich am ehesten um ein Migränemittel, nicht, wie von
ärztlicher Seite vennutet wurde, um cin Verschluß-
pflaster der zum Aderlaß angeschlagenen Vene oder
Jan Steen, Bauernhochzeit. Gemäldegalerie Wien.
gar einer Trepanationswunde handelt — um die Mitte
des XVII. Jahrhunderts in Holland erfunden sein. Es
ist dann, wie so etwas noch heute geschieht und auch
damals gewiß schon geschehen sein mag, schnell fiir
kurze Zeit ein beliebtes Modeheilmittel geworden. Das
Hamburger Buchsmedaillon gibt seine früheste bisher
bekannte datierte Darstellung.
Vielleicht aber spielt docli aucli etwas von weib-
licher Koketterie mit herein — denn womit könnte ein
weibliches Wesen nicht kokettieren? Ohne Ausnahme
71
P i e t e r d e Hoogh’s in der 1885 in Wien verstei-
gerten Sammlung Astaria (abgebildet „Die graphischen
Künste“, Wien VII [1885] S. 66) und die Musikstun.de
Frans van Mieris (1635—1681) in der Amster-
damer Sammlung Six (No. 51) Mädchen einfachen Stan-
des dar, und bestimmt ist das der Fall bei der Magd,
die auf dem Wiener Bilde P i e t e r d e H o o g h ' s
,,Die Mutter“ (No. 1299 a) neben der Sitzenden steht.
Ganz entschieden aber spricht für unsere Deutung
der Umstand, daß das bewußte schwarze Schläfen-
pflaster sich ganz besonders häufig auf den zahlreicheu
holländischen Gemälden findet, die den Besuch des
Arztes bei dem kranken Mädchen, der kranken jungen
Frau schildern, für die alle Jan Steen’s Bildmotto gel-
ten mag:
Wat baet hier medicijn?
Het is der minne peijn!
Da sind von J a n S t e e n (1626—1679) selbst die
beiden als Gegenstücke gemalten, aus dem Kabinett
Wilhelm V. in das Mauritshuis am Vijver gelangten Ge-
mälde zu nennen: No. 167, das kranke Mädchen, dem
der Arzt den Puls fühlt — das gleiche Motiv aucli auf
dem J a n S t e e n ’ schen Gemälde im Rijksmuseum in
Amsterdam (No. 2246) und No. 168, das im Bett liegende
Mädchen, neben dem der Arzt sitzt, der der Kranken
das von der Magd dargebotene Kelchglas — wie immer
auf den holländischen Darstellungen der Zeit faßt sie
das Glas mit spitzen Fingern an der Standplatte —
reichen will. Nah verwandt ist C a s p a r N e t -
scher’s (1639—1684) vom Jahre 1664 datiertes Ge-
mälde der kranken Dame mit ihrem Arzt in Dresden
(No. 1345).
Ein schöner alter Sprachgebrauch bezeiclmet die
Geburt des Kindes als Genesung der Mutter, und so mag
es in diesen Zusammenhang gehören, daß auch junge,
das Kind stillende Miitter oftmals das Schläfenpflaster
tragen als Zeichen der noch nicht völlig überwundenen
Schwäche, so — wieder bei J a n St e e n auf dem Ge-
mälde der Bauernhochzeit in Wien und auf dem
Twelfth-Night-Bilde im Buckingham Palace.
All dem gegenüber fällt es nicht gar so schwer
ins Gewicht, daß hin und wieder auch eiu ganz munter
dreinschauendes Mädchen das schwarze Pflaster trägt,
etwa die Spinnerin im Sammetjäckchen auf dem Lon-
doner Gemälde C a s p a r N e t s c h e r ’ s , die Lauten-
spielerin Jacob Ochtervelt’s (1638—vor 1700)
beim Grafen Speek von Sternburg in Liitzschena hei
Leipzig und das Mädchen im Sammetjäckchen, das auf
dem Familienbilde Jan Steen’s im Mauritshuis
„Wie die Alten sungen“ eben im Begriff steht eine weiße
Tabakspfeife zu stopfen.
Aber warum stellen sie alle, die Alten und die Jun-
gen, die Vornehmen und die Geringen, die vielleicht
wirklich und die sicher eingebildet Kranken, die stillen-
den Mütter und die scheinbar ganz Gesunden so oft ihr
tatsäcliliches oder vorgegebenes Leiden so offen zur
Schau?
Zwei verschiedene Gründe mögen dabei im Spiele
sein.
Dieses schwarze Schläfenpflaster mag als ein Heil-
mittel gegen Kopfschmerz — denn ich glaube, daß es
sich am ehesten um ein Migränemittel, nicht, wie von
ärztlicher Seite vennutet wurde, um cin Verschluß-
pflaster der zum Aderlaß angeschlagenen Vene oder
Jan Steen, Bauernhochzeit. Gemäldegalerie Wien.
gar einer Trepanationswunde handelt — um die Mitte
des XVII. Jahrhunderts in Holland erfunden sein. Es
ist dann, wie so etwas noch heute geschieht und auch
damals gewiß schon geschehen sein mag, schnell fiir
kurze Zeit ein beliebtes Modeheilmittel geworden. Das
Hamburger Buchsmedaillon gibt seine früheste bisher
bekannte datierte Darstellung.
Vielleicht aber spielt docli aucli etwas von weib-
licher Koketterie mit herein — denn womit könnte ein
weibliches Wesen nicht kokettieren? Ohne Ausnahme
71