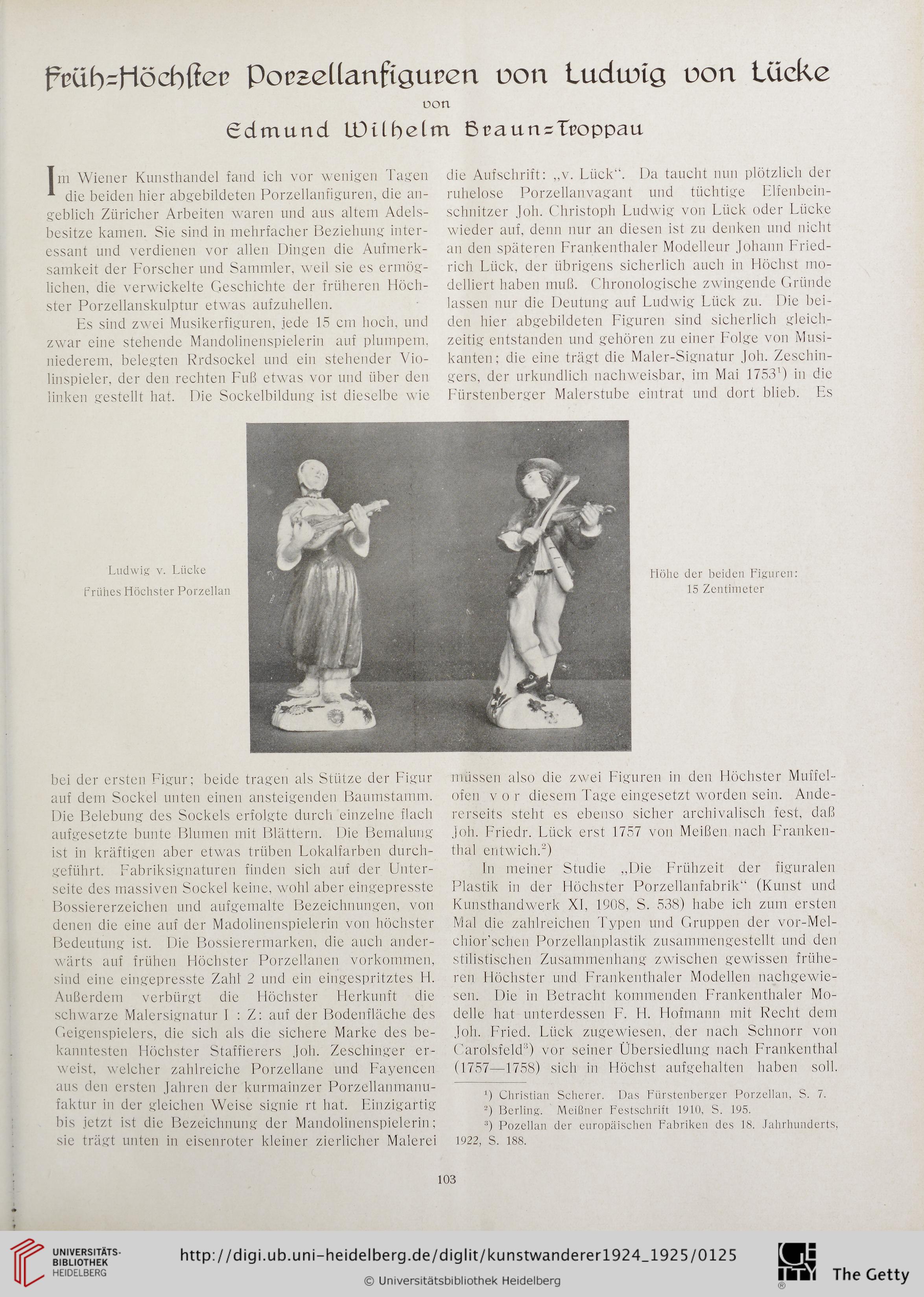pt?üb=Jiöcb(fee Pot’EeUanftgui’cn oon Ludiüig oon tüeke
oon
gdtnund IDÜbeltn BnaunrTnoppau
|m Wiener Kunsthandel fand ich vor wenigen Tagen
* die beiden liier abgebildeten Porzellanfiguren, die an-
geblich Züricher Arbeiten waren und aus altem Adels-
besitze kameu. Sie sind in mehrfacher Beziehung inter-
essant und verdienen vor allen Dingen die Aufmerk-
samkeit der Forscher und Sammler, weil sie es ermög-
lichen, die verwickelte Geschichte der früheren Höch-
ster Porzellanskulptur etwas aufzuhellen.
Es sind zwei Musikerfiguren, jede 15 cm hoch, und
zwar eine stehende Mandolinenspielerin auf plumpem,
niederem, belegten Rrdsockel und ein stehender Vio-
linspieler, der den rechten Fuß etwas vor und über den
linken gestellt hat. Die Sockelbildung ist dieselbe wie
die Aufschrift: „v. Lück“. Da taucht nun plötzlich der
ruhelose Porzellanvagant und tüchtige Elfenbein-
schnitzer Joh. Christoph Ludwig von Lück oder Lücke
wieder auf, denn nur an diesen ist zu denken und nicht
an den späteren Frankenthaler Modelleur Johann Fried-
rich Lück, der übrigens sicherlich auch in Höchst mo-
delliert haben muß. Chronologische zwingende Gründe
lassen nur die Deutung auf Ludwig Lück zu. Die bei-
den hier abgebildeten Figuren sind sicherlich gleich-
zeitig entstanden und gehören zu einer Folge von Musi-
kanten; die eine trägt die Maler-Signatur Joh. Zeschin-
gers, der urkundlich nachweisbar, im Mai 17531) in die
Fürstenberger Malerstube eintrat und dort blieb. Es
bei der ersten Figur; beide trageu als Stütze der Figur
auf dem Sockel unten einen ansteigenden Baumstamm.
Die Belebung des Sockels erfolgte durch einzelne flach
aufgesetzte bunte Blumen mit Blättern. Die Bemalung
ist in kräftigen aber etwas trüben Lokalfarben durch-
geführt. Fabriksignaturen finden sich auf der Unter-
seite des massiven Sockel keine, wolil aber eingepresste
Bossiererzeichen und aufgemalte Bezeichuungen, von
denen die eine auf der Madolinenspielerin von höchster
Bedeutung ist. Die Bossierermarken, die auch ander-
wärts auf frühen Höchster Porzellanen vorkommen,
sind eine eingepresste Zahl 2 und ein eingespritztes H.
Außerdem verbürgt die Höchster Herkunft die
schwarze Malersignatur I : Z: auf der Bodenfläche des
Ceigenspielers, die sich als die sichere Marke des be-
kanntesten Höchster Staffierers Joh. Zeschinger er-
weist, welcher zahlreiche Porzellane und Fayencen
aus den ersten Jahren der kurmainzer Porzellanmanu-
faktur iu der gleichen Weise signie rt hat. Einzigartig
bis jetzt ist die Bezeichnung der Mandolinenspielerin;
sie trägt unten in eisenroter kleiner zierlicher Malerei
müssen also die zwei Figuren in den Höchster Muffel-
ofen v o r diesem Tage eingesetzt worden sein. Ande-
rerseits steht es ebenso sicher archivalisch fest, d.aß
Joh. Friedr. Liick erst 1757 von Meißen nach Franken-
thal entwich.2)
In meiner Studie „Die Frühzeit der figuralen
Plastik iu der Höchster Porzellanfabrik“ (Kunst und
Kunsthandwerk XI, 1908, S. 538) habe ich zum ersten
Mal die zahlreichen Typen und Cruppen der vor-Mel-
cliior’schen Porzellanplastik zusammengestellt und den
stilistischen Zusammenhang zwischen gewissen frühe-
ren Höchster und Frankenthaler Modellen nachgewie-
sen. Die in Betracht kommenden Frankenthaler Mo-
dellc hat unterdessen F. H. Hofmann mit Recht dem
Joh. Fried. Lück zugewiesen, der nach Schnorr von
Carolsfeld3) vor seiner Übersiedlung nach Frankenthal
(1757—1758) sich in Höchst aufgchalten haben soll.
L Christian Scherer. Das Ftirstenberger Porzellan, S. 7.
2) Berling. Meißner Festschrift 1910, S. 195.
:!) Pozellan der europäischen Fabrikcn dcs 18. Jahrhunderts,
1922, S. 188.
103
oon
gdtnund IDÜbeltn BnaunrTnoppau
|m Wiener Kunsthandel fand ich vor wenigen Tagen
* die beiden liier abgebildeten Porzellanfiguren, die an-
geblich Züricher Arbeiten waren und aus altem Adels-
besitze kameu. Sie sind in mehrfacher Beziehung inter-
essant und verdienen vor allen Dingen die Aufmerk-
samkeit der Forscher und Sammler, weil sie es ermög-
lichen, die verwickelte Geschichte der früheren Höch-
ster Porzellanskulptur etwas aufzuhellen.
Es sind zwei Musikerfiguren, jede 15 cm hoch, und
zwar eine stehende Mandolinenspielerin auf plumpem,
niederem, belegten Rrdsockel und ein stehender Vio-
linspieler, der den rechten Fuß etwas vor und über den
linken gestellt hat. Die Sockelbildung ist dieselbe wie
die Aufschrift: „v. Lück“. Da taucht nun plötzlich der
ruhelose Porzellanvagant und tüchtige Elfenbein-
schnitzer Joh. Christoph Ludwig von Lück oder Lücke
wieder auf, denn nur an diesen ist zu denken und nicht
an den späteren Frankenthaler Modelleur Johann Fried-
rich Lück, der übrigens sicherlich auch in Höchst mo-
delliert haben muß. Chronologische zwingende Gründe
lassen nur die Deutung auf Ludwig Lück zu. Die bei-
den hier abgebildeten Figuren sind sicherlich gleich-
zeitig entstanden und gehören zu einer Folge von Musi-
kanten; die eine trägt die Maler-Signatur Joh. Zeschin-
gers, der urkundlich nachweisbar, im Mai 17531) in die
Fürstenberger Malerstube eintrat und dort blieb. Es
bei der ersten Figur; beide trageu als Stütze der Figur
auf dem Sockel unten einen ansteigenden Baumstamm.
Die Belebung des Sockels erfolgte durch einzelne flach
aufgesetzte bunte Blumen mit Blättern. Die Bemalung
ist in kräftigen aber etwas trüben Lokalfarben durch-
geführt. Fabriksignaturen finden sich auf der Unter-
seite des massiven Sockel keine, wolil aber eingepresste
Bossiererzeichen und aufgemalte Bezeichuungen, von
denen die eine auf der Madolinenspielerin von höchster
Bedeutung ist. Die Bossierermarken, die auch ander-
wärts auf frühen Höchster Porzellanen vorkommen,
sind eine eingepresste Zahl 2 und ein eingespritztes H.
Außerdem verbürgt die Höchster Herkunft die
schwarze Malersignatur I : Z: auf der Bodenfläche des
Ceigenspielers, die sich als die sichere Marke des be-
kanntesten Höchster Staffierers Joh. Zeschinger er-
weist, welcher zahlreiche Porzellane und Fayencen
aus den ersten Jahren der kurmainzer Porzellanmanu-
faktur iu der gleichen Weise signie rt hat. Einzigartig
bis jetzt ist die Bezeichnung der Mandolinenspielerin;
sie trägt unten in eisenroter kleiner zierlicher Malerei
müssen also die zwei Figuren in den Höchster Muffel-
ofen v o r diesem Tage eingesetzt worden sein. Ande-
rerseits steht es ebenso sicher archivalisch fest, d.aß
Joh. Friedr. Liick erst 1757 von Meißen nach Franken-
thal entwich.2)
In meiner Studie „Die Frühzeit der figuralen
Plastik iu der Höchster Porzellanfabrik“ (Kunst und
Kunsthandwerk XI, 1908, S. 538) habe ich zum ersten
Mal die zahlreichen Typen und Cruppen der vor-Mel-
cliior’schen Porzellanplastik zusammengestellt und den
stilistischen Zusammenhang zwischen gewissen frühe-
ren Höchster und Frankenthaler Modellen nachgewie-
sen. Die in Betracht kommenden Frankenthaler Mo-
dellc hat unterdessen F. H. Hofmann mit Recht dem
Joh. Fried. Lück zugewiesen, der nach Schnorr von
Carolsfeld3) vor seiner Übersiedlung nach Frankenthal
(1757—1758) sich in Höchst aufgchalten haben soll.
L Christian Scherer. Das Ftirstenberger Porzellan, S. 7.
2) Berling. Meißner Festschrift 1910, S. 195.
:!) Pozellan der europäischen Fabrikcn dcs 18. Jahrhunderts,
1922, S. 188.
103