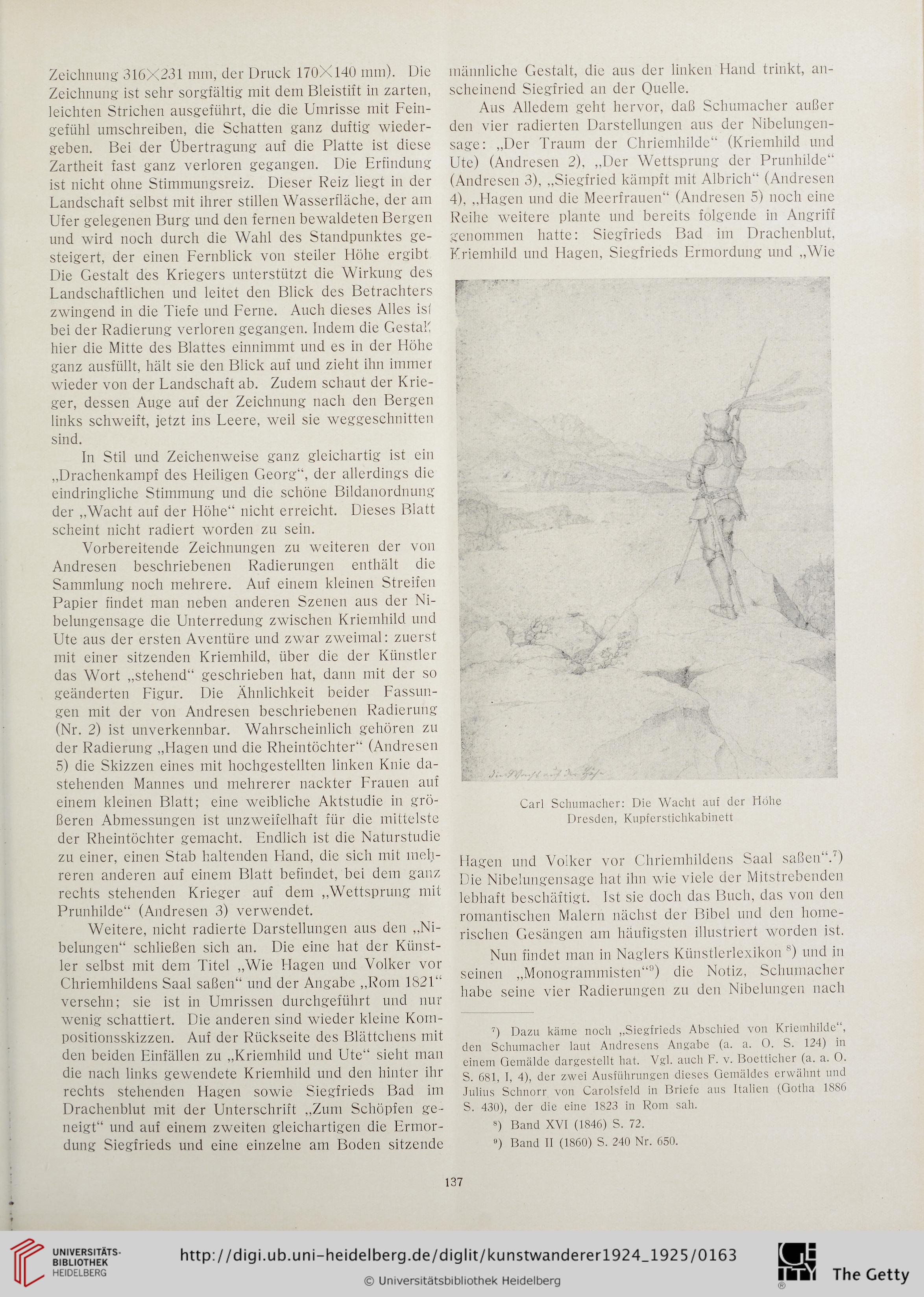Zeichnung 316X231 mm, der Druck 170X140 mm). Die
Zeichnung ist sehr sorgfältig mit dem Bleistift in zarten,
leichten Strichen ausgefiihrt, die die Umrisse mit Fein-
gefühl umschreiben, die Schatten ganz duftig wieder-
geben. Bei der Übertragung auf die Platte ist diese
Zartheit fast ganz verloren gegangen. Die Erfindung
ist nicht ohne Stimmungsreiz. Dieser Reiz liegt in der
Landschaft selbst mit ihrer stillen Wasserfläche, der am
Ufer gelegenen Burg und den fernen bewaldeten Bergen
und wird noch durch die Wahl des Standpunktes ge-
steigert, der einen Fernblick von steiler Höhe ergibt
Die Gestalt des Kriegers unterstützt die Wirkung des
Landschaftlichen und leitet den Blick des Betrachters
zwingend in die Tiefe und Ferne. Auch dieses Alles ist
bei der Radierung verloren gegangen. Indem die Gestah
hier die Mitte des Blattes einnimmt und es in der Höhe
ganz ausfüllt, hält sie den Blick auf und zieht ihn immer
wieder von der Landschaft ab. Zudem schaut der Krie-
ger, dessen Auge auf der Zeichnung nach den Bergen
links schweift, jetzt ins Leere, weil sie weggeschnitten
sind.
In Stil und Zeichenweise ganz gleichartig ist ein
„Drachenkampf des Heiligen Georg“, der allerdings die
eindringliche Stimmung und die schöne Bildanordnung
der „Wacht auf der Höhe“ nicht erreicht. Dieses Blatt
scheint nicht radiert worden zu sein.
Vorbereitende Zeichnungen zu weiteren der von
Andresen beschriebenen Radierungen enthält die
Sammlung noch mehrere. Auf einem kleinen Streifen
Papier findet man neben anderen Szenen aus der Ni-
belungensage die Unterredung zwischen Kriemhild und
Ute aus der ersten Aventüre und zwar zweimal: zuerst
mit einer sitzenden Kriemhild, über die der Künstler
das Wort „stehend“ geschrieben hat, dann mit der so
geänderten Figur. Die Ähnlichkeit beider Fassun-
gen mit der von Andresen beschriebenen Radierung
(Nr. 2) ist unverkennbar. Wahrscheinlich gehören zu
der Radierung „Hagen und die Rheintöchter“ (Andresen
5) die Skizzen eines mit hochgestellten linken Knie da-
stehenden Mannes und mehrerer nackter Frauen auf
einem kleinen Blatt; eine weibliche Aktstudie in grö-
ßeren Abmessungen ist unzweifelhaft für die mittelste
der Rheintöchter gemacht. Endlich ist die Naturstudie
zu einer, einen Stab haltenden Fland, die sich mit meh-
reren anderen auf einem Blatt befindet, bei dem ganz
rechts stehenden Krieger auf dem „Wettsprung mit
Prunhilde“ (Andresen 3) verwendet.
Weitere, nicht radierte Darstellungen aus den „Ni-
belungen“ schließen sich an. Die eine hat der Künst-
ler selbst mit dem Titel „Wie Hagen und Volker vor
Chriemhildens Saal saßen“ und der Angabe „Rom 1821“
versehn; sie ist in Umrissen durchgeführt und nur
wenig schattiert. Die anderen sind wieder kleine Korn-
positionsskizzen. Auf der Rückseite des Blättchens mit
den beiden Einfällen zu „Kriemhild und Ute“ sieht man
die nach links gewendete Kriemhild und den hinter ihr
rechts stehenden Hagen sowie Siegfrieds Bad im
Drachenblut mit der Unterschrift „Zum Schöpfen ge-
neigt“ und auf einem zweiten gleichartigen die Ermor-
dung Siegfrieds und eine einzelne am Boden sitzende
männliche Gestalt, die aus der linken Hand trinkt, an-
scheinend Siegfried an der Quelle.
Aus Alledem geht hervor, daß Schumacher außer
den vier radierten Darstellungen aus der Nibelungen-
sage: „Der Traum der Chriemhilde“ (Kriemhild und
Ute) (Andresen 2), „Der Wettsprung der Prunhilde“
(Andresen 3), „Siegfried kämpft mit Albrich“ (Andresen
4), „Hagen und die Meerfrauen“ (Andresen 5) noch eine
Reihe weitere plante und bereits folgende in Angriff
genommen hatte: Siegfrieds Bad im Drachenblut,
Kriemhild und Hagen, Siegfrieds Ermordung und „Wie
Carl Schumacher: Die Wacht auf der Höhe
Dresden, Kupferstichkabinett
Hagen und Volker vor Chriemhildens Saal saßen“.')
Die Nibelungensage hat ihn wie viele der Mitstrebenden
lebhaft beschäftigt. Ist sie doch das Bucli, das von den
romantischen Malern nächst der Bibel und den liome-
rischen Gesängen am häufigsten illustriert worden ist.
Nun findet man in Naglers Künstlerlexikon 7 8) und in
seinen „Monogrammisten“9) die Notiz, Sclmmacher
habe seine vier Radierungen zu den Nibelungen nach
7) Dazu käme noch „Siegfrieds Abschied von Kriemhilde“,
den Schumacher laut Andresens Angabe (a. a. 0. S. 124) in
einem Gemälde dargestellt hat. Vgl. auch F. v. Boetticher (a. a. 0.
S. 681, I, 4), der zwei Ausführungen dieses Gemäldes erwähnt und
Julius Schnorr von Carolsfeld in Briefe aus Italien (Gotha 1886
S. 430), der die eine 1823 in Rom sah.
8) Band XVI (1846) S. 72.
°) Band II (1860) S. 240 Nr. 650.
137
Zeichnung ist sehr sorgfältig mit dem Bleistift in zarten,
leichten Strichen ausgefiihrt, die die Umrisse mit Fein-
gefühl umschreiben, die Schatten ganz duftig wieder-
geben. Bei der Übertragung auf die Platte ist diese
Zartheit fast ganz verloren gegangen. Die Erfindung
ist nicht ohne Stimmungsreiz. Dieser Reiz liegt in der
Landschaft selbst mit ihrer stillen Wasserfläche, der am
Ufer gelegenen Burg und den fernen bewaldeten Bergen
und wird noch durch die Wahl des Standpunktes ge-
steigert, der einen Fernblick von steiler Höhe ergibt
Die Gestalt des Kriegers unterstützt die Wirkung des
Landschaftlichen und leitet den Blick des Betrachters
zwingend in die Tiefe und Ferne. Auch dieses Alles ist
bei der Radierung verloren gegangen. Indem die Gestah
hier die Mitte des Blattes einnimmt und es in der Höhe
ganz ausfüllt, hält sie den Blick auf und zieht ihn immer
wieder von der Landschaft ab. Zudem schaut der Krie-
ger, dessen Auge auf der Zeichnung nach den Bergen
links schweift, jetzt ins Leere, weil sie weggeschnitten
sind.
In Stil und Zeichenweise ganz gleichartig ist ein
„Drachenkampf des Heiligen Georg“, der allerdings die
eindringliche Stimmung und die schöne Bildanordnung
der „Wacht auf der Höhe“ nicht erreicht. Dieses Blatt
scheint nicht radiert worden zu sein.
Vorbereitende Zeichnungen zu weiteren der von
Andresen beschriebenen Radierungen enthält die
Sammlung noch mehrere. Auf einem kleinen Streifen
Papier findet man neben anderen Szenen aus der Ni-
belungensage die Unterredung zwischen Kriemhild und
Ute aus der ersten Aventüre und zwar zweimal: zuerst
mit einer sitzenden Kriemhild, über die der Künstler
das Wort „stehend“ geschrieben hat, dann mit der so
geänderten Figur. Die Ähnlichkeit beider Fassun-
gen mit der von Andresen beschriebenen Radierung
(Nr. 2) ist unverkennbar. Wahrscheinlich gehören zu
der Radierung „Hagen und die Rheintöchter“ (Andresen
5) die Skizzen eines mit hochgestellten linken Knie da-
stehenden Mannes und mehrerer nackter Frauen auf
einem kleinen Blatt; eine weibliche Aktstudie in grö-
ßeren Abmessungen ist unzweifelhaft für die mittelste
der Rheintöchter gemacht. Endlich ist die Naturstudie
zu einer, einen Stab haltenden Fland, die sich mit meh-
reren anderen auf einem Blatt befindet, bei dem ganz
rechts stehenden Krieger auf dem „Wettsprung mit
Prunhilde“ (Andresen 3) verwendet.
Weitere, nicht radierte Darstellungen aus den „Ni-
belungen“ schließen sich an. Die eine hat der Künst-
ler selbst mit dem Titel „Wie Hagen und Volker vor
Chriemhildens Saal saßen“ und der Angabe „Rom 1821“
versehn; sie ist in Umrissen durchgeführt und nur
wenig schattiert. Die anderen sind wieder kleine Korn-
positionsskizzen. Auf der Rückseite des Blättchens mit
den beiden Einfällen zu „Kriemhild und Ute“ sieht man
die nach links gewendete Kriemhild und den hinter ihr
rechts stehenden Hagen sowie Siegfrieds Bad im
Drachenblut mit der Unterschrift „Zum Schöpfen ge-
neigt“ und auf einem zweiten gleichartigen die Ermor-
dung Siegfrieds und eine einzelne am Boden sitzende
männliche Gestalt, die aus der linken Hand trinkt, an-
scheinend Siegfried an der Quelle.
Aus Alledem geht hervor, daß Schumacher außer
den vier radierten Darstellungen aus der Nibelungen-
sage: „Der Traum der Chriemhilde“ (Kriemhild und
Ute) (Andresen 2), „Der Wettsprung der Prunhilde“
(Andresen 3), „Siegfried kämpft mit Albrich“ (Andresen
4), „Hagen und die Meerfrauen“ (Andresen 5) noch eine
Reihe weitere plante und bereits folgende in Angriff
genommen hatte: Siegfrieds Bad im Drachenblut,
Kriemhild und Hagen, Siegfrieds Ermordung und „Wie
Carl Schumacher: Die Wacht auf der Höhe
Dresden, Kupferstichkabinett
Hagen und Volker vor Chriemhildens Saal saßen“.')
Die Nibelungensage hat ihn wie viele der Mitstrebenden
lebhaft beschäftigt. Ist sie doch das Bucli, das von den
romantischen Malern nächst der Bibel und den liome-
rischen Gesängen am häufigsten illustriert worden ist.
Nun findet man in Naglers Künstlerlexikon 7 8) und in
seinen „Monogrammisten“9) die Notiz, Sclmmacher
habe seine vier Radierungen zu den Nibelungen nach
7) Dazu käme noch „Siegfrieds Abschied von Kriemhilde“,
den Schumacher laut Andresens Angabe (a. a. 0. S. 124) in
einem Gemälde dargestellt hat. Vgl. auch F. v. Boetticher (a. a. 0.
S. 681, I, 4), der zwei Ausführungen dieses Gemäldes erwähnt und
Julius Schnorr von Carolsfeld in Briefe aus Italien (Gotha 1886
S. 430), der die eine 1823 in Rom sah.
8) Band XVI (1846) S. 72.
°) Band II (1860) S. 240 Nr. 650.
137