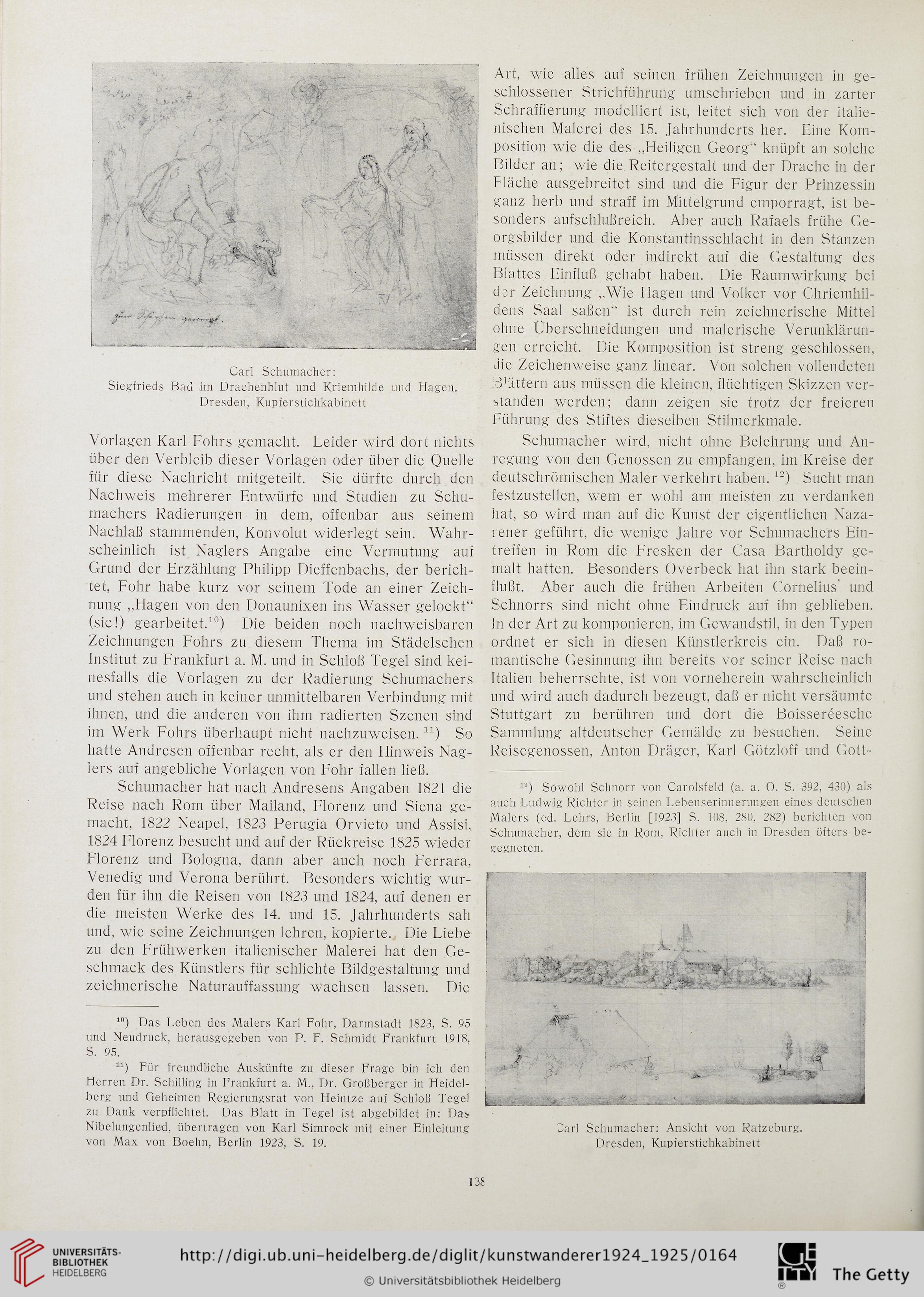."
Carl Schumacher:
Siegfrieds Bad im Drachenblut und Kriemhilde und Hagen.
Dresden, Kupferstichkabinett
Vorlagen Karl Fohrs gemacht. Leider wird dort nichts
über den Verbleib dieser Vorlagen oder über die Quelle
für diese Nachricht mitgeteilt. Sie dürfte durch den
Nachweis mehrerer Entwürfe und Studien zu Schu-
machers Radierungen in dem, offenbar aus seinem
Nachlaß stammenden, Konvolut widerlegt sein. Wahr-
scheinlich ist Naglers Angabe eine Vermutung auf
Grund der Erzählung Philipp Dieffenbachs, der berich-
tet, Fohr habe kurz vor seinem Tode an einer Zeich-
nung ,,Hagen von den Donaunixen ins Wasser gelockt“
(sic!) gearbeitet.10) Die beiden nocli nachweisbaren
Zeichnungen Fohrs zu diesem Thema im Städelschen
lnstitut zu Frankfurt a. M. und in Schloß Tegel sind kei-
nesfalls die Vorlagen zu der Radierung Schumachers
und stehen auch in keiner unmittelbaren Verbindung mit
ihnen, und die anderen von ihm radierten Szenen sind
im Werk Fohrs überhaupt niclit nachzuweisen.X1) So
hatte Andresen offenbar recht, als er den Hinweis Nag-
iers auf angebliche Vorlagen von Fohr fallen ließ.
Schumacher hat nach Andresens Angaben 1821 die
Reise nach Rom über Mailand, Florenz und Siena ge-
macht, 1822 Neapel, 1823 Perugia Orvieto und Assisi,
1824 Florenz besucht und auf der Rückreise 1825 wieder
Florenz und Bologna, dann aber auch nocli Ferrara,
Venedig und Verona berührt. Besonders wichtig wur-
den fiir ihn die Reisen von 1823 und 1824, auf denen er
die meisten Werke des 14. und 15. Jahrhunderts sah
und, wie seine Zeichnungen lehren, kopierte. IJie Liebe
zu den Frühwerken italienischer Malerei hat den Ge-
schmack des Künstlers für schlichte Bildgestaltung und
zeichnerische Naturauffassung wachsen lassen. Die
10) Das Leben des Malers Karl Fohr, Darmstadt 1823, S. 95
und Neudruck, herausgegeben von P. F. Schmidt Frankfurt 1918,
S. 95.
1J) Für freundliche Auskünfte zu dieser Frage bin ich den
Herren Dr. Schilling in Frankfurt a. M., Dr. Qroßberger in Heidel-
berg und Geheimen Regierungsrat von Heintze auf Schloß Tegel
zu Dank verpflichtet. Das Blatt in Tegcl ist abgebildet in: Das
Nibelungenlied, iibertragen von Karl Simrock mit einer Einleitung
von Max von Boehn, Berlin 1923, S. 19.
Art, wie alles auf seinen frühen Zeichnungen in ge-
schlossener Strichführung umschrieben und in zarter
Schraffierung modelliert ist, leitet sich von der italie-
nischen Malerei des 15. Jahrhunderts her. Eine Kom-
position wie die des „Heiligen Georg“ knüpft an solche
Bilder an; wie die Reitergestalt und der Drache in der
Fläche ausgebreitet sind und die Figur der Prinzessin
ganz herb und straff im Mittelgrund emporragt, ist be-
sonders aufschlußreich. Aber aucli Rafaels frühe Ge-
orgsbilder und die Konstantinsschlacht in den Stanzen
müssen direkt oder indirekt auf die Gestaltung des
Blattes Einfluß gehabt haben. Die Raumwirkung bei
der Zeichnung „Wie Hagen und Volker vor Chriemhil-
dens Saal saßen“ ist durch rein zeichnerische Mittel
olme Überschneidungen und malerische Verunklärun-
gen erreicht. Die Komposition ist streng geschlossen,
die Zeichenweise ganz linear. Von solchen vollendeten
B’ättern aus müssen die kleinen, flüchtigen Skizzen ver-
btanden werden; dann zeigen sie trotz der freieren
Führung des Stiftes dieselben Stilmerkmale.
Schumacher wird, nicht oline Belehrung und An-
regung von den Genossen zu empfangen, im Kreise der
deutschrömischen Maler verkehrt haben.12) Sucht man
festzustellen, wem er wohl am meisten zu verdanken
hat, so wird man auf die Kunst der eigentlichen Naza-
rener geführt, die wenige Jahre vor Schumachers Ein-
treffen in Rom die Fresken der Casa Bartholdy ge-
malt hatten. Besonders Overbeck hat ihn stark beein-
flußt. Aber auch die frühen Arbeiten Cornelius und
Schnorrs sind nicht ohne Eindruck auf ihn geblieben.
In der Art zu komponieren, im Gewandstil, in den Typen
ordnet er sich in diesen Künstlerkreis ein. Daß ro-
mantische Gesinnung ihn bereits vor seiner Reise nach
Italien beherrschte, ist von vorneherein wahrscheinlich
und wird auch dadurch bezeugt, daß er nicht versäumte
Stuttgart zu berühren und dort die Boissereesche
Sammlung altdeutscher Gemälde zu besuchen. Seine
Reisegenossen, Anton Dräger, Karl Götzloff und Gott-
12) Sowohl Schnorr von Carolsfeld (a. a. 0. S. 392, 430) als
auch Ludwig Richter in seinen Lebenserinnerungen eines deutschen
Malers (ed. Lehrs, Berlin [1923] S. 108, 280, 282) berichten von
Schumacher, dem sie in Rom, Richter auch in Dresden öfters be-
gegneten.
r "—
Carl Schumacher: Ansicht von Ratzeburg.
Dresden, Kupferstichkabinett
13£
Carl Schumacher:
Siegfrieds Bad im Drachenblut und Kriemhilde und Hagen.
Dresden, Kupferstichkabinett
Vorlagen Karl Fohrs gemacht. Leider wird dort nichts
über den Verbleib dieser Vorlagen oder über die Quelle
für diese Nachricht mitgeteilt. Sie dürfte durch den
Nachweis mehrerer Entwürfe und Studien zu Schu-
machers Radierungen in dem, offenbar aus seinem
Nachlaß stammenden, Konvolut widerlegt sein. Wahr-
scheinlich ist Naglers Angabe eine Vermutung auf
Grund der Erzählung Philipp Dieffenbachs, der berich-
tet, Fohr habe kurz vor seinem Tode an einer Zeich-
nung ,,Hagen von den Donaunixen ins Wasser gelockt“
(sic!) gearbeitet.10) Die beiden nocli nachweisbaren
Zeichnungen Fohrs zu diesem Thema im Städelschen
lnstitut zu Frankfurt a. M. und in Schloß Tegel sind kei-
nesfalls die Vorlagen zu der Radierung Schumachers
und stehen auch in keiner unmittelbaren Verbindung mit
ihnen, und die anderen von ihm radierten Szenen sind
im Werk Fohrs überhaupt niclit nachzuweisen.X1) So
hatte Andresen offenbar recht, als er den Hinweis Nag-
iers auf angebliche Vorlagen von Fohr fallen ließ.
Schumacher hat nach Andresens Angaben 1821 die
Reise nach Rom über Mailand, Florenz und Siena ge-
macht, 1822 Neapel, 1823 Perugia Orvieto und Assisi,
1824 Florenz besucht und auf der Rückreise 1825 wieder
Florenz und Bologna, dann aber auch nocli Ferrara,
Venedig und Verona berührt. Besonders wichtig wur-
den fiir ihn die Reisen von 1823 und 1824, auf denen er
die meisten Werke des 14. und 15. Jahrhunderts sah
und, wie seine Zeichnungen lehren, kopierte. IJie Liebe
zu den Frühwerken italienischer Malerei hat den Ge-
schmack des Künstlers für schlichte Bildgestaltung und
zeichnerische Naturauffassung wachsen lassen. Die
10) Das Leben des Malers Karl Fohr, Darmstadt 1823, S. 95
und Neudruck, herausgegeben von P. F. Schmidt Frankfurt 1918,
S. 95.
1J) Für freundliche Auskünfte zu dieser Frage bin ich den
Herren Dr. Schilling in Frankfurt a. M., Dr. Qroßberger in Heidel-
berg und Geheimen Regierungsrat von Heintze auf Schloß Tegel
zu Dank verpflichtet. Das Blatt in Tegcl ist abgebildet in: Das
Nibelungenlied, iibertragen von Karl Simrock mit einer Einleitung
von Max von Boehn, Berlin 1923, S. 19.
Art, wie alles auf seinen frühen Zeichnungen in ge-
schlossener Strichführung umschrieben und in zarter
Schraffierung modelliert ist, leitet sich von der italie-
nischen Malerei des 15. Jahrhunderts her. Eine Kom-
position wie die des „Heiligen Georg“ knüpft an solche
Bilder an; wie die Reitergestalt und der Drache in der
Fläche ausgebreitet sind und die Figur der Prinzessin
ganz herb und straff im Mittelgrund emporragt, ist be-
sonders aufschlußreich. Aber aucli Rafaels frühe Ge-
orgsbilder und die Konstantinsschlacht in den Stanzen
müssen direkt oder indirekt auf die Gestaltung des
Blattes Einfluß gehabt haben. Die Raumwirkung bei
der Zeichnung „Wie Hagen und Volker vor Chriemhil-
dens Saal saßen“ ist durch rein zeichnerische Mittel
olme Überschneidungen und malerische Verunklärun-
gen erreicht. Die Komposition ist streng geschlossen,
die Zeichenweise ganz linear. Von solchen vollendeten
B’ättern aus müssen die kleinen, flüchtigen Skizzen ver-
btanden werden; dann zeigen sie trotz der freieren
Führung des Stiftes dieselben Stilmerkmale.
Schumacher wird, nicht oline Belehrung und An-
regung von den Genossen zu empfangen, im Kreise der
deutschrömischen Maler verkehrt haben.12) Sucht man
festzustellen, wem er wohl am meisten zu verdanken
hat, so wird man auf die Kunst der eigentlichen Naza-
rener geführt, die wenige Jahre vor Schumachers Ein-
treffen in Rom die Fresken der Casa Bartholdy ge-
malt hatten. Besonders Overbeck hat ihn stark beein-
flußt. Aber auch die frühen Arbeiten Cornelius und
Schnorrs sind nicht ohne Eindruck auf ihn geblieben.
In der Art zu komponieren, im Gewandstil, in den Typen
ordnet er sich in diesen Künstlerkreis ein. Daß ro-
mantische Gesinnung ihn bereits vor seiner Reise nach
Italien beherrschte, ist von vorneherein wahrscheinlich
und wird auch dadurch bezeugt, daß er nicht versäumte
Stuttgart zu berühren und dort die Boissereesche
Sammlung altdeutscher Gemälde zu besuchen. Seine
Reisegenossen, Anton Dräger, Karl Götzloff und Gott-
12) Sowohl Schnorr von Carolsfeld (a. a. 0. S. 392, 430) als
auch Ludwig Richter in seinen Lebenserinnerungen eines deutschen
Malers (ed. Lehrs, Berlin [1923] S. 108, 280, 282) berichten von
Schumacher, dem sie in Rom, Richter auch in Dresden öfters be-
gegneten.
r "—
Carl Schumacher: Ansicht von Ratzeburg.
Dresden, Kupferstichkabinett
13£