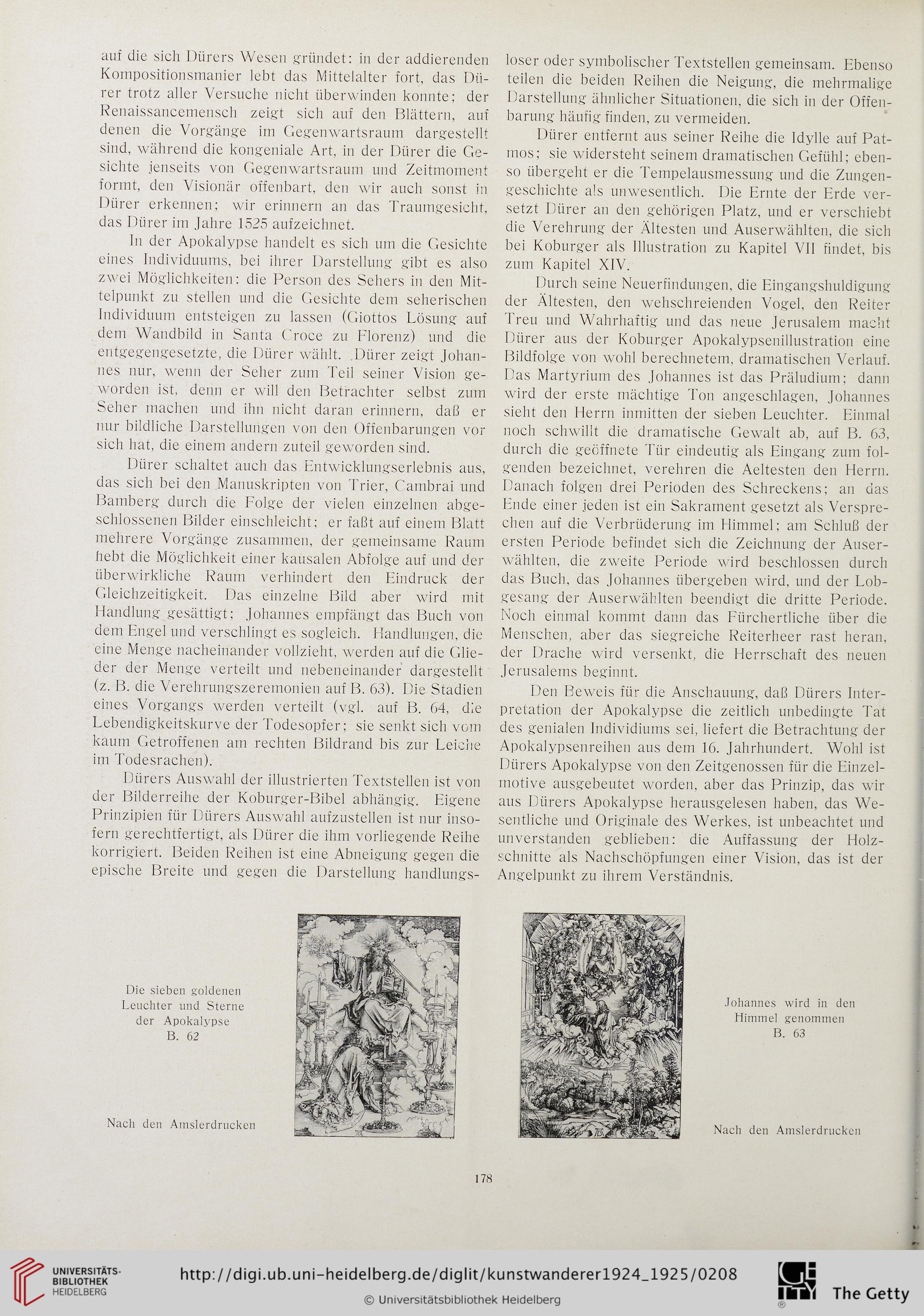auf die sich Dürers Wesen gründet: in der addicrenden
Kompositionsmanier lebt das Mittelalter fort, das Dü-
rer trotz aller Versuche nicht überwinden konnte; der
Renaissancemensch zeigt sich auf den Blättern, auf
denen die Vorgänge im Gegenwartsraum dargestellt
sind, während die kongeniale Art, in der Dürer die Ge-
sichte jenseits von Gegenwartsraum und Zeitmoment
formt, den Visionär offenbart, den wir auch sonst in
Dürer erkennen; wir erinnern an das Traumgesicht,
das Dürer im Jahre 1525 aufzeichnet.
In der Apokalypse liandelt es sich um die Gesichte
eines Individuums, bei ilirer Darstellung gibt es also
zwei Möglichkeiten: die Person des Sehers in den Mit-
telpunkt zn stellen und die Gesichte dem seherischen
Individuum entsteigen zu lassen (Giottos Lösung auf
dem Wandbild in Santa Croce zu Florenz) und die
entgegengesetzte, die Dürer wählt. Dürer zeigt Johan-
nes nur, wenn der Seher zum Teil seiner Vision ge-
worden ist, denn er will den Betrachter selbst zum
Seher machen und ihn nicht daran erinnern, daß er
nur bildliche Darstellungen von den Offenbarungen vor
sicli hat, die einem andern zuteil geworden sind.
Dürer schaltet auch das Entwicklungserlebnis aus,
das sich bei den Manuskripten von Trier, Cambrai und
Bamberg durch die Folge der vielen einzelnen abge-
schlossenen Bilder einschleicht; er faßt auf einem Blatt
mehrere Vorgänge zusammen, der gemeinsame Raum
hebt die Möglichkeit einer kausalen Abfolge auf und der
iiberwirkliche Raum verhindert den Eindruck der
Gleichzeitigkeit. Das einzelne Bild aber wird mit
Handlung gesättigt; Johannes empfängt das Buch von
dem Engel und verschlingt es sogleich. Handlungen, die
eine Menge nacheinander vollzieht, werden auf die Glie-
der der Menge verteilt und nebeneinander dargestellt
(z. B. die Verehrungszeremonien auf B. 63). Die Stadien
eines Vorgangs werden verteilt (vgl. auf B. 64, die
Lebendigkeitskurve der Todesopfer; sie senkt sich vorn
kaum Getroffenen am rechten Bildrand bis zur Leiciie
im Todesrachen).
Dürers Auswahl der illustrierten Textstellen ist von
der Bilderreihe der Kobnrger-Bibel abhängig. Eigene
Prinzipien fiir Dürers Auswahl aufzustellen ist nur inso-
fern gerechtfertigt, als Dürer die ihm vorliegende Reilie
korrigiert. Beiden Reihen ist eine Abneigung gegen die
epische Breite und gegen die Darstellung handlungs-
loser oder symbolischer Textstellen gemeinsam. Ebenso
teilen die beiden I^eihen die Neigung, die mehrmalige
Darstellung ähnlicher Situationen, die sich in der Offen-
barung häufig finden, zu vermeiden.
Dürer entfernt aus seiner Reihe die Idylle auf Pat-
mos; sie widersteht seinem dramatischen Gefühl; eben-
so übergeht er die Tempelausmessung und die Zungen-
geschichte als unwesentlich. Die Ernte der Erde ver-
setzt Dürer an den gehörigen Platz, und er verschiebt
die Verehrung der Ältesten und Auserwählten, die sich
bei Koburger als Illustration zu Kapitel VII findet, bis
zum Kapitel XIV.
Durch seine Neuerfindungen, die Eingangshuldigung
der Ältesten, den wehschreienden Vogel, den Reiter
Treu und Wahrhaftig und das neue Jerusalem macht
Dürer aus der Koburger Apokalypsenillustration eine
Bildfolge von wolil berechnetem, dramatischen Verlauf.
Das Martyrium des Johannes ist das Präludium; dann
wird der erste mächtige Ton angeschlagen, Johannes
sieht den Herrn inmitten der sieben Leuchter. Einmal
noch schwillt die dramatische Gewalt ab, auf B. 63,
durch die geöffnete Tür eindeutig als Eingang zum fol-
genden bezeiclmet, verehren die Aeltesten den Herrn.
Danacli folgen drei Perioden des Schreckens; an das
Ende einer jeden ist ein Sakrament gesetzt als Verspre-
chen auf die Verbrüderung im Himmel; am Schluß der
ersten Periode befindet sich die Zeichnung der Auser-
wählten, die zweite Periode wird beschlossen durch
das Bucb, das Johannes übergeben wird, und der Lob-
gesang der Auserwählten beendigt die dritte Periode.
Noch einmal kommt dann das Fürchertliche über die
Menschen, aber das siegreiche Reiterheer rast heran,
der Drache wird versenkt, die Herrschaft des neuen
Jerusalems beginnt.
Den Beweis für die Anschauung, daß Dürers Inter-
pretation der Apokalypse die zeitlich unbedingte Tat
des genialen Individiums sei, liefert die Betrachtung der
Apokalypsenreihen aus dem 16. Jahrhundert. Wohl ist
Dürers Apokalypse von den Zeitgenossen für die Einzel-
motive ausgebeutet worden, aber das Prinzip, das wir
aus Dürers Apokalypse herausgelesen haben, das We-
sentliche und Originale des Werkes, ist unbeachtet und
unverstanden geblieben: die Auffassung der Holz-
schnitte als Nachschöpfungen einer Vision, das ist der
Angelpunkt zu ihrem Verständnis.
Die sieben goldenen
Leuchter und Sterne
der Apokalypse
B. 62
Nach den Amslerdrucken
Johannes wird in den
Himrnel genommen
B. 63
Nach den Amslerdrucken
178
Kompositionsmanier lebt das Mittelalter fort, das Dü-
rer trotz aller Versuche nicht überwinden konnte; der
Renaissancemensch zeigt sich auf den Blättern, auf
denen die Vorgänge im Gegenwartsraum dargestellt
sind, während die kongeniale Art, in der Dürer die Ge-
sichte jenseits von Gegenwartsraum und Zeitmoment
formt, den Visionär offenbart, den wir auch sonst in
Dürer erkennen; wir erinnern an das Traumgesicht,
das Dürer im Jahre 1525 aufzeichnet.
In der Apokalypse liandelt es sich um die Gesichte
eines Individuums, bei ilirer Darstellung gibt es also
zwei Möglichkeiten: die Person des Sehers in den Mit-
telpunkt zn stellen und die Gesichte dem seherischen
Individuum entsteigen zu lassen (Giottos Lösung auf
dem Wandbild in Santa Croce zu Florenz) und die
entgegengesetzte, die Dürer wählt. Dürer zeigt Johan-
nes nur, wenn der Seher zum Teil seiner Vision ge-
worden ist, denn er will den Betrachter selbst zum
Seher machen und ihn nicht daran erinnern, daß er
nur bildliche Darstellungen von den Offenbarungen vor
sicli hat, die einem andern zuteil geworden sind.
Dürer schaltet auch das Entwicklungserlebnis aus,
das sich bei den Manuskripten von Trier, Cambrai und
Bamberg durch die Folge der vielen einzelnen abge-
schlossenen Bilder einschleicht; er faßt auf einem Blatt
mehrere Vorgänge zusammen, der gemeinsame Raum
hebt die Möglichkeit einer kausalen Abfolge auf und der
iiberwirkliche Raum verhindert den Eindruck der
Gleichzeitigkeit. Das einzelne Bild aber wird mit
Handlung gesättigt; Johannes empfängt das Buch von
dem Engel und verschlingt es sogleich. Handlungen, die
eine Menge nacheinander vollzieht, werden auf die Glie-
der der Menge verteilt und nebeneinander dargestellt
(z. B. die Verehrungszeremonien auf B. 63). Die Stadien
eines Vorgangs werden verteilt (vgl. auf B. 64, die
Lebendigkeitskurve der Todesopfer; sie senkt sich vorn
kaum Getroffenen am rechten Bildrand bis zur Leiciie
im Todesrachen).
Dürers Auswahl der illustrierten Textstellen ist von
der Bilderreihe der Kobnrger-Bibel abhängig. Eigene
Prinzipien fiir Dürers Auswahl aufzustellen ist nur inso-
fern gerechtfertigt, als Dürer die ihm vorliegende Reilie
korrigiert. Beiden Reihen ist eine Abneigung gegen die
epische Breite und gegen die Darstellung handlungs-
loser oder symbolischer Textstellen gemeinsam. Ebenso
teilen die beiden I^eihen die Neigung, die mehrmalige
Darstellung ähnlicher Situationen, die sich in der Offen-
barung häufig finden, zu vermeiden.
Dürer entfernt aus seiner Reihe die Idylle auf Pat-
mos; sie widersteht seinem dramatischen Gefühl; eben-
so übergeht er die Tempelausmessung und die Zungen-
geschichte als unwesentlich. Die Ernte der Erde ver-
setzt Dürer an den gehörigen Platz, und er verschiebt
die Verehrung der Ältesten und Auserwählten, die sich
bei Koburger als Illustration zu Kapitel VII findet, bis
zum Kapitel XIV.
Durch seine Neuerfindungen, die Eingangshuldigung
der Ältesten, den wehschreienden Vogel, den Reiter
Treu und Wahrhaftig und das neue Jerusalem macht
Dürer aus der Koburger Apokalypsenillustration eine
Bildfolge von wolil berechnetem, dramatischen Verlauf.
Das Martyrium des Johannes ist das Präludium; dann
wird der erste mächtige Ton angeschlagen, Johannes
sieht den Herrn inmitten der sieben Leuchter. Einmal
noch schwillt die dramatische Gewalt ab, auf B. 63,
durch die geöffnete Tür eindeutig als Eingang zum fol-
genden bezeiclmet, verehren die Aeltesten den Herrn.
Danacli folgen drei Perioden des Schreckens; an das
Ende einer jeden ist ein Sakrament gesetzt als Verspre-
chen auf die Verbrüderung im Himmel; am Schluß der
ersten Periode befindet sich die Zeichnung der Auser-
wählten, die zweite Periode wird beschlossen durch
das Bucb, das Johannes übergeben wird, und der Lob-
gesang der Auserwählten beendigt die dritte Periode.
Noch einmal kommt dann das Fürchertliche über die
Menschen, aber das siegreiche Reiterheer rast heran,
der Drache wird versenkt, die Herrschaft des neuen
Jerusalems beginnt.
Den Beweis für die Anschauung, daß Dürers Inter-
pretation der Apokalypse die zeitlich unbedingte Tat
des genialen Individiums sei, liefert die Betrachtung der
Apokalypsenreihen aus dem 16. Jahrhundert. Wohl ist
Dürers Apokalypse von den Zeitgenossen für die Einzel-
motive ausgebeutet worden, aber das Prinzip, das wir
aus Dürers Apokalypse herausgelesen haben, das We-
sentliche und Originale des Werkes, ist unbeachtet und
unverstanden geblieben: die Auffassung der Holz-
schnitte als Nachschöpfungen einer Vision, das ist der
Angelpunkt zu ihrem Verständnis.
Die sieben goldenen
Leuchter und Sterne
der Apokalypse
B. 62
Nach den Amslerdrucken
Johannes wird in den
Himrnel genommen
B. 63
Nach den Amslerdrucken
178