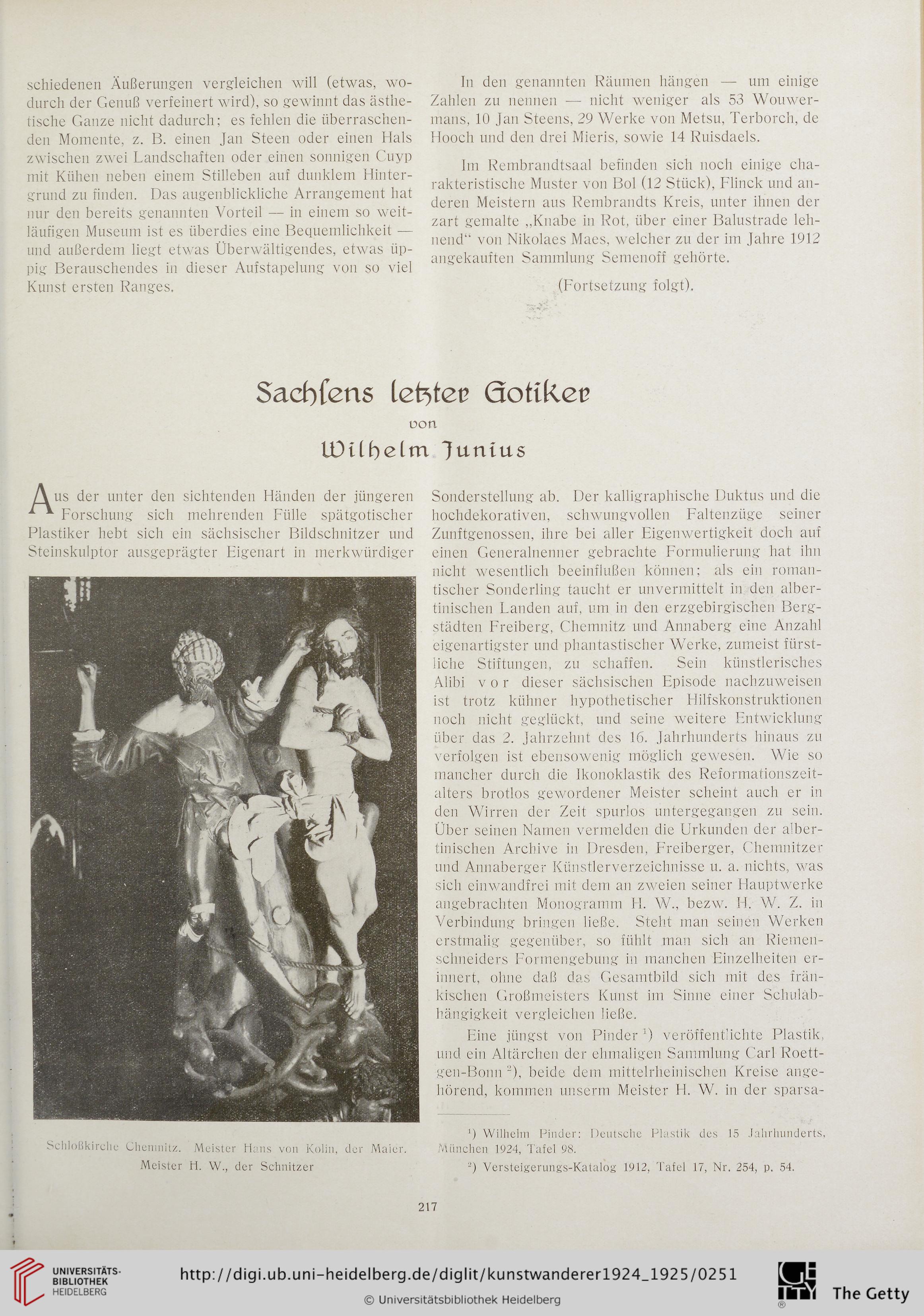schiedenen Äußerungen vergleichen will (etwas, wo-
durch der Gennß verfeinert wird), so gewinnt das ästhe-
tische Ganze nicht dadurch; es fehlen die iiberraschen-
den Momente, z. B. einen Jan Steen oder einen Hals
zwischen zwei Landschaften oder einen sonnigen Cuyp
mit Kühen neben einem Stilleben auf dunklem Hinter-
grnnd zu finden. Das augenblickliche Arrangement hat
nur den bereits genannten Vorteil — in einem so weit-
läufigen Museum ist es iiberdies eine Bequemlichkeit —
und außerdem liegt etwas Überwältigendes, etwas üp-
pig Berauschendes in dieser Aufstapelung von so viel
Kunst ersten Ranges,
In den genannten Räumen hängen — um einige
Zahlen zu nennen — nicht weniger als 53 Wouwer-
mans, 10 jan Steens, 29 Werke von Metsu, Terborch, de
Hooch und den drei Mieris, sowie 14 Ruisdaels.
Im Rembrandtsaal befinden sich noch einige cha-
rakteristische Muster von Bol (12 Stück), Flinck und an-
deren Meistern aus Rembrandts Kreis, unter ihnen der
zart gemalte „Knabe in Rot, über einer Balustrade leh-
nend“ von Nikolaes Maes, welcher zu der im Jahre 1912
angekauften Sammlung Semenoff gehörte.
(Fortsetzung folgt).
Sacbfens lebtev 6ottk.ec
oon
luntus
A us der unter den sichtenden Händen der jüngeren
Forschung sich mehrenden Fülle spätgotischer
Plastiker hebt sich ein sächsischer Bildschnitzer und
Steinsknlptor ausgeprägter Eigenart in merkwürdiger
ScliloBkirclie Chenmitz. Meister Hans von Kolin, der Maier.
Meister H. W., der Schnitzer
Sonderstellung ab. Der kalligraphische Duktus und die
hochdekorativen, schwungvollen Faltenzüge seiner
Zunftgenossen, ilire bei aller Eigenwertigkeit doch auf
einen Generalnenner gebrachte Formulierung hat ihn
nicht wesentlich beeinflußen können; als ein roman-
tischer Sonderling taucht er unvermittelt in den alber-
tinischen Landen auf, um in den erzgebirgischen Berg-
städten Freiberg, Chemnitz und Annaberg eine Anzahl
eigenartigster und phantastischer Werke, zumeist fürst-
liche Stiftungen, zu schaffen. Sein künstlerisches
Alibi v o r dieser sächsischen Episode nachzuweisen
ist trotz kühner hypothetischer Hilfskonstruktionen
noch nicht geglückt, und seine weitere Entwicklung
über das 2. jahrzehnt des 16. Jahrhunderts hinaus zu
verfolgen ist ebensowemg möglich gewesen. Wie so
mancher durch die Ikonoklastik des Reformationszeit-
alters brotlos gewordener Meister scheint auch er in
den Wirren der Zeit spurlos untergegangen zu sein.
Über seinen Namen vermelden die Urkunden der alber-
tinischen Archive in Dresden, Freiberger, Chemnitzer
und Annaberger Künstlerverzeichnisse u. a. nichts, was
sich einwandfrei mit dem an zweien seiner Hauptwerke
angebrachten Monogramm H. W„ bezw. H. W. Z. in
Verbindung bringen ließe. Steht man seinen Werken
erstmalig gegeniiber, so fühlt man sicli an Riemen-
schneiders Formengebung in manchen Einzelheiten er-
innert, ohne daß das Gesamtbild sich mit des frän-
kischen Großmeisters Kunst im Sinne einer Schuläb-
hängigkeit vergleichen ließe.
Eine jüngst von Pinder 3) veröffentlichte Plastik,
und ein Altärchen der ehmaligen Sammlung Garl Roett-
gen-Bonn D, beide dem mittelrheinischen Kreise ange-
liörend, kommen unserm Meister H. W. in der sparsa-
3) Wilhclm Pinder: Deutsche Plastik des 15 Jahrhunderts,
Munchen 1924, T'afel 98.
-) Versteigenmgs-Katalog 1912, Tafel 17, Nr. 254, p. 54.
217
durch der Gennß verfeinert wird), so gewinnt das ästhe-
tische Ganze nicht dadurch; es fehlen die iiberraschen-
den Momente, z. B. einen Jan Steen oder einen Hals
zwischen zwei Landschaften oder einen sonnigen Cuyp
mit Kühen neben einem Stilleben auf dunklem Hinter-
grnnd zu finden. Das augenblickliche Arrangement hat
nur den bereits genannten Vorteil — in einem so weit-
läufigen Museum ist es iiberdies eine Bequemlichkeit —
und außerdem liegt etwas Überwältigendes, etwas üp-
pig Berauschendes in dieser Aufstapelung von so viel
Kunst ersten Ranges,
In den genannten Räumen hängen — um einige
Zahlen zu nennen — nicht weniger als 53 Wouwer-
mans, 10 jan Steens, 29 Werke von Metsu, Terborch, de
Hooch und den drei Mieris, sowie 14 Ruisdaels.
Im Rembrandtsaal befinden sich noch einige cha-
rakteristische Muster von Bol (12 Stück), Flinck und an-
deren Meistern aus Rembrandts Kreis, unter ihnen der
zart gemalte „Knabe in Rot, über einer Balustrade leh-
nend“ von Nikolaes Maes, welcher zu der im Jahre 1912
angekauften Sammlung Semenoff gehörte.
(Fortsetzung folgt).
Sacbfens lebtev 6ottk.ec
oon
luntus
A us der unter den sichtenden Händen der jüngeren
Forschung sich mehrenden Fülle spätgotischer
Plastiker hebt sich ein sächsischer Bildschnitzer und
Steinsknlptor ausgeprägter Eigenart in merkwürdiger
ScliloBkirclie Chenmitz. Meister Hans von Kolin, der Maier.
Meister H. W., der Schnitzer
Sonderstellung ab. Der kalligraphische Duktus und die
hochdekorativen, schwungvollen Faltenzüge seiner
Zunftgenossen, ilire bei aller Eigenwertigkeit doch auf
einen Generalnenner gebrachte Formulierung hat ihn
nicht wesentlich beeinflußen können; als ein roman-
tischer Sonderling taucht er unvermittelt in den alber-
tinischen Landen auf, um in den erzgebirgischen Berg-
städten Freiberg, Chemnitz und Annaberg eine Anzahl
eigenartigster und phantastischer Werke, zumeist fürst-
liche Stiftungen, zu schaffen. Sein künstlerisches
Alibi v o r dieser sächsischen Episode nachzuweisen
ist trotz kühner hypothetischer Hilfskonstruktionen
noch nicht geglückt, und seine weitere Entwicklung
über das 2. jahrzehnt des 16. Jahrhunderts hinaus zu
verfolgen ist ebensowemg möglich gewesen. Wie so
mancher durch die Ikonoklastik des Reformationszeit-
alters brotlos gewordener Meister scheint auch er in
den Wirren der Zeit spurlos untergegangen zu sein.
Über seinen Namen vermelden die Urkunden der alber-
tinischen Archive in Dresden, Freiberger, Chemnitzer
und Annaberger Künstlerverzeichnisse u. a. nichts, was
sich einwandfrei mit dem an zweien seiner Hauptwerke
angebrachten Monogramm H. W„ bezw. H. W. Z. in
Verbindung bringen ließe. Steht man seinen Werken
erstmalig gegeniiber, so fühlt man sicli an Riemen-
schneiders Formengebung in manchen Einzelheiten er-
innert, ohne daß das Gesamtbild sich mit des frän-
kischen Großmeisters Kunst im Sinne einer Schuläb-
hängigkeit vergleichen ließe.
Eine jüngst von Pinder 3) veröffentlichte Plastik,
und ein Altärchen der ehmaligen Sammlung Garl Roett-
gen-Bonn D, beide dem mittelrheinischen Kreise ange-
liörend, kommen unserm Meister H. W. in der sparsa-
3) Wilhclm Pinder: Deutsche Plastik des 15 Jahrhunderts,
Munchen 1924, T'afel 98.
-) Versteigenmgs-Katalog 1912, Tafel 17, Nr. 254, p. 54.
217