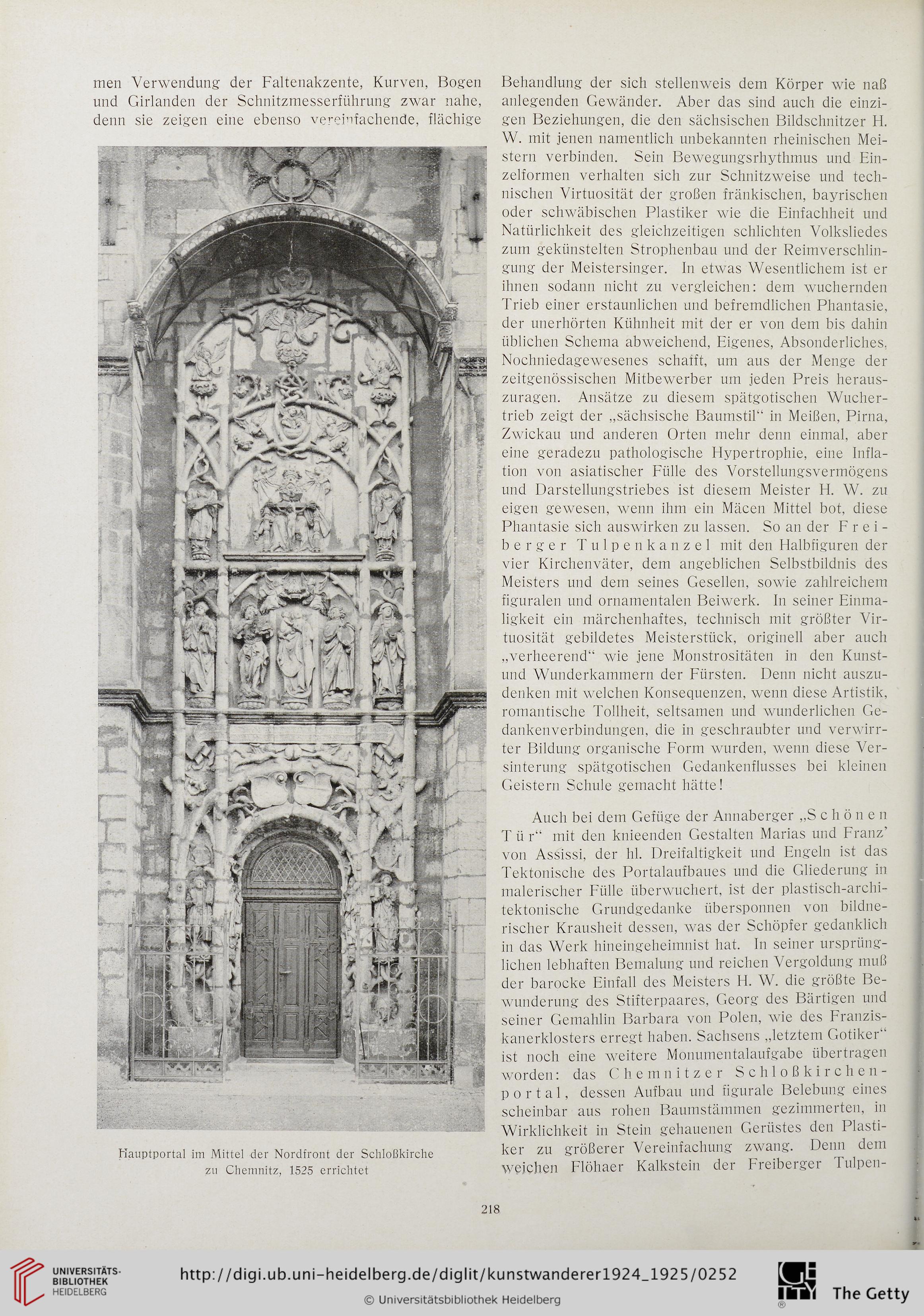men Verwendung der Faltenakzente, Kurven, Bogen
und Girlanden der Schnitzmesserführung zwar nahe,
denn sie zeigen eine ebenso vereinfachende, flächige
Hauptportal im Mittel der Nordfront der Schloßkirche
zu Chemnitz, 1525 errichtet
Behandlung der sich stellenweis dem Körper wie naß
anlegenden Gewänder. Aber das sind auch die einzi-
gen Beziehungen, die den sächsischen Bildschnitzer H.
W. mit jenen namentlich unbekannten rheinischen Mei-
stern verbinden. Sein Bewegungsrhythmus und Ein-
zelformen verhalten sicli zur Schnitzweise und tech-
nischen Virtuosität der großen fränkischen, bayrischen
oder schwäbischen Plastiker wie die Einfachheit und
Natürlichkeit des gleichzeitigen schlichten Volksliedes
zum gekünstelten Strophenbau und der Reimverschlin-
gung der Meistersinger. In etwas Wesentlichem ist er
ihnen sodann nicht zu vergleichen: dem wuchernden
Trieb einer erstaunlichen und befremdlichen Phantasie,
der unerhörten Kühnheit mit der er von dem bis dahin
üblichen Schema abweichend, Eigenes, Absonderliches.
Nochniedagewesenes schafft, um aus der Menge der
zeitgenössischen Mitbewerber um jeden Preis heraus-
zuragen. Ansätze zu diesem spätgotischen Wucher-
trieb zeigt der „sächsische Baumstil“ in Meißen, Pirna,
Zwickau und anderen Orten mehr denn einmal, aber
eine geradezu pathologische Hypertrophie, eine Infla-
tion von asiatischer Fülle des Vorstellungsvermögens
und Darstellungstriebes ist diesem Meister H. W. zu
eigen gewesen, wenn ihm ein Mäcen Mittel bot, diese
Phantasie sich auswirken zu lassen. So an der F r e i -
b e r g e r T u 1 p e n k a n z e 1 mit den Halbfiguren der
vier Kirchenväter, dem angeblichen Selbstbildnis des
Meisters und dem seines Gesellen, sowie zahlreichem
figuralen und ornamentalen Beiwerk. In seiner Einma-
ligkeit ein märchenhaftes, technisch mit größter Vir-
tuosität gebildetes Meisterstück, originell aber auch
„verheerend“ wie jene Monstrositäten in den Kunst-
und Wunderkammern der Fürsten. Denn nicht auszu-
denken mit welchen Konsequenzen, wenn diese Artistik,
romantische Tollheit, seltsamen und wunderlichen Ge-
dankenverbindungen, die in geschraubter und verwirr-
ter Bildung organische Form wurden, Avenn diese Ver-
sinterung spätgotischen Gedankenflusses bei kleinen
Geistern Schule gemacht hätte!
Auch bei dem Gefüge der Annaberger „S c h ö n e n
T ü r“ mit den knieenden Gestalten Marias und Eranz’
von Assissi, der hl. Dreifaltigkeit und Engeln ist das
Tektonische des Portalaufbaues und die Gliederung in
malerischer Fülle überwuchert, ist der plastisch-archi-
tektonische Grundgedanke übersponnen von bildne-
rischer Krausheit dessen, was der Schöpfer gedanklich
in das Werk hineingeheimhist hat. In seiner ursprüng-
lichen lebhaften Bemalung und reichen Vergoldung muß
der barocke Einfall des Meisters H. W. die größte Be-
wunderung des Stifterpaares, Georg des Bärtigen und
seiner Gemahlin Barbara von Polen, wie des Franzis-
kanerklosters erregt haben. Sachsens „letztem Gotiker
ist noch eine weitere Monumentalaufgabe übertragen
worden: das C h e m n i t z e r S c h 1 o ß k i r c h e n -
p o r t a 1, dessen Aufbau und figurale Belebung eines
scheinbar aus rohen Baumstämmen gezimmerten, in
Wirklichkeit in Stein gehauenen Gerüstes den Plasti-
ker zu größerer Vereinfachung zwang. Denn dem
weichen Flöhaer Kalkstein der Freiberger I ulpen-
218
und Girlanden der Schnitzmesserführung zwar nahe,
denn sie zeigen eine ebenso vereinfachende, flächige
Hauptportal im Mittel der Nordfront der Schloßkirche
zu Chemnitz, 1525 errichtet
Behandlung der sich stellenweis dem Körper wie naß
anlegenden Gewänder. Aber das sind auch die einzi-
gen Beziehungen, die den sächsischen Bildschnitzer H.
W. mit jenen namentlich unbekannten rheinischen Mei-
stern verbinden. Sein Bewegungsrhythmus und Ein-
zelformen verhalten sicli zur Schnitzweise und tech-
nischen Virtuosität der großen fränkischen, bayrischen
oder schwäbischen Plastiker wie die Einfachheit und
Natürlichkeit des gleichzeitigen schlichten Volksliedes
zum gekünstelten Strophenbau und der Reimverschlin-
gung der Meistersinger. In etwas Wesentlichem ist er
ihnen sodann nicht zu vergleichen: dem wuchernden
Trieb einer erstaunlichen und befremdlichen Phantasie,
der unerhörten Kühnheit mit der er von dem bis dahin
üblichen Schema abweichend, Eigenes, Absonderliches.
Nochniedagewesenes schafft, um aus der Menge der
zeitgenössischen Mitbewerber um jeden Preis heraus-
zuragen. Ansätze zu diesem spätgotischen Wucher-
trieb zeigt der „sächsische Baumstil“ in Meißen, Pirna,
Zwickau und anderen Orten mehr denn einmal, aber
eine geradezu pathologische Hypertrophie, eine Infla-
tion von asiatischer Fülle des Vorstellungsvermögens
und Darstellungstriebes ist diesem Meister H. W. zu
eigen gewesen, wenn ihm ein Mäcen Mittel bot, diese
Phantasie sich auswirken zu lassen. So an der F r e i -
b e r g e r T u 1 p e n k a n z e 1 mit den Halbfiguren der
vier Kirchenväter, dem angeblichen Selbstbildnis des
Meisters und dem seines Gesellen, sowie zahlreichem
figuralen und ornamentalen Beiwerk. In seiner Einma-
ligkeit ein märchenhaftes, technisch mit größter Vir-
tuosität gebildetes Meisterstück, originell aber auch
„verheerend“ wie jene Monstrositäten in den Kunst-
und Wunderkammern der Fürsten. Denn nicht auszu-
denken mit welchen Konsequenzen, wenn diese Artistik,
romantische Tollheit, seltsamen und wunderlichen Ge-
dankenverbindungen, die in geschraubter und verwirr-
ter Bildung organische Form wurden, Avenn diese Ver-
sinterung spätgotischen Gedankenflusses bei kleinen
Geistern Schule gemacht hätte!
Auch bei dem Gefüge der Annaberger „S c h ö n e n
T ü r“ mit den knieenden Gestalten Marias und Eranz’
von Assissi, der hl. Dreifaltigkeit und Engeln ist das
Tektonische des Portalaufbaues und die Gliederung in
malerischer Fülle überwuchert, ist der plastisch-archi-
tektonische Grundgedanke übersponnen von bildne-
rischer Krausheit dessen, was der Schöpfer gedanklich
in das Werk hineingeheimhist hat. In seiner ursprüng-
lichen lebhaften Bemalung und reichen Vergoldung muß
der barocke Einfall des Meisters H. W. die größte Be-
wunderung des Stifterpaares, Georg des Bärtigen und
seiner Gemahlin Barbara von Polen, wie des Franzis-
kanerklosters erregt haben. Sachsens „letztem Gotiker
ist noch eine weitere Monumentalaufgabe übertragen
worden: das C h e m n i t z e r S c h 1 o ß k i r c h e n -
p o r t a 1, dessen Aufbau und figurale Belebung eines
scheinbar aus rohen Baumstämmen gezimmerten, in
Wirklichkeit in Stein gehauenen Gerüstes den Plasti-
ker zu größerer Vereinfachung zwang. Denn dem
weichen Flöhaer Kalkstein der Freiberger I ulpen-
218