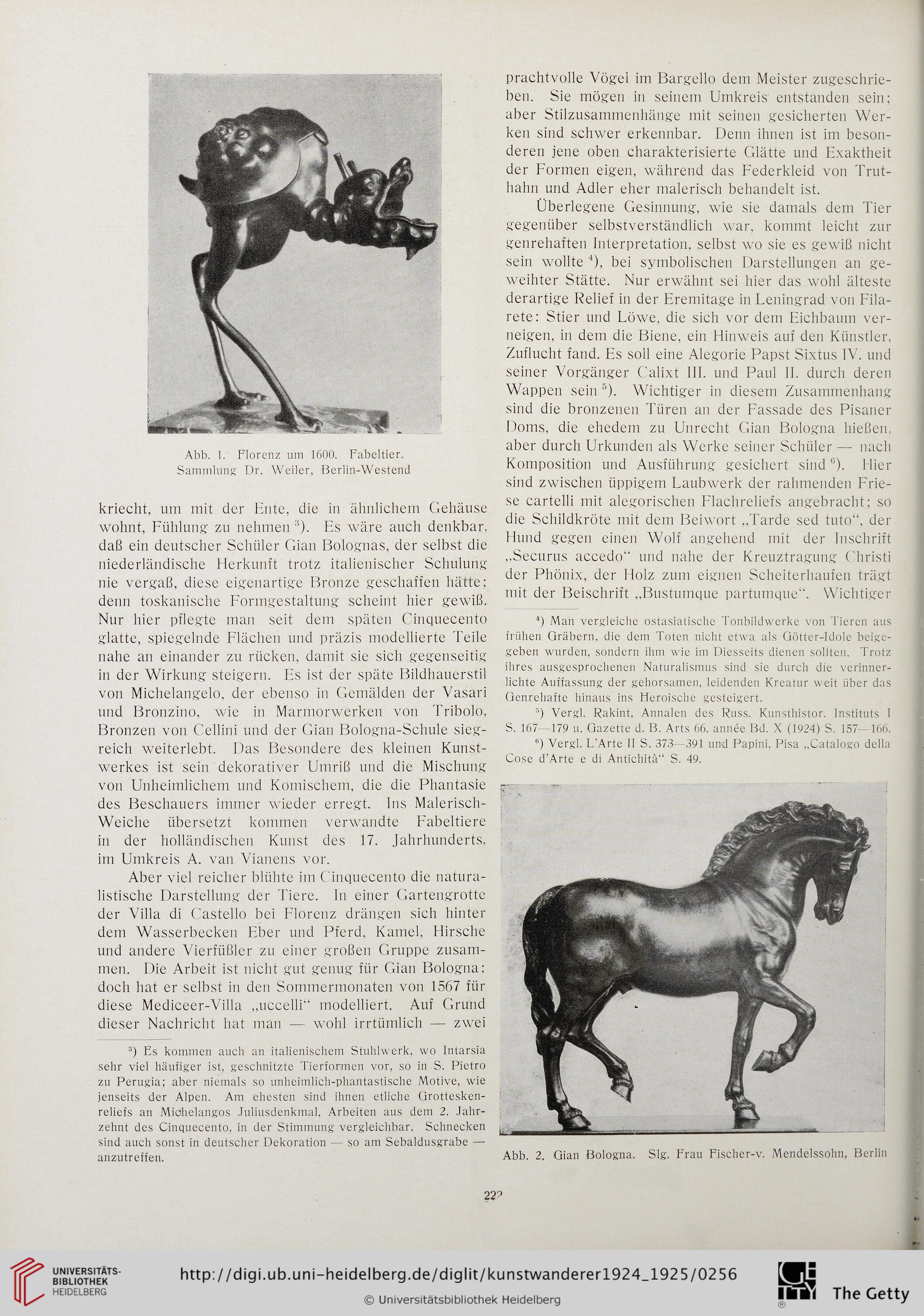Abb. 1. Florenz um 1600. Fabeltier.
Sammlung Dr. Weiler, Beriin-Westend
kriecht, um mit der Ente, die in ähnlichem Gehäuse
wohnt, Fihlung zu nehmen :{). Es wäre auch denkbar,
daß ein deutscher Schüler Gian Bolognas, der selbst die
niederländische Herkunft trotz italienischer Schulung
nie vergaß, diese eigenartige Bronze geschaffen hätte;
denn toskanische Formgestaltung scheint hier gewiß.
Nur hier pflegte man seit dem späten Cinquecento
glatte, spiegelnde Flächen und präzis modellierte Teile
nahe an einander zu rücken, damit sie sich gegenseitig
in der Wirkung steigern. Es ist der späte Bildhauerstil
von Michelangelo, der ebenso in Gemälden der Vasari
und Bronzino, wie in Marmorwerken von Tribolo,
Bronzen von Cellini und der Gian Bologna-Schule sieg-
reich weiterlebt. Das Besondere des kleinen Kunst-
werkes ist sein dekorativer Umriß und die Mischung
von Unheimlichem und Komischem, die die Phantasie
des Beschauers immer wieder erregt. Ins Malerisch-
Weiche übersetzt kommen verwandte Fabeltiere
in der holländischen Kunst des 17. Jahrhunderts,
im Umkreis A. van Vianens vor.
Aber viel reicher bliihte im Cinquecento die natura-
listische Darstellung der Tiere. In einer Gartengrotte
der Villa di Castello bei Florenz drängen sich hinter
dem Wasserbecken Eber und Pferd, Kamel, Hirsche
und andere Vierfüßler zu einer großen Gruppe zusam-
men. Die Arbeit ist nicht gut genug für Gian Bologna;
doch hat er selbst in den Sommermonaten von 1567 für
diese Mediceer-Villa ,,uccelli‘‘ modelliert. Auf Grund
dieser Nachricht hat man — wohl irrtümlich — zwei
3) Es kommen auch an italienischem Stnhlwerk, wo Intarsia
sehr viel häufiger ist, geschnitzte Tierformen vor, so in S. Pietro
zu Perugia; aber niemals so unheimlich-phantastische Motive, wie
jenseits der Alpen. Am ehesten sind ihnen etliche Grottesken-
reliefs an Midhelangos Juliusdenkmal, Arbeiten aus dem 2. Jahr-
zehnt des Cinquecento, in der Stimmung vergleichbar. Schnecken
sind auch sonst in deutscher Dekoration — so am Sebaldusgrabe —
anzutreffen.
prachtvolle Vögel im Bargello dem Meister zugeschrie-
ben. Sie mögen in seinern Umkreis entstanden sein;
aber Stilzusammenhänge mit seinen gesicherten Wer-
ken sind schwer erkennbar. Denn ihnen ist im beson-
deren jene oben charakterisierte Glätte und Exaktheit
der Formen eigen, während das Federkleid von Trut-
hahn und Adler eher malerisch behandelt ist.
Überlegene Gesinnung, wie sie damals dem Tier
gegenüber selbstverständlich war, kommt leicht zur
genrehaften Interpretation, selbst wo sie es gewiß nicht
sein wollte 3 4 *), bei symbolischen Darstellungen an ge-
weihter Stätte. Nur erwähnt sei hier das wohl älteste
derartige Relief in der Eremitage in Leningrad von Fila-
rete: Stier und Löwe, die sich vor dem Eichbauin ver-
neigen, in dem die Biene, ein Hinweis auf den Künstler,
Zuflucht fand. Es soll eine Alegorie Papst Sixtus IV. und
seiner Vorgänger Calixt III. und Paul II. durch deren
Wappen sein °). Wichtiger in diesem Zusammenhang
sind die bronzenen Türen an der Fassade des Pisaner
Doms, die ehedem zu Unrecht Gian Bologna hießen,
aber durch Urkunden als Werke seiner Schüler — nach
Komposition und Ausführung gesichert sind6). Hier
sind zwischen üppigem Laubwerk der rahmenden Frie-
se cartelli mit alegorischen Flachreliefs angebracht; so
die Schildkröte mit dem Beiwort ,,Tarde sed tuto“, der
Hund gegen einen Wolf angehend mit der Inschrift
,,Securus accedo“ und nahe der Kreuztragung Christi
der Phönix, der Holz zum eignen Scheiterhaufen trägt
mit der Beischrift ,,Bustumque partumque“. Wichtiger
4) Man vergleiche ostasiatische Tonbildwerke von Tieren aus
friihen Gräbern, die dem Toten nicht etwa als Götter-Idole bcige-
geben wurden, sondern ihm wie im Diesseits dienen soliten. Trotz
ihres ausgesprochenen Naturalismus sind sie durch die verinner-
iichte Auffassung der gehorsamen, leidenden Kreatur weit über das
Genrehafte hinaus ins Heroische gesteigert.
5) Vergi. Rakint, Annalen des Russ. Kunsthistor. Instituts I
S. 167—179 u. Gazette d. B. Arts 66. annee Bd. X (1924) S. 157—166.
fi) Vergl. L'Arte II S. 373—391 und Papini, Pisa „Catalogo della
Cose d’Arte e di Antichitä“ S. 49.
Abb. 2. Gian Bologna. Slg. Frau Fischer-v. Mendelssohn, Berlin
2V