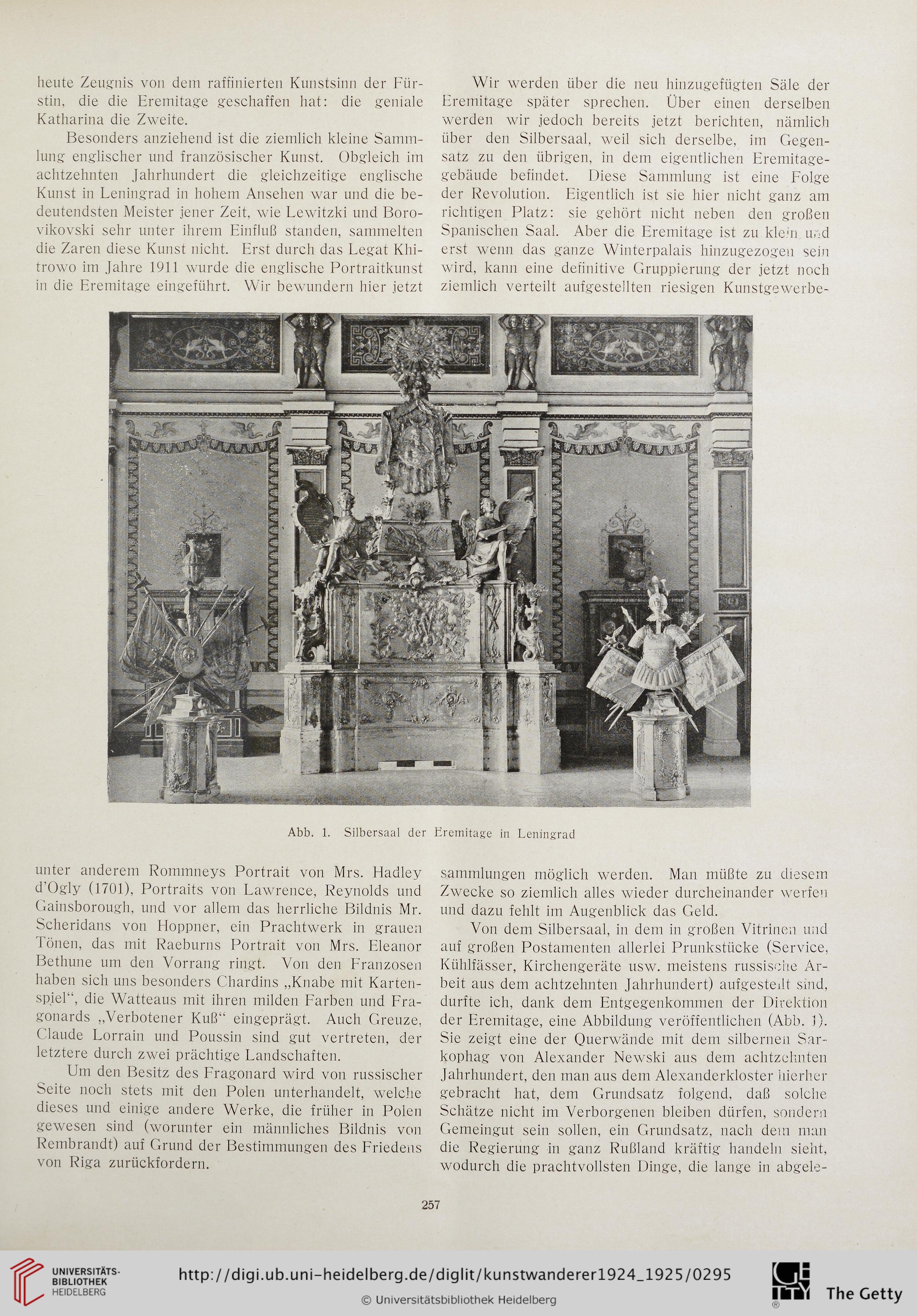Donath, Adolph [Editor]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 6./7.1924/25
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.25879#0295
DOI issue:
1./2. Januarheft
DOI issue:1./2. Aprilheft
DOI article:Martin, Wilhelm: Russische Kunstschätze, [2]
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.25879#0295
heute Zeugnis von dem raffinierten Kunstsinn der Für-
stin, die die Eremitage geschaffen hat: die geniale
Katharina die Zweite.
Besonders anziehend ist die ziemlich kleine Samm-
lung englischer und französischer Kunst. Obgleich im
achtzehnten Jahrhundert die gjeichzeitige englische
Kunst in Leningrad in hohem Ansehen war und die be-
deutendsten Meister jener Zeit, wie Lewitzki und Boro-
vikovski sehr unter ihrem Einfiuß standeu, sammelten
die Zaren diese Kunst nicht. Erst durch das Legat Khi-
trowo im Jahre 1911 wurde die englische Portraitkunst
in die Eremitage eingeführt. Wir bewundern hier jetzt
Wir werden über die neu hinzugefügten Säle der
Eremitage später sprechen. Über einen derselben
werden wir jedoch bereits jetzt berichten, nämlich
über den Silbersaal, weil sich derselbe, im Gegen-
satz zu den übrigen, in dem eigentlichen Eremitage-
gebäude befindet. Diese Sammlung ist eine Folge
der Revolution. Eigentlich ist sie hier nicht ganz am
richtigen Platz: sie gehört nicht neben den großen
Spanischen Saal. Aber die Eremitage ist zu klein und
erst wenn das ganze Winterpalais hinzugezogeu sein
wird, kann eine definitive Gruppierung der jetzt noch
ziemlich verteilt aufgestellten riesigen Kunstgewerbe-
Abb. 1. Silbersaal der Eremitage in Leningrad
unter anderem Rommneys Portrait von Mrs. Hadley
d’Ogly (1701), Portraits von Lawrence, Reynolds und
Gainsborough, und vor allem das herrliche Bildnis Mr.
Scheridans von Hoppner, ein Prachtwerk in grauen
Fönen, das mit Raeburns Portrait von Mrs. Eleanor
Bethune um den Vorrang ringt. Von den Franzosen
haben sich uns besonders Chardins „Knabe mit Karten-
spiel“, die Watteaus mit ihren milden Farben und Fra-
gonards „Verbotener Kuß“ eingeprägt. Auch Greuze,
Claude Lorrain und Poussin sind gut vertreten, der
letztere durch zwei prächtige Landschaften.
Um den Besitz des Fragonard wird von russischer
Seite noch stets mit den Polen unterhandelt, welche
dieses und einige andere Werke, die früher in Polen
gewesen sind (worunter ein männliches Bildnis von
Rembrandt) auf Grund der Bestimmungen des Friedens
von Riga zurückfordern.
sainmlungen möglich werden. Man müßte zu diesem
Zwecke so ziemlich alles wieder durcheinander werfen
und dazu fehlt im Augenblick das Geld.
Von dem Silbersaal, in dem in großen Vitrinen und
auf großen Postamenten allerlei Prunkstücke (Service,
Kühlfässer, Kirchengeräte usw. meistens russisohe Ar-
beit aus dem achtzehnten Jahrhundert) aufgesteüt sind,
durfte ich, dank dem Entgegenkommen der Direktion
der Eremitage, eine Abbildung veröffentlichen (Abb. 1).
Sie zeigt eine der Querwände mit dem silbernen Sar-
kophag von Alexander Newski aus dem achtzehnten
Jahrliundert, den man aus dem Alexanderkloster hierher
gebracht hat, dem Grundsatz folgend, daß solche
Schätze nicht im Verborgenen bleiben dürfen, sondern
Gemeingut sein sollen, ein Grundsatz, nach dem man
die Regierung in ganz Rußland kräftig handeln sieht,
wodurch die prachtvollsten Dinge, die lange in abgele-
257
stin, die die Eremitage geschaffen hat: die geniale
Katharina die Zweite.
Besonders anziehend ist die ziemlich kleine Samm-
lung englischer und französischer Kunst. Obgleich im
achtzehnten Jahrhundert die gjeichzeitige englische
Kunst in Leningrad in hohem Ansehen war und die be-
deutendsten Meister jener Zeit, wie Lewitzki und Boro-
vikovski sehr unter ihrem Einfiuß standeu, sammelten
die Zaren diese Kunst nicht. Erst durch das Legat Khi-
trowo im Jahre 1911 wurde die englische Portraitkunst
in die Eremitage eingeführt. Wir bewundern hier jetzt
Wir werden über die neu hinzugefügten Säle der
Eremitage später sprechen. Über einen derselben
werden wir jedoch bereits jetzt berichten, nämlich
über den Silbersaal, weil sich derselbe, im Gegen-
satz zu den übrigen, in dem eigentlichen Eremitage-
gebäude befindet. Diese Sammlung ist eine Folge
der Revolution. Eigentlich ist sie hier nicht ganz am
richtigen Platz: sie gehört nicht neben den großen
Spanischen Saal. Aber die Eremitage ist zu klein und
erst wenn das ganze Winterpalais hinzugezogeu sein
wird, kann eine definitive Gruppierung der jetzt noch
ziemlich verteilt aufgestellten riesigen Kunstgewerbe-
Abb. 1. Silbersaal der Eremitage in Leningrad
unter anderem Rommneys Portrait von Mrs. Hadley
d’Ogly (1701), Portraits von Lawrence, Reynolds und
Gainsborough, und vor allem das herrliche Bildnis Mr.
Scheridans von Hoppner, ein Prachtwerk in grauen
Fönen, das mit Raeburns Portrait von Mrs. Eleanor
Bethune um den Vorrang ringt. Von den Franzosen
haben sich uns besonders Chardins „Knabe mit Karten-
spiel“, die Watteaus mit ihren milden Farben und Fra-
gonards „Verbotener Kuß“ eingeprägt. Auch Greuze,
Claude Lorrain und Poussin sind gut vertreten, der
letztere durch zwei prächtige Landschaften.
Um den Besitz des Fragonard wird von russischer
Seite noch stets mit den Polen unterhandelt, welche
dieses und einige andere Werke, die früher in Polen
gewesen sind (worunter ein männliches Bildnis von
Rembrandt) auf Grund der Bestimmungen des Friedens
von Riga zurückfordern.
sainmlungen möglich werden. Man müßte zu diesem
Zwecke so ziemlich alles wieder durcheinander werfen
und dazu fehlt im Augenblick das Geld.
Von dem Silbersaal, in dem in großen Vitrinen und
auf großen Postamenten allerlei Prunkstücke (Service,
Kühlfässer, Kirchengeräte usw. meistens russisohe Ar-
beit aus dem achtzehnten Jahrhundert) aufgesteüt sind,
durfte ich, dank dem Entgegenkommen der Direktion
der Eremitage, eine Abbildung veröffentlichen (Abb. 1).
Sie zeigt eine der Querwände mit dem silbernen Sar-
kophag von Alexander Newski aus dem achtzehnten
Jahrliundert, den man aus dem Alexanderkloster hierher
gebracht hat, dem Grundsatz folgend, daß solche
Schätze nicht im Verborgenen bleiben dürfen, sondern
Gemeingut sein sollen, ein Grundsatz, nach dem man
die Regierung in ganz Rußland kräftig handeln sieht,
wodurch die prachtvollsten Dinge, die lange in abgele-
257