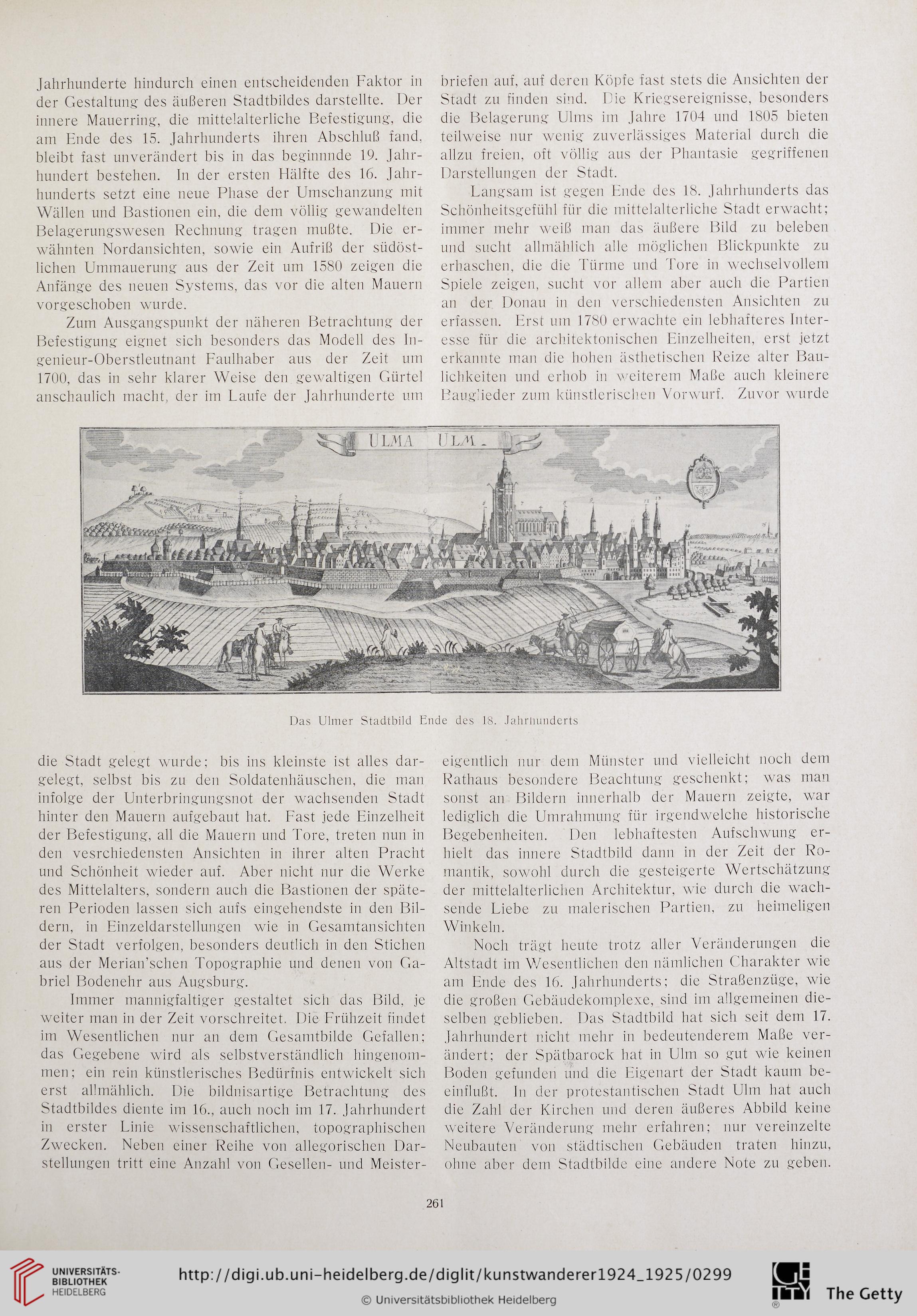Jahrhunderte hindurch einen entscheidenden Faktor in
der Gestaltung des äußeren Stadtbildes darstellte. Der
innere Mauerring, die mittelalterliche Befestigung, die
am Ende des 15. Jahrhunderts ihren Abschluß fand,
bleibt fast unverändert bis in das beginnnde 19. Jahr-
hundert bestehen. In der ersten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts setzt eine neue Pliase der Umschanzung mit
Wällen und Bastionen ein, die dem völlig gewandelten
Belagerungswesen Rechnung tragen mußte. Die er-
wähnten Nordansichten, sowie ein Aufriß der stidöst-
lichen Ummauerung aus der Zeit um 1580 zeigen die
Anfänge des neuen Systems, das vor die alten Mauern
vorgeschoben wurde.
Zum Ausgangspunkt der näheren Betrachtung der
Befestigung eignet sich besonders das Modell des In-
genieur-Oberstleutnant Faulhaber aus der Zeit um
1700, das in sehr klarer Weise den gewaltigen Gürtel
anschaulich macht, der iin Laufe der Jahrhunderte u.m
briefen auf, auf deren Köpfe fast stets die Ansichten der
Stadt zu finden sind. Die Kriegsereignisse, besonders
die Belagerung Ulms im Jahre 1704 und 1805 bieten
teilweise nur wenig zuverlässiges Material durch die
allzu freien, oft völlig aus der Phantasie gegriffenen
Darstellungen der Stadt.
Langsam ist gegen Lnde des 18. Jahrhunderts das
Schönheitsgefühl für die mittelalterliche Stadt erwacht;
immer mehr weiß man das äußere Bild zu beleben
und sucht allmählich alle möglichen Blickpunkte zu
erhaschen, die die Türme und Tore in wechselvollem
Spiele zeigen, sucht vor allem aber aucli die Partien
an der Donau in den verschiedensten Ansichten zu
erfassen. Erst um 1780 erwachte ein lebhafteres Inter-
esse ftir die architektonischen Einzelheiten, erst jetzt
erkannte man die hohen ästlietischen Reize alter Bau-
lichkeiten und erhob in weiterem Maße auch kleinere
Bauglieder zum künstlerischen Vorwurf. Zuvor wurde
Das Ulmer Stadtbild Ende des 18. Jahrliundcrts
die Stadt gelegt wurde; bis ins kleinste ist alles dar-
gelegt, selbst bis zu den Soldatenhäuschen, die man
infolge der Unterbringungsnot der wachsenden Stadt
hinter den Mauern aufgebaut hat. Fast jede Linzelheit
der Befestigung, all die Mauern und Tore, treten nun in
den vesrchiedensten Ansichten in ihrer alten Pracnt
und Schönheit wieder auf. Aber nicht nur die Werke
des Mittelalters, sondern auch die Bastionen der späte-
ren Perioden lassen sicli aufs eingehendste in den Bil-
dern, in Einzeldarstellungen wie in Gesamtansichten
der Stadt verfolgen, besonders deutlich in den Stichen
aus der Merian’schen Topographie und denen von Ga-
briel Bodenehr aus Augsburg.
Immer mannigfaltiger gestaltet sich das Bild. je
weiter man in der Zeit vorschreitet. Die Frühzeit findet
im Wesentlichen nur an dem Gesamtbilde Gefallen;
das Gegebene wird als selbstverständlich hingenom-
men; ein rein künstlerisches Bedürfnis entwickelt sich
erst allmählich. Die bildnisartige Betrachtung des
Stadtbildes diente im 16., auch noch im 17. Jahrhundert
in erster Linie wissenschaftlichen, topographischen
Zwecken. Neben einer Reihe von allegorischen Dar-
stellungen tritt eine Anzahl von Gesellen- und Meister-
eigentlich nur dem Münster und vielleicht noch dem
Rathaus besondere Beachtung geschenkt; was man
sonst an Bildern innerhalb der Mauern zeigte, war
lediglich die Umrahmung für irgendwelche historische
Begebenheiten. Den lebhaftesten Aufschwung er-
hielt das innere Stadtbild dann in der Zeit der Ro-
mantik, sowohl durcli die gesteigerte Wertschätzung
der mittelalterlichen Architektur, wie durch die wach-
sende Liebe zu malerischen Partien, zu heimeligen
Winkeln.
Noch trägt lieute trotz aller Veränderungen die
Altstadt im Wesentlichen den nämlichen Charakter wie
am Ende des 16. Jahrhunderts; die Straßenzüge, wie
die großen Gebäudekomplexe, sind im allgemeinen die-
selben geblicben. Das Stadtbild hat sich seit dem 17.
Jahrhundert nicht mehr in bedeutenderem Maße ver-
ändert; der Spätbarock hat in Ulm so gut wie keinen
Boden gefunden und die Eigenart der Stadt kaum be-
einflußt. In der protestantischen Stadt Ulm hat aucli
die Zahl der Kirchen und deren äußeres Abbild keine
weitere Veränderung mehr erfahren; nur vereinzelte
Neubauten von städtischen Gebäuden traten hinzu,
ohne aber dem Stadtbilde eine andere Note zu geben.
261
der Gestaltung des äußeren Stadtbildes darstellte. Der
innere Mauerring, die mittelalterliche Befestigung, die
am Ende des 15. Jahrhunderts ihren Abschluß fand,
bleibt fast unverändert bis in das beginnnde 19. Jahr-
hundert bestehen. In der ersten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts setzt eine neue Pliase der Umschanzung mit
Wällen und Bastionen ein, die dem völlig gewandelten
Belagerungswesen Rechnung tragen mußte. Die er-
wähnten Nordansichten, sowie ein Aufriß der stidöst-
lichen Ummauerung aus der Zeit um 1580 zeigen die
Anfänge des neuen Systems, das vor die alten Mauern
vorgeschoben wurde.
Zum Ausgangspunkt der näheren Betrachtung der
Befestigung eignet sich besonders das Modell des In-
genieur-Oberstleutnant Faulhaber aus der Zeit um
1700, das in sehr klarer Weise den gewaltigen Gürtel
anschaulich macht, der iin Laufe der Jahrhunderte u.m
briefen auf, auf deren Köpfe fast stets die Ansichten der
Stadt zu finden sind. Die Kriegsereignisse, besonders
die Belagerung Ulms im Jahre 1704 und 1805 bieten
teilweise nur wenig zuverlässiges Material durch die
allzu freien, oft völlig aus der Phantasie gegriffenen
Darstellungen der Stadt.
Langsam ist gegen Lnde des 18. Jahrhunderts das
Schönheitsgefühl für die mittelalterliche Stadt erwacht;
immer mehr weiß man das äußere Bild zu beleben
und sucht allmählich alle möglichen Blickpunkte zu
erhaschen, die die Türme und Tore in wechselvollem
Spiele zeigen, sucht vor allem aber aucli die Partien
an der Donau in den verschiedensten Ansichten zu
erfassen. Erst um 1780 erwachte ein lebhafteres Inter-
esse ftir die architektonischen Einzelheiten, erst jetzt
erkannte man die hohen ästlietischen Reize alter Bau-
lichkeiten und erhob in weiterem Maße auch kleinere
Bauglieder zum künstlerischen Vorwurf. Zuvor wurde
Das Ulmer Stadtbild Ende des 18. Jahrliundcrts
die Stadt gelegt wurde; bis ins kleinste ist alles dar-
gelegt, selbst bis zu den Soldatenhäuschen, die man
infolge der Unterbringungsnot der wachsenden Stadt
hinter den Mauern aufgebaut hat. Fast jede Linzelheit
der Befestigung, all die Mauern und Tore, treten nun in
den vesrchiedensten Ansichten in ihrer alten Pracnt
und Schönheit wieder auf. Aber nicht nur die Werke
des Mittelalters, sondern auch die Bastionen der späte-
ren Perioden lassen sicli aufs eingehendste in den Bil-
dern, in Einzeldarstellungen wie in Gesamtansichten
der Stadt verfolgen, besonders deutlich in den Stichen
aus der Merian’schen Topographie und denen von Ga-
briel Bodenehr aus Augsburg.
Immer mannigfaltiger gestaltet sich das Bild. je
weiter man in der Zeit vorschreitet. Die Frühzeit findet
im Wesentlichen nur an dem Gesamtbilde Gefallen;
das Gegebene wird als selbstverständlich hingenom-
men; ein rein künstlerisches Bedürfnis entwickelt sich
erst allmählich. Die bildnisartige Betrachtung des
Stadtbildes diente im 16., auch noch im 17. Jahrhundert
in erster Linie wissenschaftlichen, topographischen
Zwecken. Neben einer Reihe von allegorischen Dar-
stellungen tritt eine Anzahl von Gesellen- und Meister-
eigentlich nur dem Münster und vielleicht noch dem
Rathaus besondere Beachtung geschenkt; was man
sonst an Bildern innerhalb der Mauern zeigte, war
lediglich die Umrahmung für irgendwelche historische
Begebenheiten. Den lebhaftesten Aufschwung er-
hielt das innere Stadtbild dann in der Zeit der Ro-
mantik, sowohl durcli die gesteigerte Wertschätzung
der mittelalterlichen Architektur, wie durch die wach-
sende Liebe zu malerischen Partien, zu heimeligen
Winkeln.
Noch trägt lieute trotz aller Veränderungen die
Altstadt im Wesentlichen den nämlichen Charakter wie
am Ende des 16. Jahrhunderts; die Straßenzüge, wie
die großen Gebäudekomplexe, sind im allgemeinen die-
selben geblicben. Das Stadtbild hat sich seit dem 17.
Jahrhundert nicht mehr in bedeutenderem Maße ver-
ändert; der Spätbarock hat in Ulm so gut wie keinen
Boden gefunden und die Eigenart der Stadt kaum be-
einflußt. In der protestantischen Stadt Ulm hat aucli
die Zahl der Kirchen und deren äußeres Abbild keine
weitere Veränderung mehr erfahren; nur vereinzelte
Neubauten von städtischen Gebäuden traten hinzu,
ohne aber dem Stadtbilde eine andere Note zu geben.
261