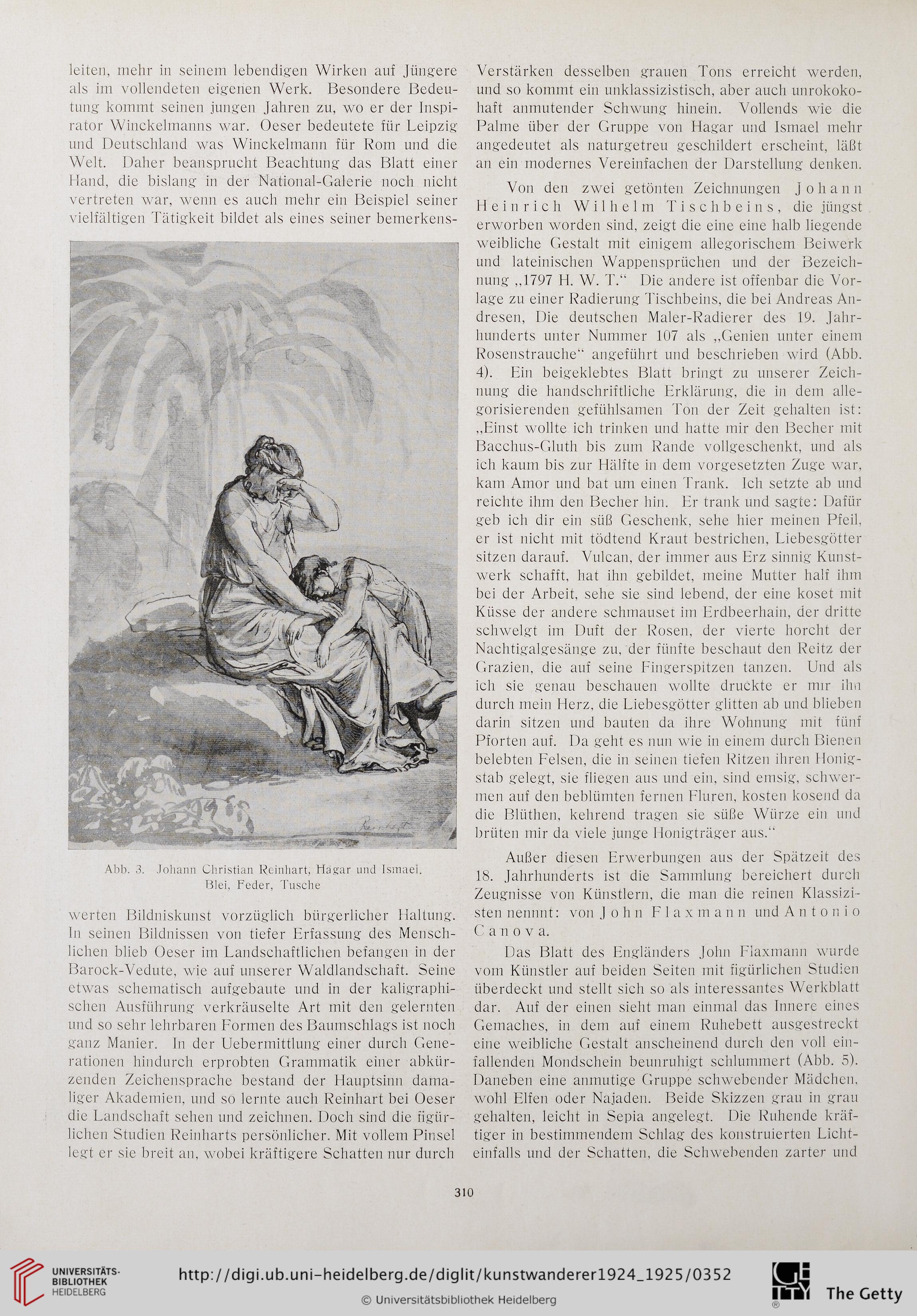leiten, mehr in seinem lebendigen Wirken auf Jüngere
als im vollendeten eigenen Werk. Besondere Bedeu-
tung kommt seinen jungen Jahren zu, wo er der Inspi-
rator Winckelmanns war. Oeser bedeutete für Leipzig
und Deutschland was Winckelmann für Rom und die
Welt. Daher beansprucht Beachtung das Blatt einer
Hand, die bislang: in der National-Galerie noch nicht
vertreten war, wenn es auch mehr ein Beispiel seiner
vielfältigen Tätigkeit bildet als eines seiner bemerkens-
r
Abb. 3. Johann Christian Reinhart, liägar und Ismaei.
Blei, Feder, Tusche
werten Bildniskunst vorzüglich bürgerlicher Halturig.
In seinen Bildnissen von tiefer Erfassung des Mensch-
lichen blieb Oeser im Landsehaftlichen befangen in der
Barock-Vedute, wie auf unserer Waldlandschaft. Seine
etwas schematisch aufgebaute und in der kaligraphi-
schen Ausführung verkräuselte Art mit den gelernten
und so sehr lehrbaren Formen des Baumschlags ist noch
ganz Manier. In der Uebermittlung einer durch Gene-
rationen hindurch erprobten Grammatik einer abkür-
zenden Zeichensprache bestand der Hauptsinn dama-
liger Akademien, und so lernte auch Reinhart bei Oeser
die Landschaft sehen und zeichnen. Doch sind die figiir-
lichen Studien Reinharts persönlicher. Mit vollem Pinsel
legt er sie breit an, wobei kräftigere Schatten nur durch
Verstärken desselben grauen Tons erreicht werden,
und so kommt ein unklassizistisch, aber aucli unrokoko-
haft anmutender Schwung hinein. Vollends wie die
Palme über der Gruppe von Hagar und Ismael mehr
angedeutet als naturgetreu geschildert erscheint, läßt
an ein modernes Vereinfachen der Darstellung denken.
Von den zwei getönten Zeichnungen Johann
H e i n r i c h W i 1 h e 1 m T i s c h b e i n s , die jüngst
erworben worden sind, zeigt die eine eine halb liegende
weibliche Gestalt mit einigem allegorischem Beiwerk
und lateinischen Wappensprüchen und der Bezeich-
nung ,,1797 H. W. T.“ Die andere ist offenbar die Vor-
lage zu einer Radierung Tischbeins, die bei Andreas An-
dresen, Die deutschen Maler-Radierer des 19. Jahr-
hunderts unter Nummer 107 als „Genien unter einem
Rosenstrauche“ angeführt und beschrieben wird (Abb.
4). Ein beigeklebtes Blatt bringt zu unserer Zeich-
nung die handschriftliche Erklärung, die in dem alle-
gorisierenden gefühlsamen Ton der Zeit gehalten ist:
„Einst wollte ich trinken und hatte mir den Becher mit
Bacchus-Gluth bis zum Rande vollgeschenkt, und als
ich kaum bis zur Hälfte in dem vorgesetzten Zuge war,
kam Amor und bat um einen Trank. lch setzte ab und
reichte ihm den Becher hin. Er trank und sagte: Dafür
geb ich dir ein süß Geschenk, sehe liier meinen Pfeil,
er ist nicht mit tödtend Kraut bestrichen, Liebesgötter
sitzen darauf. Vulcan, der immer aus Erz sinnig Kunst-
werk schafft, hat ihn gebildet, meine Mutter half ihm
bei der Arbeit, sehe sie sind lebend, der eine koset mit
Küsse der andere schmauset im Erdbeerhain, der dritte
schwelgt im Duft der Rosen, der viertc horcht der
Nachtigalgesänge zu, der fünfte beschaut den Reitz der
Grazien, die auf seine Fingerspitzen tanzen. Und als
ich sie genau beschauen wollte druckte er mir ihn
durch mein Herz, die Liebesgötter glitten ab und blieben
darin sitzen und bauten da ihre Wohnung mit fünf
Pforten auf. Da geht es nun wie in einem durch Bienen
belebten Felsen, die in seinen tiefen Ritzen ihren Honig-
stab gelegt, sie fliegen aus und ein, sind emsig, schwer-
men auf den beblümten fernen Fluren, kosten kosend da
die Blüthen, kehrend tragen sie süße Wiirze ein und
brüten mir da viele junge Honigträger aus.“
Außer diesen Erwerbungen aus der Spätzeit des
18. Jahrhunderts ist die Sammlung bereichert durch
Zeugnisse von Künstlern, die man die reinen Klassizi-
sten nennnt: von J o h n F 1 a x m a n n und A n t o n i o
C a n o v a.
Das Blatt des Engländers John Fiaxmann wurde
vom Künstler auf beiden Seiten mit figürlichen Studien
überdeckt und stellt sich so als interessantes Werkblatt
dar. Auf der einen sieht man einmal das Innere eines
Gemaches, in dem auf einem Ruhebett ausgestreckt
eine weibliche Gestalt anscheinend durch den voll ein-
fallenden Mondschein beunruhigt schlummert (Abb. 5).
Daneben eine anmutige Gruppe schwebender Mädehen.
wohl Elfen oder Najaden. Beide Skizzen grau in grau
gehalten, leiclit in Sepia angelegt. Die Ruhende kräf-
tiger in bestimmendem Schlag des konstruierten Licht-
einfais und der Schatten, die Schwebenden zarter und
310
als im vollendeten eigenen Werk. Besondere Bedeu-
tung kommt seinen jungen Jahren zu, wo er der Inspi-
rator Winckelmanns war. Oeser bedeutete für Leipzig
und Deutschland was Winckelmann für Rom und die
Welt. Daher beansprucht Beachtung das Blatt einer
Hand, die bislang: in der National-Galerie noch nicht
vertreten war, wenn es auch mehr ein Beispiel seiner
vielfältigen Tätigkeit bildet als eines seiner bemerkens-
r
Abb. 3. Johann Christian Reinhart, liägar und Ismaei.
Blei, Feder, Tusche
werten Bildniskunst vorzüglich bürgerlicher Halturig.
In seinen Bildnissen von tiefer Erfassung des Mensch-
lichen blieb Oeser im Landsehaftlichen befangen in der
Barock-Vedute, wie auf unserer Waldlandschaft. Seine
etwas schematisch aufgebaute und in der kaligraphi-
schen Ausführung verkräuselte Art mit den gelernten
und so sehr lehrbaren Formen des Baumschlags ist noch
ganz Manier. In der Uebermittlung einer durch Gene-
rationen hindurch erprobten Grammatik einer abkür-
zenden Zeichensprache bestand der Hauptsinn dama-
liger Akademien, und so lernte auch Reinhart bei Oeser
die Landschaft sehen und zeichnen. Doch sind die figiir-
lichen Studien Reinharts persönlicher. Mit vollem Pinsel
legt er sie breit an, wobei kräftigere Schatten nur durch
Verstärken desselben grauen Tons erreicht werden,
und so kommt ein unklassizistisch, aber aucli unrokoko-
haft anmutender Schwung hinein. Vollends wie die
Palme über der Gruppe von Hagar und Ismael mehr
angedeutet als naturgetreu geschildert erscheint, läßt
an ein modernes Vereinfachen der Darstellung denken.
Von den zwei getönten Zeichnungen Johann
H e i n r i c h W i 1 h e 1 m T i s c h b e i n s , die jüngst
erworben worden sind, zeigt die eine eine halb liegende
weibliche Gestalt mit einigem allegorischem Beiwerk
und lateinischen Wappensprüchen und der Bezeich-
nung ,,1797 H. W. T.“ Die andere ist offenbar die Vor-
lage zu einer Radierung Tischbeins, die bei Andreas An-
dresen, Die deutschen Maler-Radierer des 19. Jahr-
hunderts unter Nummer 107 als „Genien unter einem
Rosenstrauche“ angeführt und beschrieben wird (Abb.
4). Ein beigeklebtes Blatt bringt zu unserer Zeich-
nung die handschriftliche Erklärung, die in dem alle-
gorisierenden gefühlsamen Ton der Zeit gehalten ist:
„Einst wollte ich trinken und hatte mir den Becher mit
Bacchus-Gluth bis zum Rande vollgeschenkt, und als
ich kaum bis zur Hälfte in dem vorgesetzten Zuge war,
kam Amor und bat um einen Trank. lch setzte ab und
reichte ihm den Becher hin. Er trank und sagte: Dafür
geb ich dir ein süß Geschenk, sehe liier meinen Pfeil,
er ist nicht mit tödtend Kraut bestrichen, Liebesgötter
sitzen darauf. Vulcan, der immer aus Erz sinnig Kunst-
werk schafft, hat ihn gebildet, meine Mutter half ihm
bei der Arbeit, sehe sie sind lebend, der eine koset mit
Küsse der andere schmauset im Erdbeerhain, der dritte
schwelgt im Duft der Rosen, der viertc horcht der
Nachtigalgesänge zu, der fünfte beschaut den Reitz der
Grazien, die auf seine Fingerspitzen tanzen. Und als
ich sie genau beschauen wollte druckte er mir ihn
durch mein Herz, die Liebesgötter glitten ab und blieben
darin sitzen und bauten da ihre Wohnung mit fünf
Pforten auf. Da geht es nun wie in einem durch Bienen
belebten Felsen, die in seinen tiefen Ritzen ihren Honig-
stab gelegt, sie fliegen aus und ein, sind emsig, schwer-
men auf den beblümten fernen Fluren, kosten kosend da
die Blüthen, kehrend tragen sie süße Wiirze ein und
brüten mir da viele junge Honigträger aus.“
Außer diesen Erwerbungen aus der Spätzeit des
18. Jahrhunderts ist die Sammlung bereichert durch
Zeugnisse von Künstlern, die man die reinen Klassizi-
sten nennnt: von J o h n F 1 a x m a n n und A n t o n i o
C a n o v a.
Das Blatt des Engländers John Fiaxmann wurde
vom Künstler auf beiden Seiten mit figürlichen Studien
überdeckt und stellt sich so als interessantes Werkblatt
dar. Auf der einen sieht man einmal das Innere eines
Gemaches, in dem auf einem Ruhebett ausgestreckt
eine weibliche Gestalt anscheinend durch den voll ein-
fallenden Mondschein beunruhigt schlummert (Abb. 5).
Daneben eine anmutige Gruppe schwebender Mädehen.
wohl Elfen oder Najaden. Beide Skizzen grau in grau
gehalten, leiclit in Sepia angelegt. Die Ruhende kräf-
tiger in bestimmendem Schlag des konstruierten Licht-
einfais und der Schatten, die Schwebenden zarter und
310