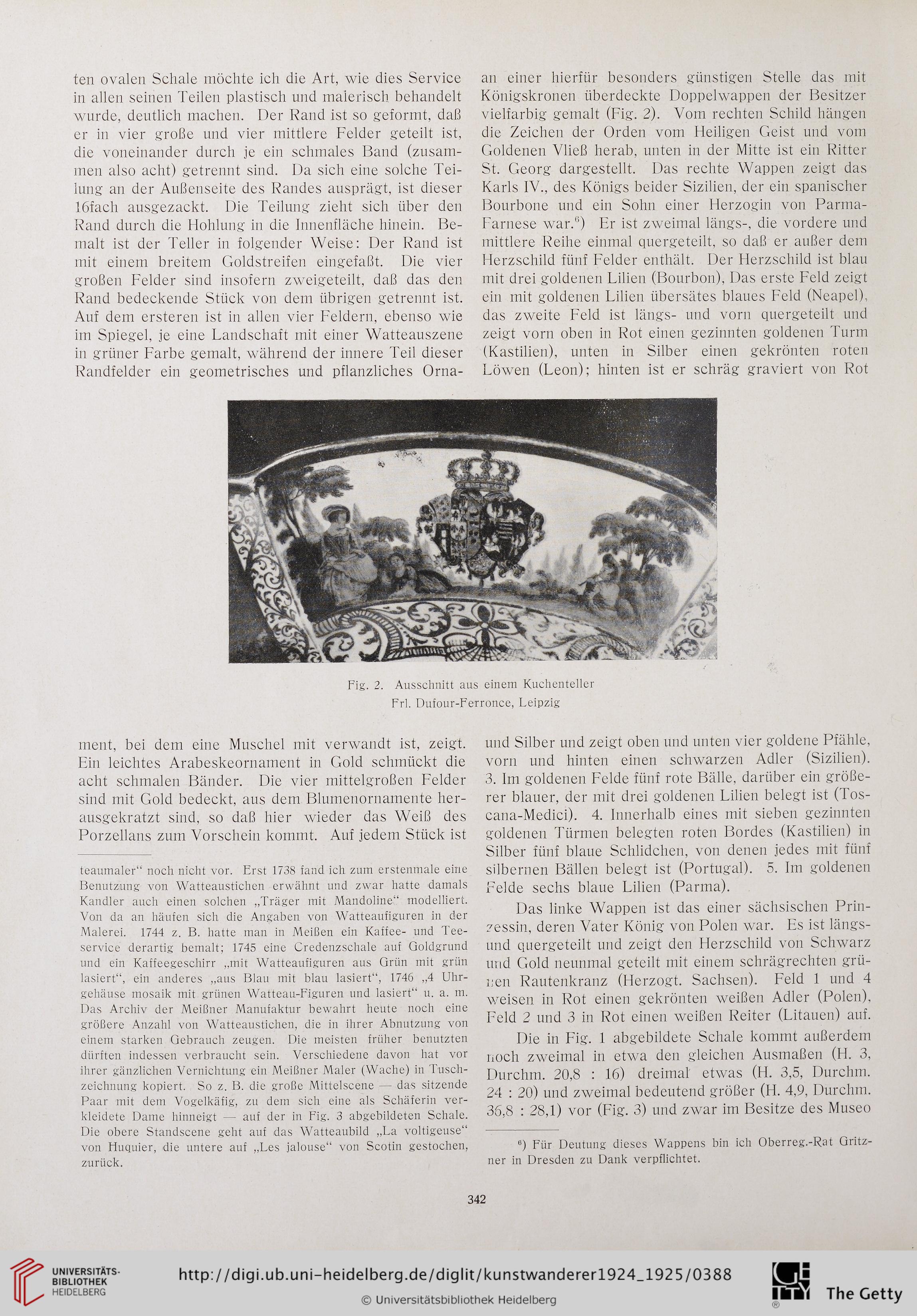ten ovalen Schale möchte ich die Art, wie dies Service
in allen seinen Teilen plastisch und maierisch behandelt
wurde, deutlich machen. Der Rand ist so geformt, daß
er in vier große und vier mittlere Felder geteilt ist,
die voneinander durch je ein schmales Band (zusam-
men also acht) getrennt sind. Da sich eine solche Tei-
lung an der Außenseite des Randes ausprägt, ist dieser
löfach ausgezackt. Die Teilung zieht sich über den
Rand durch die Hohlung; in die Innenfläche hinein. Be-
malt ist der Teller in folgender Weise: Der Rand ist
mit einem breitem Goldstreifen eingefaßt. Die vier
großen Felder sind insofern zweigeteilt, daß das den
Rand bedeckende Stück von dem übrigen getrennt ist.
Auf dem ersteren ist in allen vier Feldern, ebenso wie
im Spiegel, je eine Landschaft mit einer Watteauszene
in grüner Farbe gemalt, während der innere Teil dieser
Randfelder ein geometrisches und pflanzliches Orna-
an einer hierfür besonders güustigen Stelle das mit
Königskronen überdeckte Doppelwappen der Besitzer
vielfarbig gemalt (Fig. 2). Vom rechten Schild hängen
die Zeichen der Orden vom Heiligen Geist und vom
Goldenen Vließ herab, unten in der Mitte ist ein Ritter
St. Georg dargestellt. Das rechte Wappen zeigt das
Karls IV., des Königs beider Sizilien, der ein spanischer
Bourbone und ein Sohn einer Herzogin von Parma-
Farnese war.6) Er ist zweimal längs-, die vordere und
mittlere Reihe einmal quergeteilt, so daß er außer dem
Herzschild fünf Felder enthält. Der Herzschild ist blau
mit drei goldenen Lilien (Bourbon), Das erste Feld zeigt
ein mit goldenen Lilien übersätes blaues Feld (Neapel),
das zweite Feld ist längs- und vorn quergeteilt und
zeigt vorn oben in Rot einen gezinnten goldenen Turm
(Kastilien), unten in Silber einen gekrönten roten
Löwen (Leon); hinten ist er schräg graviert von Rot
Fig. 2. Ausschnitt aus einem Kuchenteller
Frl. Dufour-Ferronce, Leipzig
ment, bei dem eine Muschel mit verwandt ist, zeigt.
Ein leichtes Arabeskeornament in Gold schmückt die
acht schmalen Bänder. Die vier mittelgroßen Felder
sind mit Gold bedeckt, aus dem Blumenornamente her-
ausgekratzt sind, so daß hier wieder das Weiß des
Porzellans zuin Vorschein kommt. Auf jedem Stück ist
teaumaler“ noch nicht vor. Erst 1738 fand ich zum erstenmale eine
Benutzung von Watteaustichen erwähnt und zwar hatte damals
Kandler auch einen solchen „Träger mit Mandoline“ modelliert.
Von da an häufen sich die Angaben von Watteaufiguren in der
Malerei. 1744 z. B. hatte man in Meißen ein Kaffee- und Tee-
service derartig bemalt; 1745 eine Credenzschale auf Qoldgrund
und ein Kaffeegeschirr „mit Watteaufiguren aus Grün mit grün
lasiert“, ein anderes „aus Blau mit blau lasiert“, 1746 „4 Uhr-
gehäuse mosaik mit griinen Watteau-F-iguren und lasiert“ u. a. m.
Das Archiv der Meißner Manufaktur bewahrt heute noch eine
größere Anzahl von Watteaustichen, die in ihrer Abnutzung von
einem starken Qebrauch zeugen. Die meisten friiher benutzten
diirften indessen verbraucht sein. Verschiedene davon hat vor
ihrer gänzlichen Vernichtung ein Meißner Maler (Wache) in Tusch-
zeichnung kopiert. So z. B. die große Mittelscene — das sitzende
Paar mit dem Vogelkäfig, zu dem sich eine als Schäferin ver-
kleidete Dame hinneigt -— auf der in Fig. 3 abgebildeten Schale.
Die obere Standscene geht auf das Watteaubild „La voltigeuse“
von Huquier, die untere auf „Les jalouse“ von Scotin gestochen,
zurück.
und Silber und zeigt oben und unten vier goldene Pfähle,
vorn und hinten einen schwarzen Adler (Sizilien).
3. Im goldenen Felde fünf rote Bälle, darüber ein größe-
rer blauer, der mit drei goldenen Lilien belegt ist (Tos-
cana-Medici). 4. Innerhalb eines mit sieben gezinnten
goldenen Türmen belegten roten Bordes (Kastilien) in
Silber fünf blaue Schlidchen, von denen jedes mit fünf
silbernen Bällen belegt ist (Portugal). 5. Im goldenen
Felde sechs blaue Lilien (Parma).
Das linke Wappen ist das einer sächsischen Prin-
zessin, deren Vater König von Polen war. Es ist längs-
und quergeteilt und zeigt den Herzschild von Schwarz
und Gold neunmal geteilt mit einem schrägrechten grü-
nen Rautenkranz (Herzogt. Sachsen). Feld 1 und 4
weisen in Rot einen gekrönten weißen Adler (Polen),
Feld 2 und 3 in Rot einen weißen Reiter (Litauen) auf.
Die in Fig. 1 abgebildete Schale kommt außerdem
noch zweimal in etwa den gleichen Ausmaßen (H. 3,
Durchm. 20,8 : 16) dreimal etwas (H. 3,5, Durchm.
24 : 20) und zweimal bedeutend größer (H. 4,9, Durchm.
36,8 : 28,1) vor (Fig. 3) und zwar im Besitze des Museo
°) Für Deutung dieses Wappens bin ich Oberreg.-Rat Qritz-
ner in Dresden zu Dank verpflichtet.
342
in allen seinen Teilen plastisch und maierisch behandelt
wurde, deutlich machen. Der Rand ist so geformt, daß
er in vier große und vier mittlere Felder geteilt ist,
die voneinander durch je ein schmales Band (zusam-
men also acht) getrennt sind. Da sich eine solche Tei-
lung an der Außenseite des Randes ausprägt, ist dieser
löfach ausgezackt. Die Teilung zieht sich über den
Rand durch die Hohlung; in die Innenfläche hinein. Be-
malt ist der Teller in folgender Weise: Der Rand ist
mit einem breitem Goldstreifen eingefaßt. Die vier
großen Felder sind insofern zweigeteilt, daß das den
Rand bedeckende Stück von dem übrigen getrennt ist.
Auf dem ersteren ist in allen vier Feldern, ebenso wie
im Spiegel, je eine Landschaft mit einer Watteauszene
in grüner Farbe gemalt, während der innere Teil dieser
Randfelder ein geometrisches und pflanzliches Orna-
an einer hierfür besonders güustigen Stelle das mit
Königskronen überdeckte Doppelwappen der Besitzer
vielfarbig gemalt (Fig. 2). Vom rechten Schild hängen
die Zeichen der Orden vom Heiligen Geist und vom
Goldenen Vließ herab, unten in der Mitte ist ein Ritter
St. Georg dargestellt. Das rechte Wappen zeigt das
Karls IV., des Königs beider Sizilien, der ein spanischer
Bourbone und ein Sohn einer Herzogin von Parma-
Farnese war.6) Er ist zweimal längs-, die vordere und
mittlere Reihe einmal quergeteilt, so daß er außer dem
Herzschild fünf Felder enthält. Der Herzschild ist blau
mit drei goldenen Lilien (Bourbon), Das erste Feld zeigt
ein mit goldenen Lilien übersätes blaues Feld (Neapel),
das zweite Feld ist längs- und vorn quergeteilt und
zeigt vorn oben in Rot einen gezinnten goldenen Turm
(Kastilien), unten in Silber einen gekrönten roten
Löwen (Leon); hinten ist er schräg graviert von Rot
Fig. 2. Ausschnitt aus einem Kuchenteller
Frl. Dufour-Ferronce, Leipzig
ment, bei dem eine Muschel mit verwandt ist, zeigt.
Ein leichtes Arabeskeornament in Gold schmückt die
acht schmalen Bänder. Die vier mittelgroßen Felder
sind mit Gold bedeckt, aus dem Blumenornamente her-
ausgekratzt sind, so daß hier wieder das Weiß des
Porzellans zuin Vorschein kommt. Auf jedem Stück ist
teaumaler“ noch nicht vor. Erst 1738 fand ich zum erstenmale eine
Benutzung von Watteaustichen erwähnt und zwar hatte damals
Kandler auch einen solchen „Träger mit Mandoline“ modelliert.
Von da an häufen sich die Angaben von Watteaufiguren in der
Malerei. 1744 z. B. hatte man in Meißen ein Kaffee- und Tee-
service derartig bemalt; 1745 eine Credenzschale auf Qoldgrund
und ein Kaffeegeschirr „mit Watteaufiguren aus Grün mit grün
lasiert“, ein anderes „aus Blau mit blau lasiert“, 1746 „4 Uhr-
gehäuse mosaik mit griinen Watteau-F-iguren und lasiert“ u. a. m.
Das Archiv der Meißner Manufaktur bewahrt heute noch eine
größere Anzahl von Watteaustichen, die in ihrer Abnutzung von
einem starken Qebrauch zeugen. Die meisten friiher benutzten
diirften indessen verbraucht sein. Verschiedene davon hat vor
ihrer gänzlichen Vernichtung ein Meißner Maler (Wache) in Tusch-
zeichnung kopiert. So z. B. die große Mittelscene — das sitzende
Paar mit dem Vogelkäfig, zu dem sich eine als Schäferin ver-
kleidete Dame hinneigt -— auf der in Fig. 3 abgebildeten Schale.
Die obere Standscene geht auf das Watteaubild „La voltigeuse“
von Huquier, die untere auf „Les jalouse“ von Scotin gestochen,
zurück.
und Silber und zeigt oben und unten vier goldene Pfähle,
vorn und hinten einen schwarzen Adler (Sizilien).
3. Im goldenen Felde fünf rote Bälle, darüber ein größe-
rer blauer, der mit drei goldenen Lilien belegt ist (Tos-
cana-Medici). 4. Innerhalb eines mit sieben gezinnten
goldenen Türmen belegten roten Bordes (Kastilien) in
Silber fünf blaue Schlidchen, von denen jedes mit fünf
silbernen Bällen belegt ist (Portugal). 5. Im goldenen
Felde sechs blaue Lilien (Parma).
Das linke Wappen ist das einer sächsischen Prin-
zessin, deren Vater König von Polen war. Es ist längs-
und quergeteilt und zeigt den Herzschild von Schwarz
und Gold neunmal geteilt mit einem schrägrechten grü-
nen Rautenkranz (Herzogt. Sachsen). Feld 1 und 4
weisen in Rot einen gekrönten weißen Adler (Polen),
Feld 2 und 3 in Rot einen weißen Reiter (Litauen) auf.
Die in Fig. 1 abgebildete Schale kommt außerdem
noch zweimal in etwa den gleichen Ausmaßen (H. 3,
Durchm. 20,8 : 16) dreimal etwas (H. 3,5, Durchm.
24 : 20) und zweimal bedeutend größer (H. 4,9, Durchm.
36,8 : 28,1) vor (Fig. 3) und zwar im Besitze des Museo
°) Für Deutung dieses Wappens bin ich Oberreg.-Rat Qritz-
ner in Dresden zu Dank verpflichtet.
342