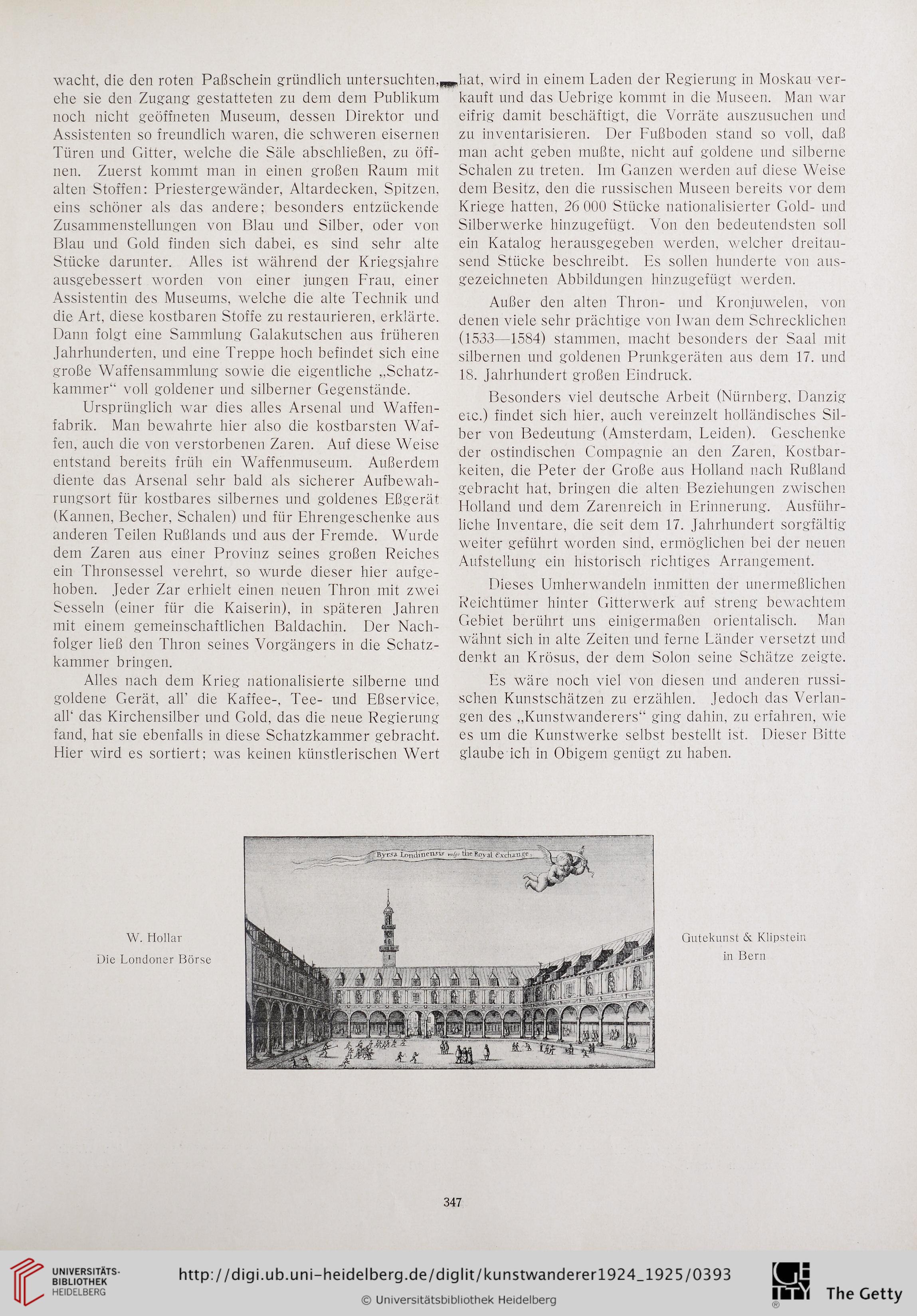wacht, die den roten Paßschein gründlich untersuchten^-^hat, wird in einem Laden der Regierung in Moskau ver-
ehe sie den Zugang gestatteten zu dem dem Publikum
noch nicht geöffneten Museum, dessen Direktor und
Assistenten so freundlich waren, die schweren eisernen
Türen und Gitter, welche die Säle abschließen, zu öff-
nen. Zuerst kommt man in einen großen Raum mit
alten Stoffen: Priestergewänder, Altardecken, Spitzen,
eins schöner als das andere; besonders entzückende
Zusammenstellungen von Blau und Silber, oder von
Blau und Gold finden sich dabei, es sind sehr alte
Stücke darunter. Alles ist während der Kriegsjahre
ausgebessert worden von einer jungen Frau, einer
Assistentin des Museums, welche die alte Technik und
die Art, diese kostbaren Stoffe zu restaurieren, erklärte.
Dann folgt eine Sammlung Galakutschen aus früheren
Jahrhunderten, und eine Treppe hoch befindet sich eine
große Waffensammlung sowie die eigentliche „Schatz-
kammer“ voll goldener und silberner Gegenstände.
Ursprünglich war dies alles Arsenal und Waffen-
fabrik. Man bewahrte hier also die kostbarsten Waf-
fen, auch die von verstorbenen Zaren. Auf diese Weise
entstand bereits früh ein Waffenmuseum. Außerdem
diente das Arsenal sehr bald als sicherer Aufbewah-
rungsort für kostbares silbernes und goldenes Eßgerät
(Kannen, Becher, Schalen) und fiir Ehrengeschenke aus
anderen Teilen Rußlands und aus der Fremde. Wurde
dem Zaren aus einer Provinz seines großen Reiches
ein Thronsessel verehrt, so wurde dieser hier aufge-
hoben. Jeder Zar erhielt einen neuen Thron mit zwei
Sesseln (einer für die Kaiserin), in späteren Jahren
mit einem gemeinschaftlichen Baldachin. Der Nach-
folger ließ den Thron seines Vorgängers in die Schatz-
kammer bringen.
Alles nach dem Krieg nationalisierte silberne und
goldene Gerät, all’ die Kaffee-, Tee- und Eßservice,
all‘ das Kirchensilber und Gold, das die neue Regierung
fand, hat sie ebenfalls in diese Schatzkammer gebracht.
Hier wird es sortiert; was keinen künstlerischen Wert
kauft und das Uebrige kommt in die Museen. Man war
eifrig damit beschäftigt, die Vorräte auszusuchen und
zu inventarisieren. Der Fußboden stand so voll, daß
man acht geben mußte, nicht auf goldene und silberne
Schalen zu treten. Im Ganzen werden auf diese Weise
dem Besitz, den die russischen Museen bereits vor dem
Kriege hatten, 26 000 Stücke nationalisierter Gold- und
Silberwerke hinzugefügt. Von den bedeutendsten soll
ein Katalog herausgegeben werden, welcher dreitau-
send Stücke beschreibt. Es sollen hunderte von aus-
gezeichneten Abbildungen hinzugefügt werden.
Außer den alten Thron- und Kronjuwelen, von
denen viele sehr prächtige von. Iwan dem Schrecklichen
(1533—1584) stammen, macht besonders der Saal mit
silbernen und goldenen Prunkgeräten aus dem 17. und
18. Jahrhundert großen Eindruck.
Besonders viel deutsche Arbeit (Nürnberg, Danzig
etc.) findet sich hier, auch vereinzelt holländisches Sil-
ber von Bedeutung (Amsterdam, Leiden). Geschenke
der ostindischen Compagnie an den Zaren, Kostbar-
keiten, die Peter der Große aus Holland nach Rußland
gebracht hat, bringen die alten Beziehungen zwischen
Holland und dem Zarenreich in Erinnerung. Ausftihr-
liche Inventare, die seit dem 17. Jahrhundert sorgfältig
weiter geführt worden sind, ermöglichen bei der neuen
Aufstellung ein historisch richtiges Arrangement.
Dieses Umherwandeln inmitten der unermeßlichen
Reichtümer hinter Gitterwerk auf streng bewachtem
Gebiet berührt uns einigermaßen orientalisch. Man
wähnt sich in alte Zeiten und ferne Länder versetzt und
denkt an Krösus, der dem Solon seine Schätze zeigte.
Es wäre noch viel von diesen und anderen russi-
schen Kunstschätzen zu erzählen. Jedoch das Verlan-
gen des „Kunstwanderers“ ging dahin, zu erfahren, wie
es um die Kunstwerke selbst bestellt ist. Dieser Bitte
glaube ich in Obigem genügt zu haben.
347
ehe sie den Zugang gestatteten zu dem dem Publikum
noch nicht geöffneten Museum, dessen Direktor und
Assistenten so freundlich waren, die schweren eisernen
Türen und Gitter, welche die Säle abschließen, zu öff-
nen. Zuerst kommt man in einen großen Raum mit
alten Stoffen: Priestergewänder, Altardecken, Spitzen,
eins schöner als das andere; besonders entzückende
Zusammenstellungen von Blau und Silber, oder von
Blau und Gold finden sich dabei, es sind sehr alte
Stücke darunter. Alles ist während der Kriegsjahre
ausgebessert worden von einer jungen Frau, einer
Assistentin des Museums, welche die alte Technik und
die Art, diese kostbaren Stoffe zu restaurieren, erklärte.
Dann folgt eine Sammlung Galakutschen aus früheren
Jahrhunderten, und eine Treppe hoch befindet sich eine
große Waffensammlung sowie die eigentliche „Schatz-
kammer“ voll goldener und silberner Gegenstände.
Ursprünglich war dies alles Arsenal und Waffen-
fabrik. Man bewahrte hier also die kostbarsten Waf-
fen, auch die von verstorbenen Zaren. Auf diese Weise
entstand bereits früh ein Waffenmuseum. Außerdem
diente das Arsenal sehr bald als sicherer Aufbewah-
rungsort für kostbares silbernes und goldenes Eßgerät
(Kannen, Becher, Schalen) und fiir Ehrengeschenke aus
anderen Teilen Rußlands und aus der Fremde. Wurde
dem Zaren aus einer Provinz seines großen Reiches
ein Thronsessel verehrt, so wurde dieser hier aufge-
hoben. Jeder Zar erhielt einen neuen Thron mit zwei
Sesseln (einer für die Kaiserin), in späteren Jahren
mit einem gemeinschaftlichen Baldachin. Der Nach-
folger ließ den Thron seines Vorgängers in die Schatz-
kammer bringen.
Alles nach dem Krieg nationalisierte silberne und
goldene Gerät, all’ die Kaffee-, Tee- und Eßservice,
all‘ das Kirchensilber und Gold, das die neue Regierung
fand, hat sie ebenfalls in diese Schatzkammer gebracht.
Hier wird es sortiert; was keinen künstlerischen Wert
kauft und das Uebrige kommt in die Museen. Man war
eifrig damit beschäftigt, die Vorräte auszusuchen und
zu inventarisieren. Der Fußboden stand so voll, daß
man acht geben mußte, nicht auf goldene und silberne
Schalen zu treten. Im Ganzen werden auf diese Weise
dem Besitz, den die russischen Museen bereits vor dem
Kriege hatten, 26 000 Stücke nationalisierter Gold- und
Silberwerke hinzugefügt. Von den bedeutendsten soll
ein Katalog herausgegeben werden, welcher dreitau-
send Stücke beschreibt. Es sollen hunderte von aus-
gezeichneten Abbildungen hinzugefügt werden.
Außer den alten Thron- und Kronjuwelen, von
denen viele sehr prächtige von. Iwan dem Schrecklichen
(1533—1584) stammen, macht besonders der Saal mit
silbernen und goldenen Prunkgeräten aus dem 17. und
18. Jahrhundert großen Eindruck.
Besonders viel deutsche Arbeit (Nürnberg, Danzig
etc.) findet sich hier, auch vereinzelt holländisches Sil-
ber von Bedeutung (Amsterdam, Leiden). Geschenke
der ostindischen Compagnie an den Zaren, Kostbar-
keiten, die Peter der Große aus Holland nach Rußland
gebracht hat, bringen die alten Beziehungen zwischen
Holland und dem Zarenreich in Erinnerung. Ausftihr-
liche Inventare, die seit dem 17. Jahrhundert sorgfältig
weiter geführt worden sind, ermöglichen bei der neuen
Aufstellung ein historisch richtiges Arrangement.
Dieses Umherwandeln inmitten der unermeßlichen
Reichtümer hinter Gitterwerk auf streng bewachtem
Gebiet berührt uns einigermaßen orientalisch. Man
wähnt sich in alte Zeiten und ferne Länder versetzt und
denkt an Krösus, der dem Solon seine Schätze zeigte.
Es wäre noch viel von diesen und anderen russi-
schen Kunstschätzen zu erzählen. Jedoch das Verlan-
gen des „Kunstwanderers“ ging dahin, zu erfahren, wie
es um die Kunstwerke selbst bestellt ist. Dieser Bitte
glaube ich in Obigem genügt zu haben.
347